Saelde und Ere - Mittelhochdeutsche Originaltexte
'Der Vogel und der Sperber' des Strickers

Ist es nicht herrlich, wenn endlich die Tage länger, die Sonnenstrahlen wärmer und die Röcke der hübschen Maiden ..., nun wenn es wieder Frühling wird, und wenn alles eitel Wonne ist, weil alles sich so gestaltet, wie es sich gestalten soll und nichts unter Tatendrang bremsen kann? Möchte man es da nicht am liebsten den Vögeln gleichtun, die hoch in den frischbelaubten Ästen aller Sorgen ledig, den ganzen Tag lieblich vor sich hinträllern, unbeeindruckt von den Sorgen der Welt?
Doch Achtung, seid gewarnt! Alles Glück ist endlich und schneller als uns dies lieb sein sollte, kann sich fröhliche Unbeschwertheit in fatales Unglück und tiefes Leid verwandeln. Wer sich dessen nicht gewahr ist, so warnt uns die mittelalterliche Fabel vom unbesorgt trällernden Burschen im Baum, der ob so tiefer Inbrunst und Begeisterung uns Lebenslust ganz auf Wesentliches vergaß, der vermag sehr rasch erhascht werden von den Schwingen des Ungemachs ...
Zurück zur Übersicht Mittelhochdeutsch, zum Anschlagbrett, oder zur Hauptseite
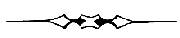
Vogel und Sperber
Auf einem grünen Ast
sang ein Vogel seine Weise
eines Morgens in aller Frühe.
Er war so vertieft darin,
dass er seiner selbst vergaß
und also singend saß,
bis sich ein Sperber herabschwang,
gerade als er allerwonnigst sang,
und ihn mit seinen Klauen packte.
Da wurde ihm seine Stimme rau
und er sang, wie die singen,
die mit dem Tode ringen.
Genau so freuen sich die Weltkinder,
die so weltbezogen sind,
dass sie Gott darüber vergessen
und keine Furcht mehr kennen
und tun, was ihnen gefällt,
bis sie der Tod ereilt
und so schnell erwürgt,
dass ihnen jede Hilfe zu spät kommt.
So nimmt ihre Freude und ihr Spiel
ein böseres Ende und Ziel
als der Vogel, der da sang
und dadurch zu Tode kam.
Denn das Leid, das ihm sein Singen bescherte
war beendet als er starb.
Das Leiden der Weltenkinder aber,
die reulos gestorben sind,
ist ohne Ende und so vielgestaltig,
dass sie ungezählt bleiben müssen.
Vogel und sparwære
Uf einem grüenen rîse
sanc ein vogel sîne wîse
eines morgens vil vruo.
im was sô ernest dar zuo,
daz er sîn selbes vergaz
und alsô singende saz,
unz ein sparwære dar swanc,
dô er aller wünniclicheste sanc,
und nam in in sîne vüeze.
dâ wart im sîn stimme unsüeze,
und sanc, als die dâ singent,
die mit dem tôde ringent.
Alsô vröuwent sich der werlde kint,
die sô vaste mit der werlde sint,
daz si got verlâzent under wegen
und wellent deheiner vorhte pflegen
und tuont, swaz in gevellet,
unz si der tôt ersnellet
und si würget alsô drâte,
daz in helfe kumet ze spâte.
sus nimet ir vröude und ir spil
ein bser ende und ein zil
denne des vogeles, der dâ sanc,
unz er den tôt dâmit erranc.
diu nôt, die im sîn sanc erwarp,
der was ein ende, dô er starp.
sô ist der werldekinde nôt,
diu âne riuwe ligent tôt,
âne ende und alsô manicvalt,
daz si immer belîbent ungezalt.
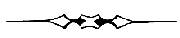
Anmerkungen:
Wer uns vor so viel unbeschwerten Übermut warnt, ist niemand geringerer als der sogenannte Stricker, der sich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts wohl als Wander- und Berufsdichter seinen Lebensunterhalt verdiente (und von dem wir bereits an anderer Stelle über Katzenart lesen durften). Neben einige längere epische Werken - etwa dem recht originellen Artusroman 'Daniel von dem blühenden Tal' -, sind es vor allem lehrhafte Schwänke und Mären, für die er bis heute bekannt geblieben ist ...
So finden sich viele der Streiche, die er seinem 'Pfaffen Amis' angedichtet hat, in ähnlicher Form im späteren Till Eulenspiegel wieder und auch seine scharfe Beobachtungsgabe, die in mancher Fabel zutage tritt, vermag uns immer noch anzusprechen und zu berühren - vielleicht auch deshalb, weil wir uns im Verhalten der dortigen tiergestaltigen Vorbildern viel mehr wiedererkennen als wir dies, recht betrachtet, gerne wahrhaben würden.
Dass uns dieser Spiegel nicht selten in recht komischer Art und Weise vorgehalten wird - wie etwa in der Fabel vom minnenden Kater -, macht uns immerhin erträglicher, zu sehen, was es dort zu sehen gibt. Doch egal, ob nun mit Komik versetzt oder aber recht brachial die Auswirkungen einer Verfehlung oder Vernachlässigung beschreibend, stets ist solchen mittelalterlichen Fabeln und Mären auch ein belehrender Teil angefügt, wodurch sich diese Erzählungen meist von ihren modernerern Nachdichtungen unterscheiden. Wie eben auch in der vorliegenden Erzählung vom Vogel, der ob seiner selbstverliebten Fröhlichkeit dem Sperber zum Opfer fällt ...
Was darauf folgt, ist jener moralisierende Teil, den wir moderne Menschen gar nicht mehr recht verstehen wollen, warnt er doch just davor, dass wir uns den Genüssen und Freuden der Welt hingeben, ohne dabei in Furcht vor jenseitigen Strafen zu erstarren. Wo nun die Wahrheit liegt? Das rechte Handeln? Möglich, dass sich die Antwort wie bei so vielen Fragestellungen irgendwo dazwischen findet: Ängstliches Erstarren vor jeglichem Genuss wird wohl ebensowenig anzustreben sein, wie hemmungslose Ausschweifungen ohne jegliche moralische Bedenken.
Aber wer sind wir schon, als dass wir solche tiefschürfende Fragen beantworten könnten; darum lasst uns zwitschern und fröhlich trällern, solange wir dies vermögen - doch dabei wollen wir nicht vergessen, hin und wieder einen wachsamen Blick nach oben zu werfen ...
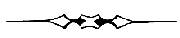
Zurück zur Übersicht Mittelhochdeutsch, zum Anschlagbrett, oder zur Hauptseite
© 2017, Gestaltung und Inhalt: H. Swaton - alle Rechte vorbehalten