Hier nun mögt ihr Verschiedenes erfahren über die Welt des Mittelalters ....
Zur Erläuterung, zurück zum Anschlagbrett oder zurück zur Hauptseite

Mittelalterliche Stadt
Erscheinungsformen

Die mittelalterliche Stadt ist gekennzeichnet durch ... eine Vielfalt von Formen - Teil 2 der Artikelserie
Zurück zum ersten Teil der Artikelserie über die mittelalterliche Stadt
Wie bereits im ersten Teil der Artikelserie über die mittelalterliche Stadt beschrieben, fällt es schwer, ja erscheint es nahezu unmöglich, eine griffige, einfach zu gebrauchende Definition für diese immer mehr an Bedeutung gewinnende Lebensform zu finden. Zu unterschiedlich zeigt sie sich in ihren Ausformungen, zu indifferent in den charakteristischen Merkmalen, als das man mit einer kurzen Aneinanderreihung einiger weniger derselben das Auslangen finden könnte.
So ist es vielmehr ein Bündel von - nicht selten auch negierenden - Merkmalen, das von der modernen Stadtgeschichtsforschung laufend ergänzt und erweitert, zur Beschreibung herhalten muss. Von vom Dorf unterschiedenen Siedlungsform mit verdichteter und gegliederter Bebauung wird da gesprochen, die aber, wie wir bereits früher erwähnt haben, in ihrer Größe stark differieren kann und einer beruflich spezialisierten und sozial geschichteten Bevölkerung Heimstatt bietet.
Ebenso charakteristisch sind - wenn auch mit stark unterschiedlicher Entscheidungsunabhängigkeit - städtische Selbstverwaltungsorgane und eine auf die vorhandenen Strukturen aufbauenden Rechtsordnung, die freie Lebens- und Arbeitsformen sichern soll. Zudem übernimmt die Stadt auch zentrale Funktionen politischer, militärischer, wirtschaftlicher und kultureller Art für die regionale Bevölkerung.

Man denke nur an das Hervorhebungsmerkmal der Märkte, die das Zentrum des wirtschaftlichen Lebens einer jeden Stadt darstellten, die rechtliche Sonderstellung von Stadtgebiet und zugehöriger Besitztümer im Vergleich zum herrschaftlich organisierten Umland, an den Schutz, den die Stadt ihren Bürgern durch Befestigung, Geleitsicherung, Handelsverträge und Bündniswesen zu gewährleisten vermochte, an gemeinschaftsstiftende Feste und Institutionen, welche ein notwendiges Maß an Bildung und (die etwa für den Kaufmann unumgängliche) Schriftlichkeit sicherstellten.
Zudem haben wir es mit einer zeitlichen, nicht zwingend linearen Entwicklung zu tun, innerhalb derer die erwähnten Charakteristika in ihren Ausformungen, ja in ihrem Vorhandensein überhaupt - man denke nur an den Grad der Unabhängigkeit vom Landesherrn - stark differieren können. Die jeweils vorliegende Kombination dieser beschriebenen Kriterien bestimmt einerseits das ganz spezielle Erscheinungsbild einer jeden einzelnen Stadt, ermöglicht andererseits auch eine Einteilung von Städten in bestimmte Typen beziehungsweise die Vorgabe von gewissen Leitformen zur Klassifizierung, die wiederum aus der Betonung spezieller Kriterien resultieren.
Über Großstädte - oder was man damals darunter verstand -, mittlere, kleine und sogenannte Zwergstädte war bereits im ersten Teil der Serie zu lesen; das zugrunde liegende Unterscheidungskriterium der Bevölkerungsanzahl erscheint auf den ersten Blick als das naheliegendste, erwarten wir doch von größeren Städten ein vermehrtes uns stärkeres Auftreten der oben genannten Charakteristika.
Entstehungsgeschichtlich nach ihrer Gründungszeit ließe sich eine Einteilung und Periodisierung treffen in Mutterstädte - etwa bis 1150 - ältere Gründungsstädte bis etwa 1250, Kleinstädte - bis 1300 -, Minderstädte - bis 1450 - und die mit dem Ende des Mittelalters entstehenden Bergbaustädte, denen noch geringer Anzahl Festungs-, Residenz- und sogenannte Exulantenstädte folgten - also Städte, die ihren Charakter wesentlich erst durch den Zuzug einer großen Anzahl von Migranten (etwa Vertriebenen der spätmittelalterlichen Glaubenskriege) erhielten.
Aber es sind vor allem auch verfassungsgeschichtliche Kriterien, die ganz wesentlich für den politischen und sozialen Spielraum der einzelnen Städte zeichnen: So finden sich Reichs- und Freie Städte, landesherrliche und grundherrliche Städte, die nicht selten römische Siedlungen fortführende Bischofsstädte, Kathedral-, Stifts- und Abteistädte oder auch Amtsstädte.
Hingegen lässt die Fokusierung auf wirtschaftlich-soziale Gesichtspunkte eine Unterscheidung in solche Begriffe wie Ackerbürgerstädte, in Gewerbe- und Handelsstädte, Exportgewerbe- und Fernhandelsstädte, in Hafen- und Hansestädte, in Messe-, Wein- und Salzstädte nahe.
Ein Blick auf diese zahlreichen möglichen Einteilungskriterien und daraus resultiernden Typisierungen - deren hier getätigte Aufzählung sicherlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann - verdeutlicht einmal mehr, wie vielfältig sich die Erscheinungsform Stadt im Verlauf des Mittelalters darstellen konnte und wie unmöglich eine eindeutige Definition fallen muss. Andererseits, geht es uns nicht mit vielen Begriffen so (- man denke nur an den von uns allen sorglos gebrauchten Begriff der Intelligenz; wer vermag ihn schon eindeutig zu definieren? -) und vermögen wir nicht dennoch mit ihnen umzugehen?
Grund genug also, in den nächsten Folgen den Blick weg von einer übersichtlichen Betrachtungsweise, welche die Vielfalt bestenfalls benennen, keinesfalls aber detailiert zu beschreiben vermag, ins Innere der Städte selbst, auf die pulsierenden Märkte, in die Straßen der Handwerker, deren Beschäftigungfelder noch in den heutigen Bezeichnungen dieser Straßen der alten Stadtviertel erkennbar sind, und in die holzgetäfelten Ratsstuben der Rathäuser zu lenken.
Geduldet euch also noch ein wenig und besucht uns weiterhin, auf dass wir demnächst gemeinsam mit diesen Expiditionen in dieses bunte mittelalterliche Stadtgewimmel beginnen können ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Gesellschaft im Mittelalter

Abseits der Zünfte und Gilden: Randgruppen der städtischen Gesellschaft
Welcher Termin würde sich besser eignen als der bevorstehende 1. Mai, der Tag der Arbeit - ursprünglich erster religionsunabhängiger Feiertag, nämlich der des damals sogenannten 'Proletariats' -, um hier einen zumindest kurzen Blick auf die Unterprivilegierten und Benachteiligten der mittelalterlichen Städtegesellschaft zu werfen, die in einer Zeit lebten, die körperliche oder soziale Benachteiligungen vielfach als göttliche Strafe für persönliche Verfehlungen oder charakterliche Makel auffasste und die somit auch keine Notwendigkeit sah, diesen Zustand zu ändern ...
Dabei sind diese Randgruppen der städtischen Gesellschaft von den Pauperes der klassischen Ständegesellschaft mit seinem Lehenswesen und der Ständepyramide zu unterscheiden. Letztere bezeichneten Gruppen, die in Abhängigkeit zu anderen standen; unfähig, sich selbst zu schützen, waren sie dem Zugriff der politsch Mächtigen ausgesetzt beziehungsweise auf deren Schutz angewiesen.
Als Pauperes konnten somit Arme in unserem Sinne bezeichnet werden, der Begriff wurde aber nicht nur auf diese Gruppen beschränkt verwendet. So könnte der hörige Bauer durchaus Besitz sein eigen nennen und auch ein Herr, der selbst über Hörige gebot, konnte gegenüber dem Mächtigeren zum pauper werden. In diesem Sinne scheint es nur verständlich, wenn sich Mönche, Nonnen oder Beginen manchmal als Pauperes Christi bezeichneten, eine Geste, die wohl sowohl Demut als auch die Abhängigkeit vom Herrn bezeugen sollte.

'Stadtluft macht frei!', hieß es alsdann. Jedoch galt dieser Satz nicht für alle gleichermaßen, die sich in den neuen Gemeinschaften einfanden. Während wir mit den Änderungen, die mit der Entwicklung der Städte einhergingen, häufig an die strikten Organisationsformen der Zünfte und Gilden denken, gab es dort stets auch einen großen Bevölkerungsanteil der Unterprivilegierten, welche von poltischer Einflussnahme ausgeschlossen blieb.
Einerseits lag dies in den Besitzverhältnissen begründet: Anders als bislang, galt in der Stadt Reichtum als erstrebenswert, Erfolg im Handel und Handwerk waren entscheidend für den Aufstieg in das neu entstehende Patriziat; jene die besitzlos waren und aufgrund der sozialen Gegebenheiten bleiben mussten, konnten an den vielen Vorzügen dieser neuen Entwicklungen nicht teilhaben.
Die Pauperes der Städte waren nun jene, die tatsächlich arm beziehungsweise besitzlos waren und nach der Logik der Zeit somit auch nicht oder nur begrenzt an Entscheidungsprozessen teilnehmen durften. Dabei handelte es sich um die Unterschicht der mittelalterliche Städte, Bettler, Lohnträger und -arbeiter, Zugezogene, die mittellos und ohne Bürgerrecht blieben ...
Aber auch anderen Randgruppen der Zunft- und Gildengesellschaft wurden kollektiv gewisse negative Eigenschaften zugeschrieben, infolge derer sie einen vollständigen oder zumindest teilweisen Verlust ihrer Rechte aber auch ihres Ansehens bzw. ihrer Ehre erfuhren, wodurch der 'gewöhnliche, gutangesehene' Bürger den Umgang mit ihnen vermied oder auf gewisse, spezielle Situationen und Gelegenheiten beschränkte.
Spezielle Situationen, Gelegenheiten ... da kommen uns natürlich sofort die 'Hübschlerinnen', die Dirnen bzw. Prostituierten in den Sinn, deren Tätigkeiten durchaus als dem Gemeinwesen nützlich und unumgänglich angesehen wurde (konnte doch beispielsweise der Geselle kaum dem Erreichen gesetzteren Alters heiraten und derart an eine Frau - nicht selten die Witwe des Meisters - gelangen), die aber doch in einem, von Stadt zu Stadt unterschiedlichen, insgesamt recht ambivalenten Rechtsstatus lebten.
Ähnliches gilt für den Rechtsstatus der Scharfrichter, der Henker also und ihrer Gesellen, deren Tätigkeiten zwar ebenfalls als der Gemeinschaft dienlich und unverzichtbar galten, deren niedriger sozialer Status aber durch Berührungsverbote und Niederlassungsvorschriften gekennzeichnet war. Auch war das Ansehen jener, die im Rahmen ihrer Tätigkeit mit Kadavern und Exkrementen in Berührung kamen - Schinder, Gassenfeger, Latrinenreiniger - gemindert, ebenso wie Bader und Bademägde, denen man (nicht immer zu Unrecht) Nähe zur Kuppelei bzw. Prostitution nachsagte.
Zudem fanden sich Barbiere und Bartscherer ebenso unter diesen zwar benötigten, aber dennoch mindergeachteten Randgruppen wie etwa nichtakademisch ausgebildete Heilkünstler oder auch Tierverschneider, wobei manche Berufsgruppen wie etwa die Zöllner oder Müller im Lauf der Zeit ebenfalls die zweifelhafte Ehre der Aufnahme in diesen Kreis erfuhren. Nicht zu vergessen sind bei dieser Aufzählung jedenfalls auch die sogenannten 'Fahrenden', also Gaukler, Musikanten, Schauspieler, Tänzer, etc.
Gewisse ethnisch-religiöse Gruppierungen - wie etwa die jüdischen Gemeinschaften - standen ebenso am Rand der städtischen Sozialordnung und mussten im Laufe der Geschichte sogar mehrfach Progrome erfahren. Nicht zuletzt erfuhren alle jene, die mit angeborenen Auffälligkeiten ('Achtung vor Rothaarigen!') oder aber Behinderungen zur Welt kamen bzw. die im Laufe ihres Lebens unheilbar erkrankten (Aussatz, ...) eine soziale Stigmatisierung, die sich bestenfalls in Misstrauen, schlimmstenfalls in Absonderung (etwa in sogenannten 'Leprosorien') oder Verfolgung äußerte.
Zum Glück zählt heutzutagen bei Wahlen jede Stimme gleich, egal ob arm oder reich, und alles hat sich zum Besseren gewendet, ... Doch halt, wirklich alles?
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Gesellschaft im Mittelalter

Geheime Bruderschaften und dergleichen mehr: die Gesellschaft der 'Coquille'
Im Verborgenen wirkende Gesellschaften und Bruderschaften, erregen, wenn man die Einspielergebnisse manch Literaturverfilmung als Maßstab heranzieht, gegenwärtig großes Interesse - insbesondere dann, wenn ihr Wirken bis in die fernen Zeiten des angeblich so dunklen Mittelalters zurückreicht. Was wird da nicht alles über verborgene Schätze, heil- und machtbringende Laden und Kelche, über unentzifferte Ritzsymbole und codierte Schriften spekuliert und fabuliert.
Gold- und Rosenkreuzer, Freimaurer, Illuminaten werden als Träger eines Wissens verdächtigt, das über Templer und Gralsträger bis in die Tage Christi zurückreichen soll und zudem als Bewahrer manch obskur verborgener Blutlinie betrachtet. Nun, wir von Sælde und êre maßen uns nicht an, derartige Theorien mit absoluter Gewissheit auszuschließen, wissen doch getreue Leser recht gut, wie auch die bewährten Mitarbeiter unserer Wissenschaftsredaktion (vorzüglich in den ersten Apriltagen) schon manch abstruse Spekulation zum mehr oder weniger akzeptiertem Stand der Forschung werden ließen.
Nicht zuletzt aber auch wegen des Wissens darüber, dass derartige Gesellschaften, deren Zwecke und Absichten sich von rein religiösen bis hin zu sehr weltlichen bewegen konnten, im Mittelalter tatsächlich existierten. Eine solche Gesellschaft, im Frankreich des 15. Jahrhunderts beheimatet und mit Intentionen, die alles andere denn religiöse Ziele beinhaltete, war die der sogenannten Coquille, deren Name sich auf die lateinische Bezeichnung der Muschel oder des Schneckengehäuses zurückführen lässt.

Nebstbei darf es nicht verwundern, dass die recht deftige und unverblümte Ausdrucksweise des Volksmundes im Altfranzösischen mit dem Begriff rasch das weibliche oder männliche Geschlechtsteil und in weiterer Folge den gehörnten Ehemann aber auch die ungetraue Gattin oder deren Liebhaber assoziierte. Sei es wie es sei - als Coquillard wird man sich bei solchen Begriffsbelegungen kaum einen Ehrenmann vorstellen dürfen.
Und tatsächlich handelt es sich bei besagter Gesellschaft der Coquille um eine Bruderschaft, die man heutzutage am ehesten als eine Partei der Ausgestoßenen bezeichnen würde, um denn deren Mitglieder, die 'Muschelbrüder' nicht allzu einseitig nur als Gauner und Raufbolde zu diskriminieren. Betrachtete man allerdings das Kollegium dieser 'elitären Vereinigung' und die darin vertretenen 'Berufe', mit denen der tägliche (oder besser nächtliche?) Broterwerb sichergestellt wurde, dann müsste man wohl doch die Begriffe Schurkenpack und kriminelle Bande zur Beschreibung heranziehen.
Wir erinnern uns: Mitte des 15. Jahrhunderts endete (nach einer 116-jährigen Epoche von nur von kurzen Waffenruhen unterbrochenen Kampfhandlungen zwischen Frankreich und England) der unsägliche Hundertjährige Krieg mit dem Sieg der französischen Krone. Längst hatten alle beteiligten Parteien Söldner in ihren Diensten gehabt, freie Kompanien, deren Mitglieder nun, nach Beendigung der Feindseligkeiten nicht länger benötigt und damit auch nicht mehr besoldet wurden.
Nicht alle fanden ein Unterkommen bei anderen Herren oder den Weg zurück ins bürgerliche oder bäuerliche Leben, sei es nun freiwillig oder unfreiwillig. Erfahren darin, Beute zu machen, schien es für manch einen vielleicht nur ein bequemer, für den anderen aber ein überlebensnotwendiger Schritt zu sein, seinen Lebensunterhalt in ähnlicher, wenn auch nun illegaler Art, fortzuführen. Diese sogenannten Escorcheurs ('Schinder') bildeten wohl den Kern und auch das Hauptkontingent der Coquille, ansehnliche Kopfzahl und höchstwahrscheinlich auch straffe Organisation einbringend.
Denn gut organisiert war sie, die Bruderschaft, deren auch ausländische Mitglieder - nebst ehemaligen Söldnern finden sich solch illustre Berufsgruppen wie Beutelschneider, Diebe, Falschspieler, Einbrecher, Fälscher und Meuchelmörder, aber auch Hehler und Goldschmiede zur 'Weiterverarbeitung von Beuteobjekten, im Kollektiv vertreten - sich untereinander möglicherweise durch eine unter der Kleidung versteckt getragenen Pilgermuschel zu erkennen gaben: Eine 'Jargon' genannte Geheimsprache sicherte Nachrichten, bestimmte geheime Zeichen an Häusern angebracht, gaben anderen 'Brüdern' Hinweise über die Gewohnheiten der Insassen und die Ertragsaussichten für mögliche Beutezüge.
Besagte Organisation stellte auch sicher, dass wichtige Mitteilungen und Warnungen in kürzester Zeit über verborgene Wege ihre Empfänger erreichten, Unterstützungskassen und soziale Hilfen sorgten dafür, dass kein Mitglied in materielle Not geriet und überall dort, wo die Bruderschaft vertreten war, fanden ortsfremde Brüdern Unterkunft, Verpflegung und Unterstützung. Vorbildlich, sollte man meinen - soferne man eben keinen genaueren Blick auf die ausgeübten Tätigkeiten wirft ...
Als prominentes Mitglied der Gesellschaft sei François Villon, der bedeutende Dichter des französischen Spätmittelalters, genannt. Früh zum Mörder geworden, stellt er, der zum Magister artium Ausgebildete, sein Wissen und seine Schreibkenntnisse unter anderem dazu zur Verfügung, um mit behördlichen Eingaben bedrängte Brüder zu unterstützen - bis er, der selbst allzu aktiv in diverse 'Aktionen' involviert, Paris fluchtartig verlassen muss und nun selbst auf die Hilfe der Gesellschaft angewiesen ist.
Spuren hat sie jedenfalls hinterlassen, diese Gesellschaft der Coquille, auch wenn ihre Mitglieder nicht selten dem Arm - oder Strick - des Gesetzes zum Opfer fielen, wie etwa Mitte der 1450er Jahre in Dijon: So gehören fortan Ritzzeichen zum Repertoire manch anderer zwielichtiger Gruppierung, der 'Jargon' hat Eingang in unsere Umgangssprache gefunden und im Pariser Bettlerkönig des Victor Hugo und seinen Genossen, welche der verurteilten Esmerlda zu Hilfe eilen wollen, meint man noch die Erinnerung an eine solche Organisation zu erkennen ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Redensarten
und Handwerk

Alte Redensarten - Viel auf dem Kerbholz zu haben, ...
... und das nachweislich, bedeutet heutzutage, recht schlechte Karten dafür zu besitzen um etwa an die Anstellung als Nachtportier im noblen Mädcheninternat oder an eine Einladung zur angesagten Schickimicki Dinnerparty der Upper Class zu gelangen (... wobei, ... für Letzteres soll dem Hörensagen nach gerade die entsprechende 'Vorkarriere' in manchen Fällen die Eintrittskarte bedeutet haben ..)
Jedenfalls ist die besagte Redensart, die jemanden attestiert, er habe viel auf dem Kerbholz, ein typischer Fall für die häufig anzutreffende Bedeutungsveränderung beziehungsweise Bedeutungsverengung, die althergebrachte Ausdrücke und Begriffe im Laufe der Jahrhunderte erfahren können. Besucher und Leser unserer Seite wissen über diesen häufig anzutreffenden Umstand ja bereits Bescheid.

Bezeichnen wir mit dieser Aussage doch fast immer jemanden, der häufig gegen Gesetze verstoßen hat - meist denken wir dabei an jene das Staates, manchmal aber auch an moralische - und der solcherart als Schurke zu gelten hat! (An dieser Stelle möchten wir im Sinne genderkorrekter Darstellung anmerken, dass wir in unserer Darstellung zwecks besserer Lesbarkeit meist ausschließlich die männliche Form verwenden, dass wir dabei aber selbstverständlich sinngemäß auch die bessere Bevölkerungshälfte miteinbeziehen: Schurken meint also hier auch die Schurkinnen, somit möge sich niemand benachteiligt vorkommen ...)
So hat also unserem heutigen Verständnis nach einer, der häufig in unrechtmäßiger Weise Bares von Banken behebt, seinen Drucker als Nationalbankpressenersatz betrachtet oder sich als übler Schläger betätigt, um demzufolge regelmäßig den Komfort der Ausnüchterungszelle zu genießen, ebenso eine Menge auf dem Kerbholz wie der- oder diejenige, die die Reize ihrer Liebsten gewohnheitsmäßig heimlich mit jenen anderer Exemplare ihrer Art 'vergleichen' ... und somit unserem Verständnis nach Schuld auf sich geladen hat.
Schuld - oder besser Schulden, letzterer Begriff ist schon recht gut geeignet, um an den Ursprung unserer Redensart zurückzufinden: Diente doch das Kerbholz über lange Epochen hinweg (Spuren führen zurück ins vorgeschichtliche Europa, auch waren vergleichbare Methoden in vielen Kulturen bis in unsere Zeit hinein gebräuchlich - teilweise mit Knochen statt Holz als Material) dazu, Arbeits- und Sachgüterleistungen nachweislich aufzuzeichnen, um sie bei Gelegenheit abzurechnen. Alte Buchführung, könnte man das auch nennen.
Zu diesem Zwecke bestand das Kerbholz(-system)) (auch Kerbstab, Zählholz, Zählstab) üblicherweise aus zwei Teilen, die durch Längsspaltung eines Holzstabes gewonnen wurden: Als Stock wurde die größere, mit Griff ausgestattete Teil bezeichnet, als Einsatz der kleinere abgespaltene.
Einen Teil behielt der Gläubiger, der andere verblieb beim Schuldner, wobei zuvor idente Kerben für erbrachte Leistungen in die aneinandergelegten Stäbe geritzt oder gekerbt wurden. Solcherart erhielten beide Seiten einen fälschungssicheren Nachweis, der auch vor der mittelaltelichen Gerichtsbarkeit Gültigkeit hatte.
Es waren aber nicht nur Geldschulden und Arbeitsleistungen, die derart verzeichnet wurden: Pflichten, Nutzungsrechte, Lagerbestände, Steuerquittungen - für alle diese und noch viele weitere Zwecke wurden Kerbhölzer zur Dokumentation herangezogen.
(Erwähnenswert dazu: Im 17. Jahrhundert waren 'Wertpapiere' der englische Krone in Form königlicher Kerbstöcke im Umlauf; Steuerquittungen wurden dort bis ins 19. Jahrhundert hinein in Form von Kerbhölzern - sogenannten exchequer tallies - ausgestellt, ehe man diesen Gebrauch mit der Steuerreform 1834 abschaffte und im Zuge dessen die nicht mehr benötigten Hölzer verbrannte, dabei aber versehentlich gleich den alten Westminsterpalast, in dessem Hof dieses Event stattfand, mitabfackelte ...)
Dumm gelaufen, möchte man meinen. Doch zurück zum Gebrauch der Kerbhölzer: Nicht nur offiziell, sondern vor allem auch im Landwirtschaftswesen kamen die Stäbe noch bis ins 19., im Sennereiwesen sogar noch bis ins 20. Jahrhundert hinein zur Anwendung, wobei die Kerben eingeritzt, eingeschnitten, eingesägt, eingefeilt oder aber auch eingebrannt werden konnten. Zu gegebener Zeit erfolgte dann die gemeinsame Abrechnung durch Gläubiger und Schuldner. War die erledigt, wurde das Holz 'abgekerbt', d.h. die Kerben durch geeignete Bearbeitung entfernt.
Insbesondere für den regelmäßigen Schenkenbesucher dürfte dieser Umstand eine gewisse Erleichterung bedeutet haben, schaffte er doch wieder genügend Platz für zukünftige Umtrunke. Wenn hingegen einer dieser Nachtvögel mit der Abrechnung im Verzug war, er also schon 'zuviel auf dem Kerbholz hatte', mochte ihn der gute Wirt schon einmal trocken vor die Türe gesetzt haben.
Ein solch nachvollziehbar traumatisches Erlebnis muss sich wohl derart ins kollektive Gedächtnis all dieser verschmähten durstigen Mäuler eingebrannt haben, dass einer ursprünglich hochgelobten Methode zur geregelten Abrechnung unterschiedlichster Geschäftskontakte unsere heutige, so negative besetzte sprichwörtliche Redensart entspringen konnte ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Mittelalterliche Stadt
Definition

Die mittelalterliche Stadt ist gekennzeichnet durch ... - Teil 1: Ein Definitionsversuch ...
... sollte nun wirklich kein Problem darstellen, würden wir recht selbstsicher meinen, schließlich erkennt ein jeder von uns die mittelalterliche Stadt sofort als solche, wenn er sie in der Mittelalterdokumentation oder im neuesten Fantasyepos auf Bildschirm oder Leinwand erblickt.
Da laufen Männer mit Röcken und seltsamen Kopfbedeckungen durch die Gegend, die Maiden tragen noch Kleider an Stelle der Jeans und irgendwo gibt es auch stets eine Mönchsprozession zu entdecken oder eine von den durchdringenden Tönen der Schalmei begleitete Gauklerdarstellung, deren staunendes Publikum gerade von beutelschneidenden Schurken umschlichen wird wie dereinst die grasenden Brontosaurierherden von hungrigen Raptoren!
Wenn dann noch viel Dreck auf schmutzigen Straßen herumliegt (vom Schwein, nicht vom zuvor genannten käuenden Dickhäuter!), die beschattet werden von Fachwerkshäusern, und durchs Tor unter dem zinnbekränzten Mauerwerk ein Karren am Pranger vorbei in Richtung Marktplatz ächzt, dann sind wir uns sicher: Das ist sie, die mittelalterliche Stadt, so wie sie ausgesehen haben muss!

Tatsächlich erstaunt uns ob solch vermuteter Eindeutigkeit, dass es doch tatsächlich die Fachleute sind, die sich darüber nicht zur Gänze einigen können oder sich doch lange Zeit nicht einigen konnten, wie denn nun die idealtypische (hoch- und spät-)mittelalterliche Stadt tatsächlich beschaffen zu sein hätte um eben als solche zu gelten - als Stadt nämlich! Oder genauer: Wie sie zu definieren wäre, damit diese Definition das zu leisten imstande wäre, was zu leisten ihre Aufgabe sein sollte - nämlich Klarheit und eindeutige Klassifizierungsmerkmale zu schaffen, um die Städte der damaligen Zeit von anderen Siedlungsformen zu unterscheiden ...
Wortklauberei mag da einem Gutteil der Leserschaft in den Sinn kommen, doch denkt man andererseits an das wohlbekannte, geflügelte Wort 'Stadtluft macht frei', das ja in den damaligen, mit der Stadtentwicklung einhergehenden Veränderungen seinen Ursprung hat, so scheint es doch eine ganze Menge an Vorteilen gebracht zu haben, dort gelebt zu haben, wo man sich dieser Freiheiten erfreuen konnte. Grund genug also für uns, die Frage, was denn nun eigentlich eine Ansiedlung von Menschen zur Stadt werden ließ.
Die Größe war's, zweifelsohne die Größe, hören wir da sofort den Ersten rufen! Der Weiler, das Dorf, die Sporenburg auf der schroffen Klippe - zweifelsohne beherbergten diese Siedlungsformen bei weitem nicht die Anzahl an Menschen wie die vom Marktgeschrei erfüllten Städte an deren Flusshäfen die Waren aus fernen Ländern entladen wurden und, und, und ... Denkt doch nur an die Großstädte Konstantinopel, Bagdad, Cordoba, Mailand oder gar an das ferne Angkor Wat!
Und im deutschsprachigen Raum? Werfen wir einmal einen Blick auf die Verhältnisse zu Beginn des 14. Jahrhunderts, in eine Zeitepoche also, in der die Städteentwicklung pulsierte, bestehende Städte sich mehr und mehr vergrößert hatten und Neugründungen fast an der Tagesordnung standen. Für Deutschland glaubt man damals rund 4000 Städte - eher waren es sogar noch mehr - verorten zu können, von denen viele in manchen Gegenden des Südwestens kaum mehr als vier Wegstunden voneinander entfernt lagen; anderswo waren es sieben oder acht, die der Wandersmann zurückzulegen hatte um von einem Stadttor zum nächsten zu gelangen.
Ein engmaschiges Netz also, sollte man meinen. Klar, dass es bei einer solchen Dichte nicht jede der besagten Ansiedlungen mit den großen Metropolen aufnehmen konnte, aber das braucht es ja gar nicht, um unsere Vorstellungen von der zünftigen Mittelalterstadt zu erfüllen. Tatsächlich finden sich unter dieser erklecklichen Anzahl von Städten auch etwa 50 Großstädte, die sich weiter als 50 ha ausdehnten und die - man höre und staune! - mehr als 5000(!) Einwohner aufzubieten hatten.
Als Großstadt gilt dem deutschen Hochmittelalter also alles, was über 5000 Seelen beherbergt (das ist weniger, als mitunter ein moderner Riesenbau in der modernene Stadt aufnimmt), 20000 ist bereits ein Wunder an Vielfalt und die rund 40000 Kölner lassen sich von keiner anderen deutschsprachigen Stadt der damaligen Zeit übertrumpfen. Aber Achtung, wir reden hier von den 'Großen'!
Dahinter folgen geschätzte 200 Städte 'mittlerer' Größe, solche die auf nicht weniger als 20 ha zwischen 2000 und 5000 Einwohner beherbergen. Und die restlichen immer noch rund 4000 als Städte ausgezeichneten Siedlungen? Wie könnten sich Kleinstädte mit weniger als diese 2000, wie sich gar ebenfalls existierende Zwergstädte, deren 500 Eiwohner sich wohl besser kannten als unsereiner den Nachbarn zwei Stockwerke höher, wie könnten sich derartig kleine Städte von größeren Dörfern so wesentlich unterschieden haben, um daraus ihren Status abzuleiten? Durch die angesprochene Einwohnerzahl wohl kaum!
Dann waren es vielleicht die Befestigungen, könnte unser nächster Gedanke sein: Mauern und Türme. Doch lässt sich zeigen, dass nicht jede Stadt befestigt war, dies aber wohl manches Dorf. Dann sind es der oder die Märkte, welche die Stadt auszeichnen? Sicherlich - doch finden sich Märkte, wenn auch in geringerem Ausmaß in Dörfern. Und um wieviel reichhaltiger wird schon das Angebot auf dem Markt einer dieser besagten Klein- oder Zwergstädte ausgesehen haben?
Verfassung und Verwaltungsgremien, die Rechte und Privilegien vielleicht? Sicherlich lässt sich hierbei eine städtische Tendenz ausmachen - doch waren diese Privilegien nicht in allen Städten gleich ausgeprägt, manche fehlten mancherorts, andere, bereits erworbene oder in langwierigen Auseinandersetzungen mit den Stadtherren erkämpfte gingen später wieder verloren.
Die Stadt mit ihren Zünften und Gilden, den Fernhandelskaufleuten, den Festen und Feiertagen als Zentrum des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens eines Gebietes? Dies kann sicherlich für die größeren und mittleren Städte gelten, doch gilt dies und in welchem Ausmaß gilt dies auch so für die kleinen und kleinsten?
Wir sehen, es tun sich bei genauerer Betrachtung beträchtliche Unterschiede in dem auf, was damals Stadt war - und damit auch Schwierigkeiten, eine allgemein gültige Definition zu finden. Belassen wir also für dieses erste Mal bei der einfachen Feststellung, dass alles das Stadt war, das ein Stadtrecht besaß, auch wenn dieses von Fall zu Fall recht unterschiedlich ausgeprägt sein konnte, und auch ...
... wenn die Formen der mittelalterlichen Städte - abgesehen von ihrer Größe - auch sonst recht stark differieren konnten, wie dies in der nächsten Fortsetzung der Artikelserie beschrieben wird.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Technologie des MA
Papier

Papier und seine Herstellung - Teil 3: Über die frühe Technik der Herstellung ...
Zurück zum ersten Teil oder zum zweiten Teil der Artikelserie über die Ausbreitung der Papierherstellung.
Nachdem wir in den ersten beiden Folgen unserer Serie über die Geschichte des Papiers einiges über die historischen Hintergründe seines Ursprunges und seiner mehr als ein Jahrtausend währenden Wanderung hörten, die es von China ausgehend über den arabischen Herrschaftsbereich und über Spanien beziehungs- weise Sizilien nach Europa führten, wollen wir diesmal einen Blick auf den Herstellungsprozess des Schreib- materials selbst werfen.
Tatsächlich ist die Papierherstellung engstens mit der Kraft des Wassers verbunden: Mühlen nutzte man bereits seit der Antike beziehungsweise seit der Frühmittelalter zum Mahlen von Getreide, entweder in Form von Mühlen mit waagrecht liegenden oder senkrecht stehenden Wasserrädern, wobei die beschreibenden Quellen vorerst kaum eine Unterscheidungsmöglichkeit zwischen beiden Formen, der horizontalen und der vertikalen, bieten. Als Beispiel sei etwa das englische 'Domesday-Book', das 1086 nach der normannischen Eroberung Englands für dort 5684 Mühlen auflistet.

In besagter Quelle findet sich mit der Beschreibung einer Anlage an der Hafeneinfahrt nach Dover auch eine Besonderheit bei der Ausnutzung der Wasserkraft, wie sie auch 1044 und 1078 für Venedig dokumentiert ist und ebenso für Gebiete in Südfrankreich belegt ist: die Gezeitenmühle, die ein Beleg dafür zu sein scheint, wie sich der erfindungsreiche Mensch auch abseits von Flüssen mit genügender Strömungsgeschwindigkeit die Kraft des Wassers zu eigen zu machen versucht.
Der Einsatz der Nockenwelle, die bereits der Antike bekannt war, dort aber nur vereinzelt zur Anwendung kam, in Mühlen der vertikalen Form schuf vielfältige Einsatzgebiete für die rasch aufstrebenden Gewerbe des frühen und vor allem hohen Mittelalters, auch wenn die vorhandenen Quellen meist nicht den Schleier über den Ursprung dieser Entwicklungen zu heben vermögen.
So wurde mit Hilfe der Nockenwelle das Stampfen und Klopfern von Hanf und Flachs in der Landwirtschaft möglich. Eine recht frühe Verwendung dieser technischen Errungenschaft, deren Einsatz bereits damals mit den Aufbruch in das mechanisierte Zeitalter der Menschheit beschreibt, scheint auch in der Eisenproduktion möglich. Ganz wesentlich ist ihr Einsatz jedenfalls in den hochmittelalterlichen Walkmühlen für die Tuchproduktion, aber auch in den Waid-, Loh- und Erzmühlen der damaligen Zeit findet sie Anwendung.
In der europäischen Papierherstellung, die wie bereits angesprochen über zwei Wegen auf unseren Kontinent fand, wurde das mechanische Lumpenstampfwerk beziehungsweise die Hadermühle zum kennzeichnenden Merkmal des Produktionsverfahrens. 1074 ist die Papierherstellung aus Leinenhadern im maurisch-spanischen Xativa bezeugt, in Katalonien arbeiten während des 12. Jahrhunderts mit den molendos draperios bereits Lumpenmühlen.
Die Nockenwelle und mit ihr das mechanische Stampfen und Quetschen zerschnittener Altgewebe und Stoffe ist hingegen erst in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts im italienischen Fabriano in der Mark Ancona nachweisbar, wo es Wollarbeiter waren, die das für die Textiltechnik entwickelte Walkverfahren für die Papierfabrikation nutzbar machten, indem sie mit Eisennägel beschlagenen Stössel zum Aufbereiten respektive Auflösen und Zerstampfen der Lumpen benutzten.
Dabei mussten auch die Böden der trogförmigen Vertiefungen des Grubenbaums, in denen der Stampfvorgang der Hadern stattfand und durch die man Wasser leitete, um als Zwischenprodukt der Papierproduktion den möglichst hellen Materialbrei für den weiteren Herstellungsvorgang an der Schöpfbütte zu erhalten, mit Eisen verstärkt werden, andernfalls der kontinuierliche Aufprall der 'beschuhten' Stampfen oder Hämmer an den Schwingen das Holz zerfasert hätte. Welch ohrenbetäubender Lärm, den man sich in einem solchen Stampfwerk vorstellen muss, in dem es runde zwei Tage brauchte, um den Stoffbrei für die Weiterverarbeitung zuzubereiten ...
Wesentlich für die erfolgreiche Papierproduktion ... war ein gelungenes Recycling - und das bereits im 13. Jahrhundert! Die für die Herstellung erforderlichen Altstoffe, die Lumpen, mussten in genügender Menge zur Verfügung stehen. Als Beispiel für die frühe Organisation der Rohstoffbeschaffung stellt die Republick Venedig dar, deren Senat den Papiermühlen von Treviso, die mit Ende des 13. Jahrhunderts beginnend entstanden, bereits 1366 ein Privileg zum Lumpensammeln ausstellte.
Zudem wurde die Ausfuhr von Lumpen und Papierabfällen aus dem Herrschaftsbereich, der sich seit der 'venezianischen Landnahme' mehr und mehr ins nördliche Hinterland der Serenissima erstreckte, untersagt. Die Lumpensammlerei stellte somit in der damaligen Zeit ein eigenes ehrbares Gewerbe dar, Lumpen und Altpapier wertvolle Rohstoffe (die Wiederverwertung von altem Papier resultierte allerdings nur in Kartons geringer Qualität).
Es waren also Baumwoll-, Leinen-, Hanf- und Flachslumpen, die sogenannten Hadern, welche als Rohstoffe zum Einsatz kamen. Deren verarbeitungsgerechte Aufbereitung erforderte bereits einen großen Aufwand: So mussten Schnallen und Knöpfe entfernt werden, Nähte aufgetrennt, die Lumpen nach Material und Farbe getrennt und mit dem Sensenmesser zerkleinert werden und in Fäden aufgelöst werden. Erst nach einem hinreichend langen Faulungsprozess ging es dann ab ins besagte Stampfwerk.
Die ersten Papiermühlen jenseits der Alpen finden sich übrigens in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts im französischen Troyes; 1390 und 1393 folgen in Nürnberg und in Ravensburg die ersten derartigen Mühlen im deutschsprachigen Gebiet ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Das Frankenreich
Frühmittelalter

Einhard (oder Eginhard), der Biograph Karl des Großen
'Vitam et conversationem et ex parte non modica res gestas domini et nutritoris mei Karoli, excellentissimi et merito famosissimi regis, postquam scribere animus tulit, quanta potui brevitate conplexus sum, operam inpendens, ut de his quae et meam notitiam pervenire potuerunt nihil omitterem neque prolixitate narrandi nova quaeque fastidientium animos offenderem; ...'
(Aus dem Vorwort der Vita Karoli Magni)
So kurz als möglich wollte er also über die Taten seines Herrn und Gönners berichten, der trefflichen König Karls, wie er in der Vorrede seines bekanntesten erhaltenen Werkes schrieb. Und so ist uns Einhard (auch Eginhard oder nach eigener Schreibung Einhart) gemeinhin auch in Erinnerung geblieben: als Biograph des großen Karolingerkaisers Karl, als einziger übrigens, der dessen Biographie noch in unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Wirken des legendären Herrschers schrieb.
Aber nicht nur die zeitliche Nähe zeichnet den Biographen Einhard aus, sondern vor allem seine Stellung in der berühmten Hofschule und mehr noch die Wertschätzung, die ihm Karl entgegenbrachte, welche soweit ging, dass er sich des Vertrauens, ja einer langwährenden engen Freundschaft mit dem Herrscher selbst und dessen großer Familie rühmen konnte.

Ein solcher Mann, der sich diese Stellung im inneren Kreis des karolingischen Machtzentrums zweifelsohne durch Zuverlässigkeit, Tüchtigkeit und vielseitige Fähigkeiten erarbeitet hatte, wusste mit Sicherheit eine Menge zu sagen über die Persönlichkeit des Kaisers und über die Geschehnisse während dessen Herrschaft - nicht immer exakt den tatsächlichen historischen Geschehnissen entsprechend, häufig die Taten beschönigend - was sonst sollte ein wohlgesonnener Biograph auch machen? -, doch stets so, dass er uns ein lebendiges Bild der Persönlichkeit Karl vor Augen stellt. Doch ist die Vita ein Thema, dem ob seiner Bedeutung jedenfalls ein eigener Beitrag gebührt ...
Wer war also dieser Einhard? Mehr als der Biograph jedenfalls, als der er uns im Bewusstsein geblieben ist. Viel mehr! Man könnte ihn wohl mit gutem Gewissen als Universalgenie seiner Zeit nennen, als einen jener zugleich Gelehrten, Berater, Künstler, Schriftsteller und wohl auch Politiker, die in unmittelbarer Umgebung des Kaisers wirkend, maßgeblich zur von Karl initiierten karolingischen Renaissance beitrugen.
Geboren wird Eginhard um 770 in der Maingegend. Als Abkömmling einer vornehmen ostfränkischen Familie erhält er seine Erziehung im Kloster Fulda, das in jener Zeit das Bildungszentrum des östlichen Frankenreichs darstellte und somit viele Adelssprösslinge zur Ausbildung vereint. Der auffällig kleingewachsene Eginhard fällt in dieser Umgebung rasch durch Witz und Schärfe des Verstandes auf und wird folglich vom aufmerksamen Abt Baugulf um 790 zur weiteren Ausbildung an den Aachener Hof empfohlen.
Dort ist zu jener Zeit mit dem Engländer Alkuin von York ein anderer berühmter Gelehrter seiner Zeit Vorsteher der berühmten, von Karl begründeten Hofschule und zugleich Berater des Noch-nicht-Kaisers. Einhard versteht es durch seine Gelehrsamkeit und seine Begabungen rasch, sich den Lob und das Vertrauen des Vorgesetzten und Lehrers zu erarbeiten, so dass ihn dieser mit der Aufsicht über die literarischen und mathematischen Studien Karls betraut, woraus sich schon bald die oben erwähnte Freundschaft mit dem Herrscher entwickelt.
Nach dem Rückzug Alkuins in ein Kloster bei Tours übernimmt Einhard dessen Nachfolge in der Führung der Hofschule. Durch seine ausgezeichneten Kenntnisse der Baukunst und wohl auch durch erwiesene Geschicklichkeit, jedenfalls aber besonderes Verständnis auf dem Gebiet der Malerei und kunstgewerblicher Arbeiten dazu befähigt, ernannte ihn Karl zudem zum Aufseher über Bauten und kunstgewerbliche Werkstätten. Gerade wegen seiner vielfältigen technischen Fähigkeiten wurde er in der Hofschule, in deren Kreis man unter historischen Alias-Namen verkehrte, als Beseleel, nach dem Erbauer der jüdischen Stiftshütte, gerufen.
Freundschaft, Befähigung, Vertrauen - diese Attribute lassen es nur natürlich erscheinen, dass ihn der Kaiser, den er als mittlerweile enger Berater fast immer auf dessen Reisen begleitet, schließlich auch für politische Aufgaben heranzieht: So reist er 806 in Karls Auftrag nach Rom, um dort vom Papst die Zustimmung für die beabsichtigte Reichsteilung im Zuge der Nachfolgeregelung für die Söhne zu erwirken.
813 ist er der Wortführer der fränkischen Barone, die erreichen, dass Karl seinen Sohn Ludwig zum Mitregent erhebt, jenen Ludwig dem Frommen, dessen Privatsekrätär und anfänglicher Berater Einhard nach Karls Tod wird und der ihm für seine treuen Dienste mehrere Abteien zum Geschenk macht, obwohl Einhard selbst wohl nie dem geistlichen Stand angehört, sondern die Führung dieser Gemeinschaften als Laienabt innehat.
Das Vertrauen, das ihm auch Ludwig anfänglich entgegenbringt, zeigt sich unter anderem dadurch, dass ihn dieser 817 zum Lehrer seines Sohnes Lothars macht. Trotzdem kritisiert Einhard schon bald nach Ludwigs Herrschaftsantritt dessen Politik und macht ihn für das zunehmende Dahinschwinden der fränkischen Macht verantwortlich. In den späteren Konflikten zwischen dem Vater und seinen Söhnen Lothar, Pippin und Ludwig versucht Einhard zu vermitteln - selbst sieht er seine Symphatien aber immer auf Seiten seines Zöglings Lothar.
Als die Konflikte innerhlb der kaiserlichen Familie immer ärgere Formen annehmen und Einhard wohl auch seinen Einfluss auf Ludwig schwinden sieht, bittet er um Entlassung aus dem Hofdienst und zieht sich mit seiner Gemahlin Imma in das von ihm gegründete Kloster Seligenstadt zurück, dessen von ihm (nach der durch eine Vision veranlasste Überführung der Gebeine der heiligen Märtyrer Marcellinus und Petrus Martyr) erbaute Basilika auch seine sterblichen Überreste und die seiner 836 verstorbenen Gemahlin beherbergt - die entgegen hartnäckiger Gerüchte jedoch keine Tochter Karls war.
Also entbehrt auch der schönen Geschichte, in der die angebliche Karlstochter Emma den schmächtigen Gelehrten nach einem heimlichen nächtlichen Stelldichein über die verräterische Neuschneedecke trug, um dem auf seine Töchter äußerst eifersüchtigen Kaiservater keinen Grund zum Verdacht zu geben - eine Eifersucht, die ja bekanntermaßen zu einigen seltsamen Beziehungen und unehelichen Kindern Anlass gab ...
840 starb mit Einhard schließlich in Seligenstadt, nachdem er zuvor noch einigemale in die politischen Geschehnisse eingegriffen hatte und so etwa zur 839 zwischenzeitlich erfolgten Aussöhnung zwischen Ludwig und seinem Sohn Lothar beigetragen hat, einer der gelehrtesten Männer der Zeit, der - und das ist seine besondere Tragik - in seinen letzten Lebensjahren noch den zunehmenden Verfall von Karls Lebenswerk mitansehen musste.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Redensarten
und Handwerk

Alte Redensarten - Den Tag nicht vor dem Abend loben, ...
... an einen solchen Vorsatz sich zu halten, das bedeutet nicht etwa, ein chronisch übellauniger Pessimist zu sein, ein solcher, der stets seine Gläser halbleer, das Fetträndchen am servierten Burgunderschinken und das einzige graue Haar in den rabenschwarzen Locken der Liebsten zu erblicken gewöhnt ist, und der anstatt die lieben Täublein und Kinderlein mit Leckereien zu füttern, diese mit seinem krummen Stock vertreibt!
Nein, nein, meint es, klug der Lebenserfahrung Rechnung zu tragen - entweder jener, die man selbst schmerzvoll am eigenen Leibe erfahren musste oder aber am reichen Erfahrungsschatz unserer Vorfahren teilzuhaben, welche um das Auf und Ab und die vielen kleineren und größeren Überraschungen wussten, die das unberechenbare Dasein für uns bereithält - ist es doch Frau Sældes Glücksrad, dessen Drehungen unvermutete Wendungen mit sich bringen, vor denen auch die Großen nicht zur Gänze gefeit sind. .

Nicht umsonst nämlich warnt Herr Schiller den mächtigen Feldherrn Wallenstein mit den klugen Worten: 'Und doch erinnr' ich an den alten Spruch: Man soll den Tag nicht vor den Abend loben.' Wie's denn schlussendlich um den kaiserlichen Oberbefehlshaber bestellt war, wissen wir! Schließlich ist das Glück bekanntlicherweise ein Vögelchen und die mögen nicht lange stillzusitzen ...
Doch ist es nun beleibe nicht so, dass die Warnung vor allzu frühen Lobpreisungen eine Eigenschöpfung des großen Dichters und Dramatikers gewesen wäre. Nein, derartige, sich stark ähnelnde Formulierungen reichen weiter in die Vergangenheit zurück, spiegeln sich in ihnen schließlich die Erfahrung mit den Umtrieben der stets unberechenbaren und wankelmütigen Fortuna wider.
Zwar stimmt es: Menschen sind verschieden wie Tag und Nacht, was ihre Sicht der Dinge und der Welt betrifft. Dennoch meinen wir, dass es für einen jeden von uns nur von Vorteil sein kann, aus dem überlieferten Erfahrungsschatz der Alten zu schöpfen. Daher auch unser Bestreben, hier auf unseren Seiten exklusiv für euch, liebe Leser unserer Seiten, alte Sprüche zu entschlüsseln, um euch deren Weisheit zugänglich zu machen und derart das tägliche Leben zu erleichtern!
Merkt also gut auf, was uns die Skalden der isländische Edda zu raten wissen - denn in ihren Werken findet sich der möglicherweise älteste Beleg für unser geflügeltes Wort, wenn es nämlich heißt - und dabei gehen wir in der Zeit zurück ins eisige 10. oder 11. Jahrhundert, als die Nordmänner noch Drachenschiffe besaßen und keine TV-Empfangsantennen - wenn es also im Hávamál, einem Sittengedicht der damaligen Zeit, heißt:
'...
At kveldi skal dag leyfa, konu es brend es,
mæki es reyndr es, mey es gefin es,
is es ýfir komr, ol es drukkit es.
...'
Von wegen nur Met trinken, Klöster plündern und Abenteuerreisen buchen! Spricht denn aus den angeführten Zeilen nicht pure Weisheit, erworben im harten Alltag des eisigen Atlantikstürme? Gegossen in gefühlsstarke Lyrik, die uns die vermeintlich rauen Männern näher zu bringen vermag, indem sie uns ihre verborgene, poetische Seite offenbart ...
Den Wenigen unter euch, die des Altisländischen nicht mächtig sind, wollen wir durch die Beifügung einer Übersetzung natürlich ebenfalls die Gelegenheit geben, an der Weisheit der Nordmannen teilzuhaben - bedenkt aber, dass sich die ganze Schönheit der lyrischen Zeilen stets nur im Original zu offenbaren versteht. (So empfiehlt es sich auch, der Angebeteten die angeführte Skaldendichtung eher im Original zu rezitieren, denn in der übersetzten Form.)
Horcht also auf:
'...
Lobe den Tag am Abend, das Weib, wenn es verbrannt ist,
das Schwert, wenn es versucht ist, das Mädchen, wenn es vermählt ist,
das Eis wenn es überquert ist, das Bier, wenn es getrunken ist.
...'
Da ist es also wieder, das uns immer noch geläufige Wort, wenn auch in ausführlicherer Weise als wir es heute zu gebrauchen wissen. Schade um diesen (verkürzten) Umstand, denn all die angeführten Punkte erscheinen uns nach wie vor noch von brennender Aktualität! ... Zumindest einige davon, ... ... jedenfalls dürften die letzte Empfehlung manche unter euch aus eigener Erfahrung nachzuempfinden wissen ...
Darum horcht also auf das 'Sed vero laus, in fine canitur, et uespere laudatur dies', wie es mittelalterliche lateinische Epigramme des 12. Jahrhunderts raten oder auf das 'Ein guten tag sol man auff den obent loben' der Schwabacher Sprüche vom ausgehenden 14. Jahrhundert. Beherzigt dies und trinkt stets rasch euer Bier, damit es sich nicht erwärme und darum allen Lobes verlustig gehe ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Ikonographie

Ikonographie und Typologie - Teil 4: Von Acheiropoieten und Schweißtüchern ...
Zum ersten, zweiten bzw. dritten der Artikelserie.
Wer versucht, die Inhalte abendländischer Bilddarstellungen zu deuten, speziell solcher, die im Mittelalter entstanden sind, wird kaum Beispiele finden, die ihn nicht mit christlichen Inhalten konfrontieren. Dies ist, meinen wir, sicherlich ein gewichtiger Grund dafür, in unserer Serie einen oder auch mehrere Blicke auf einige, für die damaligen Künstler bedeutsamen Symbole beziehungsweise Gegenstände zu werfen. Speziell dann, wenn es sich dabei um Objekte handelt, die uns Heutigen unerklärlich, jedenfalls aber fremdartig anmuten müssen ...
Obwohl wir in der vorangegangenen Folge davon lasen, wie die Streitigkeiten darüber, ob und unter welchen Umständen die Abbildung Jesus Christus dem Gebot des 'Du sollst Dir kein Abbild Gottes machen' widersprächen, zum auch historisch so bedeutsamen Bilderstreit der östlichen Christenheit führten, findet sich doch keine Epoche, in der wir nicht von Christusbildern hören oder aus späteren Abbildungen von ihnen erfahren.

Bemerkenswerter Weise erscheint Christus in frühchristlichen Darstellungen - also in Darstellungen aus der Epoche, die seinem Auftreten noch vergleichsweise nahe lag - keineswegs in einheitlicher Physignomie. Was sicherlich der Tatsache geschuldet ist, dass die Evangelien zwar viel über sein Wirken, nichts jedoch über sein Aussehen zu berichten haben. Also griff man bei den Abbildungen wohl auf zeitgenössische heidnische Bildgestaltungen bedeutsamer, als Vorbilder geeigneter Persönlichkeiten zurück.
So darf es nicht verwundern, Christus bald bartlos und jugendstrotzend anzutreffen (ist es zu weit hergeholt, dabei an den jugendlichen, der Sonne verbundenen Apoll zu denken?), dann wieder als bärtigen Philosophen (wo doch mancher dieser antiken Denker dem Christentum bedeutsame Impulse zu geben vermochte - man denke nur an die neuplatonischen Einflüsse oder jene des Cicero auf das Denken des Augustinus von Hippo - und durchaus als gewisses moralisches Vorbild gelten konnte). Zudem trat mit der Christianisierung des römischen Reiches zunehmend einer wechselseitige Beeinflussung zwischen Kaiserbild und den Darstellungen Christi in Erscheinung.
Was jedoch bald starken und immer stärkeren Einfluss auf die Art der Christuszeichnung in der abendländischen Kunst zeigte, waren die in ihrer Entstehung selbst der heutigen Zeit noch Rätsel aufgebenden Acheiropoieten, die in ihrer Einzigartigkeit, zudem gestützt durch vielerlei Legenden von ihrem Ursprung, eine hohe Authentizität zu garantieren schienen - zumal sie, anders als die typisierenden Darstellungen, charakteristische Merkmale aufwiesen, die mit den Beschreibungen der Evangelien etwa über die Wunden der Geisselung und Kreuzigung in Einklang zu bringen waren.
Ein 'Acheiropoietos' bezeichnet ein nicht von Hand gemachtes, in übernatürlicher Weise entstandenes Bild Jesus Christus oder der Jungfrau Maria; durch die wundersame Art ihres Zustandekommens wären derartige Acheiropoieten nach christlichem Glauben zudem in der Lage, die beiden Naturen Christi abzubilden und zudem würden sie nicht dem Abbildungsverbot widersprechen.
Eines der berühmtesten dieser Acheiropoieten, die von den mittelalterlichen Zeitgenossen meist als Schweiß- oder Grabtuch Christe gesehen werden, ist das 'Mandylion', das seit 944 in Konstantinopel den Gläubigen jeweils zur Fastenzeit zur Verehrung gezeigt wurde und über dessen Entstehung mehrere Legenden kursierten, die allesamt davon zu erzählen wussten, wie der an einer schweren Krankheit leidende König Abgar von Edessa in seiner Not einen Boten, mit der Bitte ihn zu heilen, an Christus sandte
Nach einer Variante - den apokryphen Thaddäus-Akten - stellte der leidende König dem Boten einen Maler zur Seite, der Christus portraitieren sollt - daran aber scheiterte: Das Göttliche, so die Aussage der Legende, lässt sich nicht von Menschenhand abbilden! Also drückte Christus, der sich des Königs erbarmte, sein Antlitz in ein Tuch, das daraufhin sein Abbild trug. Eine andere Version weiß zu berichten, dass es das Schweißtuch war, mit dem Christus sich während der Passion sein Gesicht trocknete, das der Bote, besagter Thaddäus, dem König brachte.
Das Schweißtuch Christi ist es auch, das mit dem 'Vera Icon', dem 'wahren Bild', im Westen gegen Ende des 12. Jahrhunderts in Konkurrenz zum ostkirchlichen Mandylion trat (wohl nicht gänzlich unbeeinflusst von großem Kirchenschisma 1054 und der dadurch steigenden Konkurrenz der Kirchen). Der Legende nach handelt es sich dabei um jenes Tuch handelte, das die Heilige Veronika (deren Name aus einer Umstellung des Vera Icon gebildet wurde) Christus auf seinem Weg zum Schädelberg reichte und das später, von ihr nach Rom gebracht, dort den Kaiser zu heilen vermochte.
Das Vera Icon, das zu den Arma Christi zählt, also zu den Darstellungen, die im Zusammenhang mit der Passion Christi stehen, entwickelte sich bald zum beliebten Andachts- und auch Ablassbild, dem die gleiche Heilwirkung zugeschrieben wurde wie den Reliquien Heiliger; in den mittelalterlichen Bilddarstellungen findet es sich häufig in der Hand der Veronika, die es dem Betrachter präsentiert - die aber bemerkenswerterweise bei der Darstellung des Christusportraits, weil diese auf dem Originaltuch nur noch schemenhaft zu erkennen waren, wieder auf die uns heute in den Christusdarstellungen geläufigen Züge des Mandylions zurückgriffen.
Die Spur des Mandylion verliert sich 1204 nach der (christlichen) Plünderung Konstantinopels im Zuge des 4. Kreuzzuges - manche Historiker vermuten in ihm jedoch das 1357 erstmalig urkundlich bezeugte Turiner Grabtuch. Wie die 150 Jahre Zeitspanne zwischen dem Verschwinden des einen und dem Auftauchen des anderen erklärt werden können, und die Tatsache, dass im einen Fall von einem Antlitz berichtet wird, das Grabtuch jedoch einen ganzen Körper zeigt - nun das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte, auf die wir euch noch vertrösten müssen (soferne uns ein gewisser Dan Brown nicht zuvorkommt) ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Ikonographie

Ikonographie und Typologie - Teil 3: Von der schauenden Betrachtung zum Erkennen ...
Zum ersten bzw. zweiten Teil der Artikelserie.
... und von der gewonnenen Erkenntnis zum richtigen Handeln - so könnte eine Kurzbeschreibung dafür lauten, wie man sich der mittelalterlichen, über lange Jahrhunderte hinweg fast ausschließlich durch christliche Inhalte (und für religiöse Zwecke intendierte) Bilderwelt annähern sollte. Oder - vielleicht richtiger -, wie man dies in jenen Zeiten hielt, in denen jene Werke noch nicht hauptsächlich wegen ihres künstlerischen Wertes als betrachtenswert empfunden wurden.
Wer also über Ikonographie sprechen möchte und die Bedeutung, die vorzugsweise frühmittelalterlichen Bilddarstellungen innewohnt, der hätte korrekterweise nicht damit zu beginnen, welche Bedeutung dieser oder jener Geste im betrachteten speziellen Darstellungskontext zuzuordnen und wie die Anordnung und Kombination der manchmal widersprüchlich gebrauchten Symbolgegenstände auszulegen wäre - obwohl doch zweifelsohne von großer Bedeutung, wie wir bereits an anderer Stelle vernommen haben.

Nein, eigentlich müssten wir mit einer mentalen Reise beginnen und - soferne dies für uns neuzeitliche, von Technik und Naturwissenschaften (oder, in anderer Auslegung von Konsum und Kommerz) geprägte Menschen - uns derart in die Denkweise jener Zeiten zu versetzen suchen. Denn nach frühmittelalterlicher Denkweise wollte die (fast immer religiöse) Darstellung nicht einfach nur den Bildinhalt zeigen, sondern ihr wohnte stets ein Verweischarakter inne, der bei korrektem Verständnis schlussendlich zum rechten (christlichen) Handeln führen sollte.
Vom Schauen zur Erkenntnis und daraus folgend zum Gebet. Jedes dieser christlichen Bilder besaß also einen (verdeckten) Verweischarakter, den es für den Betrachter zu erkennen galt und für den es derart zum Zeichen werden konnte für die Wahrheit einer anderen Dimension, die sich nach damaliger Denkweise jeder Darstellungsform entziehen musste.
Neben dem offensichtlich Erkennbaren, seinem 'sensus litteralis' (dem 'Buchstabensinn') wohnt also der Darstellung ein höherer Sinn ('sensus spiritualis') inne, den es zu erkennen gilt; ein Vorgang, der aber nur durch schrittweise, (kirchlich-)korrekte Auslegung möglich wird (ein Vorgang, der sich auch beim geschriebenen Wort in Form der Exegese wiederfindet).
Nur so wird verständlich, warum die Kirche die Darstellung des Göttlichen in Bildform überhaupt gestatten konnte, wo doch das Alte Testament unmissverständlich forderte 'Du sollst dir kein Gottesbild machen' ('...und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel oben, auf der Erde unten oder im Wasser oder unter der Erde'). So wird aber auch nachvollziehbar, warum widerstreitende Auslegungen, warum aber auch neuentstehende Verehrungsformen im Zusammenhang mit bildlichen Darstellungen - etwa Prozessionen mit Heiligenbildern oder -statuen, das Aufstellen von Lichtern, Waschungen, Kuss und Kniefall - im byzantischen Osten zu den Wirrungen des Ikonoklasmus (Bildersturm bzw. Bilderverbot) im 8. Jahrhundert Anlass geben konnten.
Hier treffen Auslegungen und Sichtweisen aufeinander, die einerseits stark von den neuplatonischen Lehre eines Plotin beeinflusst sind, die von einer abnehmenden Vollkommenheit vom Göttlichen herab in die Bereiche des Seienden ausgeht, diesem Seienden aber immer noch zugesteht, ein (unvollkommenes) Abbild des Göttlichen, einen Schatten des Urbildes darzustellen. Dem Bildnis fällt also nach dieser Denkweise die Aufgabe zu, eine Idee vom nicht wiedergebbaren Geistigen zu vermitteln.
'... Der Sinn des Bildes ist es, das Verborgene auszudrücken, denn das Bild ist nur ein Abbild des Unsichtbaren und die Betrachtung des Sichtbaren kann den Gläubigen zur Schau des Göttlichen emporheben ...'
('Himmlische Hierarchie', Pseudo Dionysios-Areopagites, um 500)
Die entgegengesetzte Strömung fühlt sich dem Johanneswort 'Gott ist Geist' verpflichtet, sieht im Bilderkult ein Abgleiten zurück in abergläubische (vorchristliche) Praktiken und lehnt die Darstellung kategorisch ab. Nach ihnen wäre die Gottheit Christi nicht darstellbar. Daher könne ein Künstler, der Christus darstelle nur den Menschen Christus darstellen, womit er die beiden Naturen, die der Erlöser in sich vereine, trenne - womit er der Irrlehre der Nestorianer verfalle!
Im (zweiten) Konzil von Nicäa fanden diese Streitigkeiten einen Abschluss, in dem die Bilderverehrer (Ikonodulen) als Sieger hervorgingen - was wohl auch der Erkenntnis geschuldet war, dass sich die Bilderverehrung in weiten Kreisen der Bevölkerung nicht ausrotten lassen würde. So sollte die 'Ehrung' der Bilder im Gegensatz zu ihrer 'Anbetung' erlaubt sein, denn die dürfe nur dem Höchsten selbst zukommen: 'Wer zu einem Bild betet, betet eigentlich zu dem, das darauf abgebildet ist!'
Ungenaue Übersetzungen ins Lateineische, politische Differenzen zwischen Karl dem Großen und Papst Leo III wegen der Teilnahme der Römischen Kirche, führten schließlich zu einer eigenen Auslegung der Bilderverehrung im Westen, wodurch die ohnehin bestehenden Differenzen zwischen den chrsitlichen Hemnisphären noch vergrößert wurden - aber sich auch schon ein erster Gegensatz zwischen Kaiser und Papst andeutete, der drei Jahrhunderte später im Investiturstreit kulminieren sollte ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Alte Berufe
Färber

Vom Handwerk des Färbens und seiner Bedeutung 2 ...
Zurück zum ersten Teil der Artikelserievon Bekleidungsfarben thematisierte.
Das Färben mit den einheimischen Naturstoffen, von denen im vorangegangenen Beitrag die Rede war, war ursprünglich und für lange Zeit mit der Herstellung der Stoffe eng verbunden; die Tuchscherer und Wollmacher färbten ihre eigenen Produkte häufig selbst.
Mit der Zunahme der Bevölkerung mit dem 12. Jahrhundert, besonders aber auch dem Aufkommen verfeinerter höfischer Sitten und auch dem Erstarken nennenswerter Absatzmärkten in den immer bedeutsamer werdenden Städten nahm der Bedarf an gefärbten Stoffen zu - zumal erstmals wieder modische Aspekte eine Rolle zu spielen begannen. Wir lesen nun vom gezielten, sehr arbeitsintensiven Anbau der benötigten Farbpflanzen in gewissen Regionen, bevorzugt aber auch in der Umgebung der Städte, in denen die Verarbeitung erfolgte.

Der Anbau spezieller, für die Färbung der Stoffe benötigter Pflanzen bedarf einer Spezialisierung, für die es Anreize geben muss. Diese Anreize bestanden im (Fern-)Handel mit den aufbereiteten Farbstoffen und den dabei, durch die zunehmend höhere Nachfrage, zu erwartenden hohen Gewinnspannen. Denn häufig entstehen solche Anbaugebiete in räumlicher Nähe zu den Erzeugerzentren der Stoffe, häufig, aber nicht immer und die Preise, die mit hochwertigen Färbemitteln zu erzielen sind, rechtfertigen den beschwerlichen Transport.
Gezielter, großangelegter Waidanbau findet ab dem 12. Jahrhundert in Namur statt, im 13. Jahrhundert folgen niederrheinische Gebiete, Thüringen, Piemont und die Toscana, die Gascogne und die Normandie und zunehmend mehr und mehr Gebiete. In den sogenannten Waidmühlen gemahlen und zu kleinen Ballen gepresst beziehungsweise in Tonnen gefüllt, werden die Färbstoffe zu den großen europäischen Messeplätzen transportiert und dort von den sogenannten Waidmessern auf ihre Qualität hin beschaut und von häufig in Zünften organisierten Waidhändlern gehandelt.
Um Mitglied in einer solchen Zunft werden zu können, musste der einzelne Händler ein hohes Eigenkapital vorweisten können; andererseits waren mit dem Waidhandel, der über große Distanzen hinweg erfolgen konnte, hohe Spekulationsgewinne zu erzielen. Als Abnehmer fungierten die Färber oder, soferne sich solche bereits gebildet hatten, die Färberzünfte einer Stadt, also die Verwerter der Färbemittel.
Auch der Krappanbau erfolgte in bevorzugten Landstrichen - im nördlichen Seeland bereits seit dem 12. Jahrhundert -, wobei sich im Falle des Waids mit dem Voranschreiten der Zeit die Anbaugebiete mehrten, ebenso wie dies im Falle des Wauanbaus der Fall war, der etwa ab 1300 weitverbreitet in Europa einsetzte.
Eine zünftische Organisation besaßen die Färber auch dann noch nicht, als sich viele andere Berufsgruppen bereits derart organisiert hatten. Vielleicht lag dies daran, dass sie lange Zeit im Schatten der Stofferzeuger arbeiteten beziehungsweise - wie bereits erwähnt - die Tätigkeit des Färbens vom Tuchweber selbst erledigt wurde. Und dort, wo die Tätigkeiten getrennt waren, gab es stets weniger Färber als Tuchmacher, wohl auch deshalb, da das Färben vergleichsweise weniger Zeit benötigte als die Stoffherstellung.
Ursprünglich war der Beruf des Färbers wohl nicht besonders hoch angesehen, war die Tätigkeit, bei der man viel mit übel riechenden Substanzen, wie etwa Urin, die als Beizmittel gebraucht wurden, zu tun hatte, mit Gestank verbunden. Und Klagen, etwa über die Verschmutzung von Gewässern, deren es bedurfte, um die gefärbten Kleidungsstücke zu spülen, kannte man in allen mittelalterlichen Städten - speziell in späteren Zeiten, als die Färberei in fabriksähnlichen Anlagen durchgeführt wurde ...
Die Kreuzzüge und die damit einhergehende Intensivierung der Handelskontakte nach Byzanz und in die Levante brachten, wie in vielen anderen Bereichen auch, eine deutlichen Entwicklungsschub. Zwischen dem 9. und dem 12. Jahrhundert entwickelte sich italienische Städte durch den Kontakt mit dem sarazenischen Besatzern und den byzantinischen Enklaven zu Zentren der Seidenherstellung. Als Beispiel sei hier das als Handelszentrum ohnehin bedeutsame Lucca genannt, das sich im Laufe des 12. Jahrhunderts zum wichtigsten italienischen Produktionsstandort für die Seidenherstellung entwickelte.
Die Nachfrage nach den Seidenstoffen, deren Wert durch prächtige Farbgebung noch bedeutend gesteigert werden konnte, beförderte die Nachfrage nach neuen, aus dem Osten stammenden Färbematerialien: So wurden etwa Indigo, Saflor, Krapp, aus Indien und Südostasien stammende Farbhölzer wie Brasilholz oder der für die Seidenfärbung besonders bedeusame Safran eingeführt - und, was klimatisch verträglich war, zunehmend auch in verschiedenen europäischen Landstrichen angebaut.
Es darf nicht verwundern, dass es gerade diese blühenden Zentren der Textilherstellung in Norditalien, aber auch in Flandern oder Köln sind, in denen sich bereits während des Hochmittelalters das Färbergewerbe zu Zünften organisierte und sich eine Spezialisierung - Garn- und Tuchfärber, Woll- und Leinenfärber, Blau- und Rotfärber, Schwarz- und Schönfärber - ausbildet, während anders wo die Färber häufig in ihren alten Abhängigkeiten verblieben ...
Teuere Stoffe, wertvollere Farbmittel - die Vielfalt nimmt also zu. Wie nun der eigentliche Färbevorgang ablief, darauf wollen wir dann im nächsten Beitrag der Serie, auf den wir euch an dieser Stelle vertrösten, einen genaueren Blick werfen.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Alte Berufe
Färber

Vom Handwerk des Färbens und seiner Bedeutung 1 ...
Kleidung stellte in vielen Epochen der Menschheitsgeschichte eine hervorragende Möglichkeit dar, die soziale Position des Trägers im täglichen Leben hervorzukehren; je teurer und wertvoller die verwendeten Stoffe, die oftmals weite Handelswege zurücklegen mussten, je aufwendiger die Verarbeitung, umso mehr hoben sie Stellung der jeweiligen Person hervor.
(Sollte nun jemand über derarige 'Oberflächigkeiten' den Kopf schütteln, möge er doch daran denken, welcher Stellenwert sogenannter 'Markenware', deren hoher Preis sich nur selten durch entsprechende Qualität erklären lässt, auch heutzutage noch zugestanden wird; einmal mehr ein Indiz dafür, dass sich menschliche Verhaltensweisen nicht in allen Bereichen so stark verändert haben, wie von uns Modernen so gerne angenommen; nach wie vor neigen wir gewissen Eitelkeiten zu ...)

Doch nicht nur die Qualität des Stoffes war für Preis und damit Prestige ausschlaggebend! Wenig überraschend spielte auch die Farbgebung, ob nun in der Antike, im gesamten Verlauf des so auf äußerliche Wirkung bedachten Mittelalters, ja bis weit in die Neuzeit hinein, eine wesentliche Rolle - zumal in besagten Epochen die Färbung ob der nicht vorhandenen modernen künstlichen Färbmaterialien eine ungleich aufwendigere und viel handwerkliches Geschick voraussetzende Tätigkeit darstellte.
Bekleidung und deren Farbe als Kennzeichnung der sozialen Stellung: So nimmt es nicht Wunder, dass immer wieder Vorschriften und Verbote den Kreis jener einzuschränken suchten, die sich mit 'bunten Federn' zu schmücken suchten (man denke dabei nicht nur an das Purpur, das ausschließlich den römischen Cäsaren vorbehalten war; auch das Hochmittelalter kennt Bekleidungsvorschriften für die unterschiedlichen Stände, die etwa zu verhindern suchen, dass Neureiche allzu protzig in Konkurrenz zum Adel oder zum eingesessenen Patriziat treten). Zudem stand die Kirche modischen, allzu bunten Tendenzen stets äußerst reserviert gegenüber - wenngleich auf Dauer selten erfolgreich.
Wie auch immer der Stand jener war, welche die Bekleidung trugen - sei es nun, um damit zu repräsentieren, sich damit modisch zu schmücken oder darin ihre tägliche Arbeit zu erledigen - , bestand fast immer der Wunsch, die Stoffe gefällig mit anderer Farbe zu versehen als der naturgegebenen der verwobenen Fasern. Wurde diese Aufgabe häufig (und vor allem im ländlichen Raum bei Eigenproduktion noch lange) von den Herstellern der Stoffe, den Tuchmachern, selbst erledigt, entwickelte sich im Laufe des Mittelalters, ausgehend vom mittel und norditalienischen Raum, der sich immer mehr sich spezialisierende Beruf des Färbers (mhdt. verwer).
Die Aufgabe der Färber bestand darin, entweder Garnen oder fertigen Geweben - etwa Leinen, Wolle, später auch Seide und Baumwolle - in ihrer Gesamtheit eine bestimmte, häufig genau vorgeschriebene Färbung zu geben (im Gegensatz zum Druck, der die Farbe nur auf die Oberfläche aufbringt). Dabei konnte man sich ursprünglich ausschließlich natürlicher Farbstoffe bedienen, die vorzugsweise aus pflanzlichen Bestandteilen (Samen, Blüten, Früchten, Wurzeln, Hölzern, Rinden, Blättern, Kräutern), aber auch aus Mineralien oder tierischen Produkten gewonnen wurden.
Zu den wichtigsten Färbematerialien zählten der bereits den Ägyptern bekannte und von den Römern als rubia bezeichnete Färberkrapp, aus dessen getrockneten, zu Pulver zermahlenen Wurzeln man verhältnismäßig preisgünstig den Rotfarbstoff Alizarin erzeugen konnte - woraus ja nach Bearbeitung Farbtöne von Rot bis Orange resultierten.
Vermutlich von den Benediktinern aus dem Mittelmeerraum über die Alpen mitgebracht, empfiehlt bereits das Capitulare de villis, die sogenannte Landgüterverordnung Karl des Großen, den Anbau jener Pflanze, die über lange Zeit den wichtigsten Färbestoff für das begehrte Rot lieferte.
Eine ähnliche Bedeutung wie der Krapp besaß auch der gleichfalls bereits seit dem Altertum bekannte Färberwaid, dessen Verwendung bis ins 16. Jahrhundert hinein verantwortlich zeichnete für die Blau- und Blau-Violettfärbung von Leinestoffen, ehe er durch das Indigo einer tropischen Schmetterlingsblütlerart verdrängt wurde. Bereits 1031 findet sich mit dem Eintrag von Waid im Augsburger Brückenzoll ein Indiz für den Handel und damit entsprechender Nachfrage nach besagtem Stoff.
Gelbkraut (Färberwau) konnte wiederum zur Erzeugung von Gelb- und (durch Überfärbung von Waid) Grüntönen verwendet werden; vermutlich von Vergil und Vitruv beschrieben, lassen Samenfunde auf eine erneute Verwendung in Mitteleuropa zumindest ab dem 12. Jahrhundert schließen.
Die Erzeugung von Schwarz hingegen stellte eine echte Herausforderung dar, was vemutlich eine Hauptursache dafür darstellte, dass die sogenannten Schwarzfärber als erste Spezialisten aus der großen Gruppe der Färber hervortraten.
Viele, vergleichsweise aufwendige Rezepte ergaben unterschiedliche Tönungen und Schwarzabstufungen (von denen wir manche wohl eher dunklem Grau zuordnen würden). Als eines der ältesten sei hier nur der Herstellungsvorgang des sogenannten Koptischen Schwarz angedeutet, im Zuge dessen auf naturdunkle Wolle solange Waid gefärbt wurde, bis ein bläulich schillerndes, tiefes Schwarz resultierte.
In der Fortsetzung wollen wir uns unter anderem damit befassen, wie im Zuge der Kreuzzüge und der damit einhergehenden engeren Kontakte in den östlichen Mittelmeerraum, neue Materialien und Techniken einen Aufschwung der Färbertechniken mit sich brachten ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Technologie des MA
Papier

Papier und seine Herstellung - Teil 2: Festsetzung und Ausbreitung in Europa
Zurück zum ersten Teil der Artikelserie über die Ausbreitung der Papierherstellung.
Wie im ersten Teil der Serie nachzulesen, gelangte das Papier im Zuge der Eroberungszüge des 8., 9. und 10. Jahrhunderts und den damit einhergehenden politischen Veränderungen an und über die Grenzen Europas. Aber wo sich das Wissen um seine Herstellung auf unserem Kontinent dann tatsächlich erstmalig in Form von Produktionsstandorten niedergeschlagen hat, weiß man heutzutage nicht mit Gewissheit zu sagen.
Zu unsicher, zu strittig und zu schwierig sind manche Quellen auszuwerten. Schließlich stellt das Papier das Produkt dar, auf dem die Gedanken der Philosophen und Gelehrten aufgezeichnet wird - nicht jedoch die Gründungsdaten der ersten Papiermühlen. Immerhin kann mit Sicherheit gesagt werden, dass es ausschließlich arabisches Papier ist, das im 10. Jahrhundert im gesamten Mittelmeerraum verwendet wird.

Aber Europa? Das maurische Cordoba ist bald berühmt für seine bedeutenden Bibliotheken; mit dem 10. Jahrhundert beginnend, entstehen sie und der Gebrauch von großen Mengen an Papier in dieser buchgetränkten Umgebung lässt auf das Vorhandensein von Papiermühlen in al-Andalus schließen. Und von hier ist es nicht weit zu den christlich beherrschten Königreichen Asturien und Katalonien.
Denn trotz - oder vielleicht auch gerade wegen? - der häufigen kriegerischen Auseinandersetzungen in stets wechselnden Konstellationen und Bündnissen im Rahmen der Reconquista findet stets auch ein reger Handelsausstausch und fast zwangsläufig ein damit einhergehender Wissenstransfer statt.
Christen und Juden finden sich im maurischen Teil Spaniens, arabische Bevölkerung bleibt im rückeroberten, nunmehr wieder christlichen Gebieten zurück. Und so berichtet auch eine Legende von der Herstellung von Papier in Xativa, in der Umgebung des christlichen Valencias gelegen, im Jahre 1074 - durch Araber.
1102 stellt König Roger I. besagtes Privileg zur Papierherstellung aus - allerdings lassen sich zu dieser Zeit keine Papiermühlen auf Sizilien nachweisen, während andernorts bereits äußerst innovativ mit deren Produkten umgegangen wird - man denke nur an den Einsatz von Papier im Rahmen der Brieftaubenpoststrecke zwischen Kairo und Bagdad - leicht (die fliegenden Postboten werden es zu danken gewusst haben) und vergleichsweise billig, scheint es ja für derartige Zwecke wie geschaffen ...
Die engen Handelsbeziehungen der italienischen Seefahrerstädte mit spanischen Städten, insbesondere mit Barcelona, zeigen sich nicht nur im Import großer Mengen von Papier, das von hier (ebenso wie von Katalanien aus), weiter in den Norden Europas exportiert wird, sondern führen auch dazu, dass Genua wohl mit dem Beginn des 13. Jahrhunderts ebenso eigene Papiermühlen besitzt wie die mittelitalienischen Seefahrerrepublik Amalfi, die lange schon regen Handel mit arabischen Städten betreibt; hier weiß man von deren Existenz vor 1231.
Nunmehr häufen sich die Quellenhinweise für den Gebrauch und für die Herstellung von Papier in den christlichen, am Mittelmeer gelegenen Gebieten Europas: 1231 verbietet etwa Kaiser Friedrich II., als Staufer in der Nachfolge der normannischen Könige Süditaliens, den Gebrauch von Papier für wichtige Dokumente - wohl wegen dessen geringerer Haltbarkeit im Vergleich zu Pergament.
1283 wird in Fabriano, einem im Apennin gelegen Städtchen, das sich einen Namen in der Erzeugung von hochqualitativem Papier machen wird, erstmalig die Berufsgruppe der Papierer, Hersteller von Papier also, dokumentarisch erwähnt.
In Frankreich lassen sich Dokumente auf Papier erstmalig auf etwa die Zeit um 1220 datieren; zunehmend Gebrauch findet das neuartige Material ab 1250 in südfranzösischen Notariatsakten. Wiewohl die Entstehung erster, dort einheimischer Papiermühlen bereits im 13. Jahrhundert im Languedoc und in der Auvergne anzunehmen ist, findet sich erst 1338 ein sicherer Beleg für eine solche Produktionsstätte in Troyes ...
Und die deutschsprachigen Gebiete? Wie so häufig, wenn es um den Transfer von Wissen und Methoden geht, die aus dem Osten stammen, hinken unsere Gebiete zeitmäßig zurück - ist doch der direkte Kontakt mit der arabischen Welt auf kriegerische Auseinandersetzungen in Outremer beschränkt, während Handelsbeziehungen über italienische Vermittler erfolgen.
Wie nun das Papier und das Wissen um seine Herstellung den Weg in unsere Gegenden fanden und wie sie hier mit zur großen gutenberg'schen Revolution führten, darauf mögt ihr vorerst noch ein wenig Geduld verwenden. Um euch jedoch auf das Nachfolgende besser einzustimmen, raten wir euch, jenen modernen Wischerkästchen, die heutzutage so groß in Gebrauch sind, für einige Stunden beiseite zu legen und ein Buch zur Hand zu nehmen - nur mit einem solchen lässt sich nämlich dem charakteristischen Rascheln seiner Blätter aus Papier lauschen, jenem Papier, dessen Einführung die Welt veränderte ...
Wie die frühe Technik zur Papierherstellung in den europäischen Ländern aussah, darüber könnt ihr allerdings bereits in der nächsten Fortsetzung der Artikelserie lesen.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Technologie des MA
Papier

Papier und seine Herstellung - Teil 1: Chronologie bis zur Ankunft in Europa
Eine der essentiellen menschlichen Erfindungen stellt die Schrift dar, ermöglichte sie es doch erstmalig, Gedanken und Erfahrungen über lange Epochen unverändert zu bewahren. Die Taten von Göttern, mythischen Geschlechtervätern und Heldenkönigen, die zuvor (und noch lange Zeit parallel dazu - man denke nur an unsere Märchen) mündlich überliefert wurden, konnten ebenso dauerhaft koserviert werden, wie die Lehrsätze der Philosophen und die Gebote der Glaubensgründer.
Überhaupt fusst die Entwicklung der menschlichen Zivilisationen und Hochkulturen auf der Entwicklung von Schrift- und Zahlensystemen, erlauben es doch erst derartige Systeme jene effiziente Verwaltung zu entwickeln, die es braucht, um größere menschliche Gemeinschaften mit ihrer arbeitsteiligen Organisation zu schaffen und zu lenken. Kalender, mit deren Hilfe religiöse Feiern und die mit ihnen parallel gehenden Zeitpunkte von Aussaat und Ernte einhergehen, Register der in zentralen Speichern eingelagerten Vorräte sind nur zwei Beispiele dafür. Nicht umsonst schafft sich eine jede Hochkultur ihre eigenen Schrift- und Zahlensysteme - ob das nun Ägyptens Hieroglyphen, Sumers Tontafeln oder das Linear A und B der kretischen Paläste sind.

Parallel zur Entwicklung der Schriften entwickelte sich der Bedarf nach Medien, Schriftgründen, auf denen besagte Gedanken (haltbare) Form annehmen konnten. Schon die steinzeitlichen Felszeichnungen, mehr oder weniger abstrahierte Bildnachbildungen der Realität, zeugen ja vom Bedürfnis unserer Vorfahren, Dauerhaftes zu hinterlassen. Um 12000 v. Chr finden sich dann erstmalig in Europa buchstabenähnliche Zeichen, die vielleicht schon den Ansatz zur Schriftentstehung erahnen lassen - mit Naturfarben aufgebracht auf kleinen Kieselsteinen. Wahrlich, kein sehr komfortabler Beschreibstoff ...
So wie auch andere, in den Anfangszeiten der Schriftentwicklung alleine zur Verfügungs stehende Materialien: Holz, Knochen, Rinde, Blätter, Stein - all diese physikalischen Schreibträger erschweren ob der notwendigen auswendigen Bearbeitung oder des schwierigen bis unmöglichen Transportes, wegen der geringen Haltbarkeit, oder aber der geringen 'Speicherkapazität', die sie zur Verfügung stellen, die Verbreitung der Schrift. Es galt, neue Beschreibstoffe zu finden - leicht transportierbar und in größeren Mengen verfügbar.
Tontäfelchen, die Inschriften in Keilschrift tragen, stellen eine Möglichkeit dar, die Entwicklung des Papyrus durch Flachschlagen von zerschnittenen, kreuzweise aufgelegten Schilfstengeln in Ägypten eine andere. Letztere aus schreibtechnischer Sicht bereits deutlich einfacher anzuwenden, konnten die Papyri doch mit Tinte und damit bedeutend komfortabler beschrieben werden. Somit kam der Papyrus auch in Griechenland und Rom zum Einsatz - neben anderen, dem Anlass angepassten Materialien - etwa der monumentalen Steintafel für Verlautbarungen und Siegesdenkmälern und der Wachstafel für Notizen.
Auch Pergament, also speziell vorbereitete Tierhäute lässt sich bereits seit etwa 3000 v.Chr. als Beschreibstoff nachweisen - und es wird etwa in Europa bis ins ausgehende Mittelalter hinein das dominierende Trägermaterial für bedeutsame Aufzeichnungen bleiben - und somit die Herstellung von Büchern oder auch die Erstellung von Urkunden eine teure Angelegenheit bleiben lassen, auch weil die handschriftliche Erstellung zeitaufwendig ist.
Erst die Erfindung des Papiers und die Vervollkommnung seiner (industriellen) Herstellung wird im Zusammenspiel mit der Einführung des Buchdrucks an der Situation des stets teueren bzw. nur beschränkt verfügbaren Beschreibstoffes die Situation wesentlich verändern (einige Abbildungen as der Zeit des Überganges vom Pergament zum Papier finden sich hier) - aber bis es dazu kommt, wird noch eine Menge an Jahren verstreichen. Ersteres - die Erfindung des Papiers nämlich, in der Vorform dessen, wie wir es kennen, dürfen sich die stets innovativen Chinesen auf den Hut schreiben, letzteres - die Vervollkommnung der Herstellung - wird in Europa geschehen. Dazwischen liegen aber noch eine lange Reihe von Jahrhunderten!
Offiziell wird die Erfindung des Papiers nämlich auf das Jahr 105 n.Chr. datiert und dabei dem chinesischen Minister Tsai Lun zugesprochen; allerdings war er wohl nicht der Erfinder, sondern vielmehr der, der als zuerst das Verfahren der Herstellung beschrieb, wie es wohl bereits seit der Zeitwende, vielleicht aber sogar schon zwei Jahrhunderte länger im Gebrauch war.
312 n.Chr hören wir vom Zusatz von Leimstoffen bei der Papierherstellung, um die Eigenschaften zu verbessern, und 363 war es dann endlich soweit: Mit der 'Pekinger Zeitung' erschien erstmals eine Zeitung auf Papier. 610 wird dann auch in Japan bereits Papier hergestellt - vermutlich wanderte die Technologie mit jenen buddhistischen, aus China und Korea stammenden Priestern ein, die auch die chinesische Schrift nach Nippon brachten.
Von der Wertschätzung, die man dem Stoff Papier entgegenbrachte, zeugt auch der Umstand, dass im 7.Jhdt. unter den koreanischen Tributen an China ein spezielles, aus den Kokons der Seidenraupe hergestelltes Papier zu finden war. Im selben Jahrhundert übrigends, in dem erstmals auch Papiergeld zum Einsatz kam ...
Wieder einmal war dann der Krieg, der 'Vater aller Dinge', verantwortlich für die weitere Ausbreitung einer neuartigen Technologie - infolge einer verlorenen Schlacht bei Samarkand gegen die sich ausbreitenden arabischen Heerscharen, gerieten Mitte des 8. Jahrhunderts zahlreiche Chinesen in Kriegsgefangenschaft - und spätestens mit ihnen gelangte das Wissen um die Papierherstellung in den arabischen Raum.
Im Zuge der Zerstörung des westgotischen Reiches (711) und der damit einhergehenden Eroberung Spaniens folgte den erobernden Mauren auch das Wissen um die Erzeugung des, dem christlichen Westen neuartigen Beschereibstoffes. Nach 756 wurde erstmalig Papier dem europäischen Kontinent hergestellt. Überall dort, wo es Berührungspunkten zwischen der arabisch-islamischen Welt und Europa gibt, sickert nun Wissen um neue Technologien und Materielien ein und so ist es nicht verwunderlich, dass es ausgerechnet Sizilien ist, wo nach der Eroberung durch die Normannen, die älteste christlich-europäische Papierurkunde ausgestellt wird: König Roger von Sizilien verleiht 1102 einer Papiermacherfamilie das (noch auf arabischem Papier geschriebene) Privileg zur Herstellung einer Papierwerkstatt.
Das neue Material ist in Europa angelangt - aber es wird noch dauern, bis es das Pergament tatsächlich verdrängen und die oben angesprochene 'Revolution' auslösen kann. Wie das vor sich ging, könnt ihr in in der Fortsetzung der Artikelserie lesen.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Personen und Persönlichkeiten

Walter Map - Chronist so manch (auch schaurigen) Hofgeschwätzes ...
... und just dieser Schaurigkeitsfaktor ist es, der den um 1130/35 vermutlich im walisisch-englischen Grenzgebiet (Marchia Walliae) um Hereford geborenen Walter zu einem Platz auf unserer Liste bedeutsamer Persönlichkeiten und somit zu einem Beitrag in unserer Wissensrubrik verhilft - entsinnt sich doch unsere getreue Leserschaft gewisslich der erst kürzlich gestarteten Artikelserie über Gespenster und deren -erscheinungen in der mittelalterlichen Literatur.
Doch ehe wir den Blick auf diese einzige überlieferte, mit Sicherheit von Walter stammende Prosaschrift, das besagte, in Latein verfasste 'Hofgeschwätz' (oder 'De Nugis Curialis', wie es im Originaltitel heißt) werfen, wollen wir dem Autor selbst noch einige Worte widmen:
Besagter Walter Map stammte aus vornehmer, vermutlich walisischer Familie, worauf explizit auch sein Namensanhängsel Map hinweist - belegten doch Engländer ihre walisischen Zeitgenossen gerne mit diesem Herkunftsspitznamen. Als Weltgeistlicher erhielt er seine erste Ausbildung wohl in der St. Peter' Abbey in Gloucester; anschließend studierte er - wie in der damaligen Zeit üblich - in Paris bei Gerald la Pucelle Theologie.

Ab 1162 finden wir ihn im Gefolge des Bischofs Gilbert Foliot, seit 1173 ist er am Hof Heinrichs II hauptsächlich mit juristischen Aufgaben betraut; von beiden erhält er für seine offensichtlich als gut befundenen Dienste reiche Pfründen. Er stellt somit den klassischen Höfling seiner Zeit dar, der es wohl verstand, umsichtig im königlichen beziehungsweise bischöflichen Umfeld zu agieren - und sich als solcher wohl auch die reichen Einblicke in manch Geschehnisse zu verschaffen vermochte, die ihn später zur Abfassung der 'Geschwätze' zumindest mitinspirierten.
Das er sich ein gewisses Ansehen zu verschaffen vermochte, bestätigt auch seine Teilnahme als königlicher Gesandter am 1179 stattfindenden 3. Laternakonzil, das sich mit der Waldenserfage zu befassen hat; nach eigenen Aussagen soll er dort aktiv an der Befragung des Petrus Valdes, den er als 'dumm und ungebildet' bezeichnet, beteiligt gewesen sein.
Walters Erfolgsgeschichte setzte sich fort mit der Ernennung zum Kanzler von Lincoln (1186) und zum Archediakon in Oxford (1196/97), wohingegen Versuche, ihn zum Bischof zu erheben, zweimal (1199 in Hereford und 1203 in St. Davids in Wales) scheiterten. Um 1209/10 dürfte er dann gestorben sein.
Für uns ist, wie bereits erwähnt, seine lateinisch verfasste Prosaschrift 'De Nugis Curialis' von Interesse, in der er in fünf sogenannten Distinctiones - hier Kapitel, die nach jeweils einem Prolog mehrere von der Theamtik grob verwandte Einzelgeschichten zusammenfassen - vom Leben am Hof berichtet; manches von dem, das er uns in geistreich zugespitzter Form zu sagen weiß - so warnt er in der seinerzeit sehr populären 'Epistola Valerii' vor den nicht unbeträchtlichen Gefahren des Ehelebens oder kritisiert die verschiedenen geistlichen Orden, allen voran die Zisterzienser -, verdankt er wohl dem eigenen Erleben bzw. Berichten von Zeitgenossen. Anderes darf man getrost dem Reich der Legenden und wunderbaren Volkserzählungen zuordnen.
So etwa auch die Wiedergabe der im Mittelalter sehr populären, auf antipäpstliche Agitation im Zuge des Investiturstreits zurückgehende, Legende von Gerbert d'Aurillac dem späteren Papst Sylvester II der Jahrtausendwende, dem nachgesagt wurde, seinen Aufstieg bis zum Papst einem Pakt mit einem weiblichen Dämon namens Meridiana zu verdanken - inklusive dem dem daraus resultierenden grauenvollen Ende; nebstbei sei erwähnt, das besagter Gerbert als einer der gebildetsten Menschen seiner Zeit galt, der sich sein Wissen unter anderem durch ein Studium in Katalonien aneignete - von hier aus war es wohl nur ein kleiner Gedankensprung, ihn mit Geheimwissen in Verbindung zu bringen, wie es vermeintlich in den damals maurischen Zentren Cordoba und Sevilla gelehrt wurde ...
Besonders interessant im Kontext der erwähnten Spukartikelserie erscheinen uns die vielen Geschichten über rachsüchtige Wiedergänger, die an nordische Vorbilder erinnern, über bluttrinkende und krankeitserregende Nachtzehrer (wer denkt da nicht an transsilvanische Kutschenfahrten!), über dämonischen Kindermord, über unheilige Pakte, über Ritter, die ihre verstorbenen Gattinnen dem Totenreich entführen und mit diesen 'Wiederkehrern' eine langjährige Ehe leben, aus der sogar Kinder entstehen, und über vielerlei phantastische Wesen, Nixen und Feen, die - natürlich! - aller teuflischen Ursprungs sind, die es gilt, mit reichlich Weihwasser von der Bettstatt des geblendeten Rittersmannes zu bannen.
So ist es Walter, der etwa zeitgleich mit den beiden anderen Hofklerikern William of Newburgh, der in seiner englischen Geschichte 'Historia rerum anglicarum' über einige Totenerscheinungen seiner Zeit zu berichten weiß, und Gerald of Wales das Wiedergänger- und Gespenstermotiv, die sicherlich im Volksglauben geläufig waren, verstärkt in die Literatur seiner Zeit eingebracht hat - lange bevor im 19. Jahrhundert die Vampirromantik Einzug hielt.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Redensarten
und Handwerk

Alte Redensarten: 'Und jetzt sperrt endlich einmal eure Ohren auf', ...
... donnert der eine oder andere Pädagoge schon mal gerne ins Klassenzimmer hinein, wenn seine geliebten Zöglinge, allesamt noch nicht gänzlich trocken hinter den Ohren, anstatt den gelehrten Ausführungen über spitzfindige platonische Dialoge oder der Herleitung packender mathematischer Beweise zu folgen, sich wieder einmal lieber mit dem externen Gehirnersatz unter der Schulbank beschäftigen. Dürfte er, der gute Lehrersmann, wie er möchte, wollte er ihnen den ja am liebsten um die Ohren hauen! Und derart nachweisen, wie schädlich zuviel Digitalisierung sein kann. Aber leider, noch sind die Winzigdisplays nicht stoßfest genug.
'Welche Zeiten, welche Sitten!', möchte man da fast rufen, 'welche Jugend!' Wie sollte man bloß derartig tauben Ohren predigen können? Wenn überhaupt, bekommt man höchstens noch ein mehr oder minder freundliches 'Ach Magister, blas mir doch die Ohren nicht so voll (.. was frei übersetzt etwa 'Hey Alter, hör auf mich so öd' anzulabern!' bedeuten mag.) Früher, ja früher, da war - gewisslich! - alles viel besser!

Doch ach, ganz so gewiss sollten wir uns auch in dieser Annahme nicht sein, müssen wir doch bereits aus antiker Überlieferung ähnlich geartete Klagen um die Sitten der Jugend vernehmen! Und auch in den folgen Jahrhunderten scheint sich dieser bedenkliche Umstand nicht wesentlich gebessert zu haben. Doch nicht nur Jugendlichen, auch Erwachsenen, ja allen als belehrungswürdig Erachteten scheint eine gewisse Unaufmerksamkeit zu allen Zeiten durchaus eigen gewesen zu sein.
Und wenn ein solches Publikum schon einmal aufmerkt, dann scheint das, in so guter Absicht Dozierte zum einen Ohr hinein und flugs zum anderen wieder hinaus zu gehen, just so, als ob es im Inneren des Schädels nichts gäbe, das den raschen Durchfluss hemmen könnte. So klagt denn Wirnt von Gravenbergs, offensichtlich leidgeprüft, im Prolog des Wigalois ebenfalls:
'...
swaz den von mir wirt geseit,
daz ruofte ich gerner in einen walt
...
er lât ez durch diu ôren gar
zem einen în, zem andern ûz.
...'
Wie also dafür sorgen, dass die Zuhörerschaft sich hinter die Ohren schreibt, was sie sich gefälligst zu verinnerlichen hat? Alte Pädagokik fällt einem da ein; bewährte, einfühlsame Methoden, die dereinst dafür sorgten, dass Jüngelchen sich mit Gewissheit merkten, was nicht vergessen werden durfte. Denn, so sagt uns sogar moderne Lerntheorie, was an Lern- und Erinnerungsstoff mit äußeren Reizen und Ereignissen verknüpft wird, dessen entsinnen wir uns auch in fernerer Zukunft!
Das wussten auch die Alten. Und so zog man zum Abschluss von Verträgen, bei der Festsetzung von Grenzsteinen und dergleichen Erinnernswertem mehr, Zeugen heran, nicht selten Knaben (letztere vielleicht deshalb so gerne, weil sie in ihrem jugendlichen Alter noch nicht dieser Vergessenheitskrankheit anheimfallen, deren Name sich der Autor dieser Zeilen gerade nicht entsinnen kann).
Jene unterstützte man im Abspeichern der Informationen häufig dadurch, dass man sie an jedem dieser merkenswerten 'Erinnerungspunkte' an den Ohren zwickte oder zog und sogar noch (sozusagen als abschließende Brennanweisung) ohrfeigte. Sehr einprägsam scheint uns dies in der (bösen) Tat zu sein - was aber wohl die moderne Schulpsychologie dazu sagt?
Lasst euch aber nicht übers Ohren hauen von jenen, die euch einzureden versuchen, Wissen wäre das Wichtigste, das ihr euch erwerben könnt! Denn viel wichtiger scheint es wohl gut fechten zu können. Andernfalls könnte es euch Besserwissern geschehen, dass euch einer der Beratungsresidenten das Langschwert - genau! - übers Ohr haut. Von dorther rührt nämlich die erwähnte Redensart.
Es gäbe noch viel zu sagen übers Ohr. Viel zu viel, um es hier, in einem Artikel zu fassen. Über manch vernünftigen, manch äußerst verfolgsersprechenden und auch manch wenig appetitlichen, doch sehr erfolgsversprechenden Liebeszauber! Darauf, meine lieben, allzu Ungeduldigen, müssen wir euch noch auf spätere Zeit vertrösten.
Nur eines noch, zum Abschluss - denn es scheint uns wichtig zu sein: Wenn euch das Ohr mit einem Male unangenehm zu klingen und zu dröhnen beginnt, dann nehmt die beiden kleinen Stöpseln heraus. Wenn's immer noch summt und dies auch nicht die beruhigende Stimme eures Magisters ist, die von vorne, vom Pult her, ihre beruhigende Wirkung verströmt, sondern wenn dies Summen aus dem Inneren eures Kopfes stammt, dann, ja dann spricht man andernorts über euch.
Klingt das rechte Ohr, dann ist's gut! Denn dann berichtet man sich gerade Gutes über euch. Denkt der Reihe nach an alle euren Bekannten - und bei wessen Namen das Geräusch verschwindet, der- oder diejenige ist's, die euch hold ist. Wenn's aber links lärmt, dann zupft schlagt euch recht kräftig gegen diese Ohr; dann beißt sich nämlich der Verleumder (schließlich kann ja nur Verleumdung sein, wenn über euch schlecht geredet wird!) in die Zunge. Recht ist's dem oder den Bösewichtern geschehen! Oder aber, ihr bestreicht euer Ohrläppchen mit ... aber nein, das wollen wir euch jetzt doch nicht verraten ob der unappetitlichen Nebenwirkungen ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Technologie des MA
Eisen

Metallbearbeitung im Mittelalter - Teil 2: Eisenvorkommen und -abbau im Frühmittelalter
Zurück zum ersten Teil der Artikelserie.
Werfen wir jetzt einen kurzen Blick auf die Gewinnung des Roherzes. Bergbau, speziell der Abbau von metallhaltigen Erzen und da wiederum der Abbau von Eisenerz, war ja nun keine Errungenschaft, die erst aus der römischen Antike stammte. Tatsächlich dürften bereits unsere steinzeitlichen Vorfahren regelmäßige 'Expiditionen' zu ihnen bekannten Obsidian- und Feuersteinfundstellen ausgesendet haben, deren Aufgabe es war, genügend Rohmaterialien für die Fertigung der so dringend benötigten Jagdwaffen und Werkzeuge zu beschaffen.
Mit der Bronzezeit setzte, von lokalen Zentren ausstrahlend und über mehrerer Jahrhunderte unterschiedlich ausgreifend, großflächig die Verarbeitung von Metallen ein. Damit einhergehend entsteht der Bedarf nach geeigneten Fundstellen und Methoden, diese auszubeuten. Wir hören von Nubiens Gold, von Zyperns Kupfer und von Britanniens Blei- und Zinnminen (... übrigens weist die bei uns geläufige Bezeichnung Mine zurück auf einen keltischen Ursprung, der soviel wie 'rohes Metall' meint und uns somit bereits einen Hineis darauf gibt, dass die Kelten hinsichtlich der Eisenverarbeitung durchaus als Lehrmeister der Römer gelten können ...), von Athens berühmten Silber aus Laurion, den thrakischen Goldbergwerken.

In Zypern fand sich zudem Eisen; ebenso in den armenischen Bergen. Und die Römer könnten erst nach Eroberung der etruskischen Gebiete und, diesen vorgelagert, Elbas und Sardiniens Fundstellen ihr eigen nennen. Überhaupt stellten damals (wie heute auch) Bodenschätze nicht selten einene erheblichen Anreiz für Eroberungszüge dar. So konnten eben die Römer nach der Eroberung Galliens bzw. der Annexion Noricums nicht nur von den in jenen Gebieten liegenden Schürfplätzen, sondern auch vom hohen Stand der dortigen Metallverarbeitung profitieren. Und nicht zuletzt waren es Spaniens Bodenschätze, die sowohl Karthagos als auch Roms Begehrlichkeiten weckten ...
Auch in den Alpen gab (und gibt) es zahlreiche Mineralvorkommen - die jedoch oft von verhältnismäßig schlechter Qualität waren. Hingegen wird das berühmte norische Eisen in den römischen Quellen ausdrücklich gelobt. Speziell im Umkreis des Kärntner Feldkirchens scheint ein bedeutendes Zentrum der römischen Eisenverarbeitung gewesen zu sein, wobei dort hauptsächlich Sumpferz aus dem mittleren Burgenland (welches in der La Tène das Zentrum der ostalpinen Eisengewinnung und -verarbeitung darstellte) zur Verarbeitung gekommen sein dürfte; immerhin sind in der näheren Umgebung Feldkirchens keine geologischen Fundstellen bekannt.
Ein weiteres bedeutendes Zentrum für die norische Eisenproduktion lag an der Stelle des heutigen Semlachs; dort wurde von Archäologen ein rund 30000m2 Industrieareal ergraben, das zumindest vom 1.Jhdt.v.Chr. bis zum 4.Jhdt.n.Chr. Eisenwaren produzierte.
În den folgenden Umbruchszeiten werden schriftliche Quellen seltener, wenn sie nicht gänzlich versiegen. Eindeutig lässt sich die Fortführug römischen Bergbaus nur im fränkischen Reich in den dortigen Abgabenlisten beweisen. Andernorts sind wir auf (zukünftige) Funde der Feldforschung angewiesen, wollen wir zuverlässige Aussagen über das Schicksal vormaliger Verarbeitungszentren treffen. Da jedoch der Bedarf nach Eisenwerkzeugen und - waffen weiterhin hoch blieb (siehe hier), dürfen wir vielleicht annehmen, dass viele dieser 'Industriegebiete' weiterhin produzierten. Wenn auch vielleicht in verringertem Umfang, vielleicht unter geänderten Rahmenbedingungen ...
(Ein Argument, das obige Annahme zumindest im Ostalpenraum stützt, liegt darin, dass in den Quellen, die mit dem 12. Jahrhundert wieder häufiger fließen, für ausgewiesene Berbauorte nicht selten slawische, dem Erz verbundene Namen verwendet werden, Namen also, die auf die Erzgewinnung in früheren Jahrhunderten hinweisen.)
Anderswo entstanden mit dem Auftreten bislang unbekannter Fundstellen vielleicht neue Eisenhüttenreviere. Neben jenen im Kärntner Lavanttal wissen wir etwa von solchen im bayrischen Alpenvorland, im Graubünden, bei Brescia, in Schwaben und Vorarlberg, in der Oberpfalz, von deren Eisenreichtum die bereits früher angesprochene Emeram-Vita aus dem späten 8. Jhdt. zu berichten weiß, und ....
Technisch bedingt, wurden bevorzugt Oberflächeneisenerze mit einem Eisengehalt von über 40% abgebaut, etwa in den feuchten Niederungen des nördlichen Mitteleuropas oder als Sumpferz. Zudem wurde einfacher Tagebau betrieben. Dazu wurden glockenförmige Gruben mit bis zu 12m Tiefe angelegt. (So konnten beispielsweise auf dem Dachsberg bei Augsburg rund 6000 derartige Eisenerzgruben festgestellt werden, die dort bis ins Hochmittelalter ins Gestein geschlagen worden waren.) Der Schachtbau, also das Anlegen von Stollen ins Innere der Berge, soll im größeren Umfang erst im 13. Jahrhundert aufgekommen sein (obwohl sich diese Technik bereits bei der weiter oben angesprochenen steinzeitlichen Feuersteingewinnung nachweisen lässt!)
Wie der Erzabbau in jenen quellenarmen Epochen organisiert war, wer für den Abbau verantwortlich war und wer davon profitierte, wissen wir nicht mit Sicherheit zu sagen. Vermutlich dürfte der Abbau auf Privatinitiative erfolgt sein, verbunden mit einer verpflichtenden Abgabe an die Herrschaft. Nun, auch wir Heutigen kennen dieses Abgabensystem unter dem Namen Steuer ja nur allzugut, damit würde uns derartiged nicht verwundern ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Technologie des MA
Eisen

Metallbearbeitung im Mittelalter - Teil 1: Eisenmangel im Frühmittelalter?
Der große Umbruch, den der Untergang des weströmischen Imperiums darstellte, der Übergang von der Spätantike über die Völkerwanderungszeit und die Expansion des Islam hin zum frühen Mittelalter, bedeuteten für große Teile Europas einen immensen Verlust an Wissen und Kenntnissen. Gleichbedeutend mit einem technologischen Zeitsprung des nun zunehmend christlicheren Abendlandes um Jahrhunderte zurück.
Speziell habe dies den Rückfall in ein eisenarmes, ja in manchen Gebieten in ein eisenloses Zeitalter bedeutet und, bedingt durch diesen Umstand, in eine jahrhunderte währende Stagnation auf technologischem und folgerichtig wirtschaftlichen Bereich; schließlich setze wirtschaftlicher Aufschwung die entsprechenden Werkzeuge und Hilfsmittel voraus, die infolge Eisenmangels eben nicht vorhanden gewesen wären ...

Derartige Meinungen finden sich zumindest in der Literatur. Wer Kathedralen bauen, auf seetüchtigen Schiffen die Welt erkunden und erobern, wer neue, ertragreichere Verfahren in Landwirtschaft, Produktion und Handel einführen will, wer Mühlen betreiben und wirksamere Pflüge einsetzen will, der benötige schließlich jede Menge Eisen und Stahl ...
Die traditionelle Geschichtsschreibung sieht die 'industrielle Revolution' des Hochmittelalters mit Eisenproduktion einsetzen, die der Zisterzienserorden im Zuge der Rodung und Urbarmachung der großen Wälder forcierte und der damit zugleich effizientere Produktionsmethoden in der Landwirtschaft initiierte.
Aber war es wirklich so? Stellten sich große Abschnitte speziell jenseits der Alpen tatsächlich als ausschließlich von in Holzhütten hausenden und mit hölzernene Werkzeugen werkenden Hinterwäldlern (schwach) bevölkerte Gebiete dar? Tatsächlich sprechen archäologische Befunde, die sich auf systematische großflächige Untersuchungen - etwa in der Normandie, in Schleswig-Holstein oder auch skandinavischen Gebieten- stützen können, eine andere Sprache. Schließlich hinterlassen Eisen und Stahl - anders als in vielen Fällen Holz und Stoffe - bleibende Spuren.
Diese Bodenfunde aus Ansiedlungen und Gräbern zeigen einen nahtlosen Übergang von der älteren Eisenzeit ins frühe Mittelalter und belegen somit nachhaltig, dass in Mitteleuropa jener Epoche Siedlungen, für die keine Eisenverarbeitung nachweisbar ist, die absolute Ausnahme darstellen.
Auch die anhaltende Binnenrodung, die vor allem nördlich der Alpen mit dem Wechsel vom 6. ins 7. Jahrhundert verstärkt einsetzte - und mit der schon damals eine Vervielfachung von Siedlungen, Klöstern und Kirchen einherging - und nie mehr gänzlich abbrach, lässt, aufgrund der für diese Tätigkeit benötigten Werkzeuge wie Beile und Haueisen, auf eine entwickelte und weitverbreitete Eisenindustrie schließen. Ebenso die Verwendung von Getreidemühlen und Räderpflug.
Und weiß nicht der Mönch Notker von St. Gallen, in seiner, im späten 9. Jahrhundert verfassten (wenn auch unvollendet gebliebenen) Lebensbeschreibung Karls des Großen von der Macht und Stärke der vor Eisen starrenden fränkischen Truppen zu berichten? Wir werden übrigens noch sehen, dass es nicht zuletzt die Klöster waren, die zu dieser beeindruckenden Ausrüstung mit Waffen beitrugen ...
789 erließ Karl zudem wieder einmal 'Allgemeine Ermahnungen', die dazu gedacht waren, den Untertanen seines riesigen Reiches, die zum Teil noch dem Heidentum nahestanden, rechtes christliches Verhalten 'nahezulegen'. Darin ausgesprochen wurde ein dezidiertes Sonntagsarbeitsverbot, dass unter anderem untersagte, '... in den Wäldern zu roden oder Bäume zu fällen oder Steine zu bearbeiten ...', Tätigkeiten also, die nur bei weitverbreiteter Verfügbarkeit von Eisengeräten denkbar sind.
Bergwerk- und Eisenhüttenreviere, die schon im Altertum der Metallgewinnung dienten, bestanden über die Stürme der Völkerwanderungen nachweislich fort, dazu entstanden neue. In England findet sich bereits im 8. Jahrhundert eine spezialisierte Messerindustrie, St. Gallener Urkunden des 9 Jahrhunderts erwähnen Eisen und Eisenbarren als bevorzugten Geldersatz für Abgaben ...
Natürlich bleibt Eisen speziell im Frühmittelalter ein besonders wertvoller Rohstoff. So wurden abgenutzte Werkzeuge nicht etwa weggeworfen und durch neue ersetzt, sondern bis zum absoluten Verschleiß umgeschmiedet und sogar bis ins 12. Jahrhundert hinein waren in Venedig eiserne Schiffsanker Gegenstand von Mietverträgen, an denen jeweils mehrere Kaufleute teilhatten. Ob man hingegen die Bedeutung des Schwertes, die sich unter anderem im über Generationen währenden Vererben innerhalb der Adelsfamilie offenbarte, nicht eher dem sakralen Charakter dieser speziellen Waffe zuschreiben sollte denn dem reinen Wert seines Materials, muss dahingestellt bleiben ...
Wo aber lagen die Lagerstätten für das Roherz und wie wurde es in diesen unruhigen Zeiten abgebaut? Wie wurde es verhüttet? Wie gehandelt? Diesen Fragen widmen sich die folgenden Teile dieser Artikelserie; auf die mögt ihr an dieser Stelle vertröstet ...
... oder an dieser Stelle verwiesen sein: Hier geht's weiter zum zweiten Teil der Artikelserie.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Redensarten
und Handwerk

Alte Redensarten: Alle unter einen Hut zu bringen, ...
... ist, das sei gleich vorweg betont, nahezu ein Ding der Unmöglichkeit; so wie es nahezu ein Ding der Unmöglichkeit ist, in einem kurzen Beitrag alle Redensarten anzuführen, welche sich um die menschliche Kopfbedeckung gebildet haben - es sind schlichtweg ihrer zu viele! Das mag uns aber immerhin ein sicheres Anzeichen dafür sein, wie wichtig der Hut dem Menschen im Laufe vergangener Zeitalter gewesen ist.
Doch sollten wir uns bei einer solchen Rückbetrachtung davor hüten, besagte Kopfbedeckung zuallererst als Kleidungsteil zu betrachten, dessen Aufgabe es an erster Stelle ist, uns Schutz vor Sonne und Regen zu gewähren, unsere Köpfe gleichsam in behütende Obhut zu nehmen. Dies war über lange Epochen hinweg nicht der vorrangige Zweck des Hutes.

Hut, Obhut und behüten - Zeit, einen etymologischen Blick zurück zu tun: Alt- und mittelhochdeutsch schreibt sich die Kopfbedeckung wenig überraschend huot; das altsächsische und -englische hod wird zum bekannten englischen hood, allerdings mit abgewandelter Bedeutung 'Kapuze', während hat (aus altengl hætt) unserem Hut (also der steifen Kopfbedeckung mit umlaufender Krempe) entspricht.
Das althochdeutsche houta steht dagegen für 'Bewachung', und erweitert sich mit dem mittelhochdeutschen hout(e) zu den Bedeutungen 'Bewachung, Wächter, Hinterhalt, Schutz' und 'Fürsorge', (was uns unmittelbar zur heute noch gebräuchlichen Obhut und zum Behüten führt, aber auch die Aufgabe einer militärischen 'Nachhut' erklärt). Zurückführen lassen sich all diese Variationen vermutlich auf einen indoeuropäische Wurzel mit der Bedeutung 'schützende Bedeckung'.
Kulturgeschichtlich bedeutsamer denn die Bedeutung als gemeines Bekleidungsteil (ausschließlich zum Schutz vor Sonne und allen Arten von Witterung) sind andere Funktionen. Seine Form, die Art wie er getragen wurde, ja der Umstand, wer denn nun überhaupt zum Tragen eines Hutes berechtigt war, verrieten dereinst viel über seinen Träger - über dessen soziale Stellung, das Amt, das er ausübte, sein Alter und das Geschlecht, seine Religionszugehörigkeit, ja vielleicht sogar etwas über die momentane Stimmungslage ('Keck sitzt ihm das Hütlein am Kopf, die Feder wippt im Wind ...'). Der Hut steht als Symbol stellvertretend für seinen Träger und dessen Position in der Gesellschaft und wer sich anmaßt, einen Hut zu tragen, der nicht auf einen solchen Kopf gehört, der muss gegenwärtig sein eins auf den Hut zu kriegen.
Oftmals symbolisiert der Hut einen Herrschaftsträger - Päpste, Bischöfe, Könige, Fürsten, Adelige, sie tragen Hüte, aber auch schon die ägyptischen Pharaonen - oder den freien Mann, während der Knecht einer solchen Kopfbedeckung entbehren muss. Den Hut vor jemanden ziehen, meint dann ursprünglich auch die ehrerbietige Zurschaustellung der Huldigung im Lehenswese durch den Lehensmann. Nur der besitzt das besondere Vorrecht, seine Kopfbedeckung vor dem Herrn aufzubehalten, den seine Stellung und die Gunst des Fürsten dazu berechtigen.
Ab wann aber besteht dieser Brauch des Hutziehens in unseren Breiten? Nun, gar so alt scheint er nicht zu sein, findet sich doch der älteste Beleg im Deutschen erst im hohen Mittelalter, im Wigalois nämlich, des Wirnt von Gravenbergs Artusroman, der vermutlich knapp nach 1200 entstanden ist. Dort (5/1435ff) lesen wir
'...
und als er im sô nâhen kam,
sînen huot er abe nam;
hie mit êret er in alsô
der juncherre gruozte in do
und vrâget in der mære
wes garzûn er wære.
...'
Wir hören also von der Begegnung eines Pagen oder auch Edelknabens (garzûn) mit dem sozial höher stehenden juncherre Wigalois; wie es die Rangordnung vorschreibt, lüftet der Knabe zuerst grüßenderweise seine Kopfbedeckung, sein Gruß wird erwidert, anschließend beginnt Wigalois das Gespräch, indem er Informationen einzuholen versucht.
Später wird sich dieses höflichkeitsbezeugende Verhalten soweit ändern, dass sich nun auch Gleich mit Gleich in dieser Art begrüßt, dass es die Höflichkeit gebietet, den Hut zu ziehen, wenn man geschlossene Räume betritt, aber - selbstverständlich! - auch vor den Damen. Jene erwidern mit einem Nicken; ihre vielfältigen und nicht selten sehr kreativen und phantasievollen Kopfbedeckungen (man denke nur an die alljährlichen Pferderennen in Ascot, dem berühmtesten Hutauflauf der Welt, wo die Gäule in der öffentlichen Wahrnehmung hinter den stolz präsentierten Damenhüten bestenfalls an zweiter, wenngleich auch weit abgeschlagener Stelle kommen!) dürfen am Platz bleiben; andernfalls die Frisur zu sehr darunter leiden müsste!
Potzblitz, wird da mancher unter unseren Lesern rufen, und wo bleibt da die Gleichberechtigung? Solch Ungerechtigkeit geht nun wirklich über keine Hutschnur mehr! Womit wir wieder bei den Redewendungen angelangt wären. Welchen Ursprungs die letztere ist, können wir allerdings nicht mit Sicherheit vermelden. Allenfalls mag eine Urkunde aus dem Jahr 1356 Licht ins behütete Dunkel bringen, darin nämlich die Hutschnur als Maß für die zulässige Stärke des abzuleitenden Wasserstrahls für einen Quellmitbenutzer angeführt wird ...
Die einen glauben's, die anderen murmeln 'Unsinn!' bei solch einer Deutung. So ist es eben; selten lassen sich alle Meinungen unter einen Hut bringen; letztere Wendung deutet wiederum darauf hin, wie eigentlich der Hut für die Person steht, welche ihn trägt - alles unter einen Hut bringen, bekommt dann eben die Bedeutung einer gemeinsamen Meinungsfindung wie wir sie kennen.
Und wenn es wieder einmal nicht gelingt obgenannten Kompromiss zu finden? Wenn nicht alle ihren Hut nach dem Wind rücken, sondern eigensinnig ihre Meinung vertreten. Dann kann es gut sein, dass der Eine oder Andere eine auf den Hut gespuckt oder alternativ eine auf die Mütze bekommt, selbst dann, wenn er derartiges gar nicht trägt. Vor dem, der einen solchen Streit, wenn er erst einmal richtig in Gang gekommen ist, klug zu schlichten versteht, sollten wir alle den Hut ziehen. Vielfach erntet aber ein solcher Vermittler in der aufgeheizten Simmung eines derartigen gastwirtschaftlichen Mikrokosmos kein Gehör mehr, allenfalls noch den guten Rat, sich seine Tipps doch auf den Hut zu stecken!
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Personen und Persönlichkeiten

Rustichello da Pisa - bloß der Ghostwriter des Messer Marco Polo?
'... Später, im Jahre 1298 nach Christi Geburt, als er zusammen mit Messer Rusticiaus von Pisa im selben Gefängnis zu Genua inhaftiert war, bat er diesen, alles aufzuschreiben, was er ihm erzähle ...'
(Ausschnitt aus dem ersten Kapitel des 'Il milione', der Reisebeschreibung des Marcpo Polo)
Für gewöhnlich neigen wir dazu, alles was mit Aggressionen zu tun hat, mit bewaffneter Auseinandersetzung und Fehde, mit großen kriegerischen Begegnungen, von denen ja das vergangene Jahrhundert und das eben erst angebrochene Jahrtausend ein genauso bedrückendes Lied zu singen verstehen wie die Zeiten davor, als zutiefst negativ zu empfinden - und das, wer würde dem widersprechen!, völlig zurecht! Manchmal jedoch ...
... manches Mal jedoch, erstehen gerade aus solch betrüblichen Geschichtsereignissen Umstände, aus denen Bleibendes erblüht, das wir heutzutage nicht missen möchten. Und dabei müssen wir gar nicht einmal an die Siegesdenkmäler der so verschiedenen und sich in ihren Gesten doch so ähnelnden Herrscher aller Völker und Zeiten denken, an die Darstellung gebeugter Nacken unter den Sandalen des triumphierenden Gottpharaos, an die zahllosen Triumphbögen und in Stein gemeisselten Jubelinschriften. Manch Entdeckungsfahrt mit dem Wunsch, Profite zu vergrößern, manch Eroberungszug brachte schließlich auch Neuerungen ins Heimatland ...

Manches Mal bringen die verworrenen Umstände und verwirrten Zeiten Menschen zusammen, die sich unter anderen Begebenheiten wohl nie begegnet wären. Wie solche zufälligen Begegnungen etwas hervorbringen können, dessen wir keinesfalls entbehren möchten, zeigt eine Episode aus dem späten 13. Jahrhundert. Eine Zeit der Um- und Aufbrüche, der Kreuzzüge und der erlöschenden lateinischen Staaten Outremer.
Im gesamten Mittelmeer streiten die italienischen Seehandelsstädte mit wechselndem Glück um die Nachfolge des längst ermatteten byzantinischen Kaiserreichs; Seeschlachten und Blockaden, es wird um Stützpunkte gerungen, um Kontore, Handelsrouten und befestigte Punkte. Mitten in diesem Geschehen die üblichen Verdächtigen: La Serenissima - Venedig! Genua, die ewige Konkurrentin, Pisa ..
Wer ein echter Handelsherr ist, der hat sich an den Auseinandersetzungen zu beteiligen, so wie Marco, der Spross der venezianischen Familie Emilione, die ihr beträchtliches Vermögen nicht zuletzt dem Handel mit Edelsteinen und beträchtlichem Wagemut zu verdanken hat. Marco Polo, um den es sich hierbei handelt, rüstet zum Kriegszweck eine Galeere aus - und wird, nach einer Niederlage gegen die verfeindeten Genuesen, prompt gefangengenommen (geschah die 1296 vor Anatolien oder, wie häufig vermutet, erst 1298 in der Schlacht von Kurzola, vor dem heutigen Dalmatien?) ...
Ist schon das Überleben in einer solchen Situation als glücklicher Umstand zu werten (auch wenn wir nicht vergessen dürfen, dass ein Kriegsgefangener aus vermögender Familie stets ein ausgezeichnetes Faustpfand darstellte - für die Erpressung von Lösegeld, für den Austauschvon Geißeln, als Argument in Friedensverhandlungen - und diese Tatsache den Blutdurst der streitenden Parteien bedeutenden Persönlichkeiten gegenüber beträchtlich dämpfte), so ist die Inhaftierung in einem Kerker, in dem zugleich (und wohl schon länger) ein pisanischer Kriegsgefangener schmachtet, der zugleich literarische Vergangenheit besaß, fast als Wink des Schicksals zu verstehen.
Was sollten auch zwei Kriegsgefangene sich die Zeit viel anders vertreiben als der eine die Erlebnisse seiner siebzehn Jahre währenden Reise ins sagenhafte China zu diktieren und der andere, der Literat, diese Erlebnisse aufzuzeichnen. Was, fragen wir uns, wäre aus den Erinnerungen des Marco Polo sonst geworden? Wie viele Menschen wären seitdem um die Erlebnisse und Berichte des berühmten Venezianers gekommen?
Aber, so fragen wir uns auch - wieviel Anteil an der resultierenden Niederschrift (die im Original nicht erhalten ist) hat der aufzeichnende Schriftsteller? Jener Rusticiaus oder auch Rustichello da Pisa. Und was wissen wir überhaupt über ihn? Übt er sich in dieser Zusammenarbeit nur als Notar (der er nach manchen Spekulationen wirklich gewesen sein könnte), der die Worte des diktierenden Venezianers exakt zu Papier bringt? Oder doch der Ghostwriter, der die erzählten Erinnerungen in ihm geeignet sccheinende Form bringt, sie mit eigenem Wissen und stilistisch gebräuchlichen Formen seiner Zeit ergänzt und dramatisiert?
Wir müssen gestehen, wir wissen nicht allzuviel von dieser schreibenden Hand, die uns so viel Staunenswertes erhielt. Immerhin vermuten wir, dass es sich bei ihm, um denselben Rusticiano von Pisa handelt, der irgendwann um 1275 eine aus verschiedensten Quellen nachgedichtete Kompilation des Artusstoffes verfasste, die Eduard I. von England gewidmet ist. Vielleicht erlernte Rusticiano auf früheren Reisen nach Frankreich und England das Französisch, in dem er dieses Livre du roy Meliadus verfasste, vielleicht begleitete er den späteren englischen König 1270-1272 auch auf dessem Kreuzzug ins Heilige Land ... Dann hatte er jedenfalls das Pech, bei einer der Auseinandersetzungen zwischen Genua und dem schlussendlich unterliegenden Pisa in Kriegsgefangenschaft zu geraten (möglicherweise bereits 1284 im Gefolge der Seeschlacht von Meloria).
Jedenfalls gilt Rustichello als erster Italiener, der den Artusstoff verschriftlichte - wenn auch, wie bereits gesagt, in altem Französisch. Aber auch das 'Il milione' oder, wie es auch benannt wurde das Livre des Merveilles du Monde (Buch der Wunder dieser Welt) wurde in einem, mit vielen italienischen Begriffen verstetzten, Französisch, wie es als allgemeine Verkehrssprache zu jener Zeit in der gesamten Levante gebräuchlich und wohl auch einem dort tätigen Kaufmann verständlich war, aufgezeichnet.
Seit 1284 eingekerkert! Wie froh muss er 1298 gewesen sein, mit der Aufzeichnung der Reiseerinnerungen seines Mithäftlings endlich wieder etwas zu tun zu bekommen! Wie aber ist der jeweilige Beitrag der beiden 'Koautoren' zu denken? Als wahrscheinlich dürfen wir annehmen, dass Marco Polo das Wissen über Reiseabschnitte, Organisationsformen und Verwaltung, grob über Land und Leute beisteuerte, das meiste wohl aus dem Gedächtnis, samt erlebter Anekdoten. Rustichello wiederum brachte das Gehörte zu Papier - wohl kaum wortwörtlich, finden wir doch an passender Stelle Verweise auf die Erlebnisse Alexanders oder auch Vergleiche mit der Hofhaltung westlicher Fürsten; ebenso vermuten hinter der Ausgestaltung der Schlachtszenen eher den auf starke Wirkung bedachten Schriftsteller, denn den nüchternen, so sehr auf nützliche Aspekte des täglichen Umgangs interessierten Kaufmann ...
Marco wurde bekanntlicherweise im August 1299 aus seiner Haft entlassen und erfreute sich noch fünfundzwanzig anschließender, von Wohlhaben, einer Ehefrau und drei Töchtern begleiteter Lebensjahre. Über den weiteren Verbleib des Rustichello ist hingegen nichts bekannt. Wurde er ebenso aus der Haft entlassen? Oder ist er in Genuas Kerkern verstorben? Jedenfalls sind uns keine ihm zuschreibbaren Werke nach dieser Zeit mehr bekannt ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Alte Maße

Alte Maße - Gewichte, Rezepturen und das Auswägen von Verhältnissen
Eine Gesellschaft, in der Handel betrieben wird, benötigt Gewichte und Vergleichsgrößen. So auch die mittelalterliche: Märkte, Zoll und Münze verlangen nach sicheren Möglichkeiten, Mengen und damit Gewichte zu bestimmen.
(Wiewohl man von 'einer' mittelalterlichen Gesellschaft mit gutem Gewissen nicht sprechen kann; zu lang währt der Zeitraum, zu groß sind die lokalen Unterschiede, zu bedeutsam auch die Entwicklungen, die in jener Zeitspanne stattfanden.)
Zur Gewichtsbestimmung dient bekanntlich die Waage. Speziell in Zeiten, in denen die Geldwirtschaft schwach ausgeprägt oder ganz zum Erliegen gekommen ist, wie dies in vielen Teilen Europas nach dem Zusammenbruch des römischen Westens der Fall war, besteht der Bedarf nach Feingewichtswaagen, um darauf kleine Mengen von Edelmetall (Gold) hinreichend genau zu wägen. Im Detail gleichen die (früh-)mittelalterlichen Waagen den römischen Ausführungen, wenn sie auch deren Genauigkeit schwerlich erreicht haben .

Die Verwendung legierter Silbermünzen brachte die Verdrängung solcher Feinwaagen durch größere Silberwaagen für genormte Gewichte (sogenannte Schnellwagen, wie sie auch für wertvolle Handelsgüter zum Einsatz kamen, die auf ein bestimmtes Vergleichsgewicht ausgelegt waren). Erst mit dem Wiedereinsetzen von Goldprägungen im Aufbruch zum 14. Jahrhundert, sollten die Feinwaagen wieder an Bedeutung gewinnen. Mit der Änderung der Handelspraktiken wiederum, der Einrichtung von Kontoren und städtischen Warenhäusern, änderten sich auch die Wägepraktiken im Handel insgesamt.
In diesen Warenhäusern standen nun eine Reihe von (nach örtlichen Gegebenheiten) genormten Vergleichsgewichtern unterschiedlicher Größenordnungen (sogenannten Blockgewichten) bereit, die den Einsatz von variableren, meist gleicharmigen Balkenwaagen ermöglichten. Dass stets Bedarf an solchen verläßlichen Vergleichsmaßen bestand, verdeutlichen auch die vielen mittelalterlichen Abbildungen, die darstellen, was Betrüger zu erwarten haben, die mit falschen Gewichten Gewinn zu machen suchen.
Die (gleicharmige) Balkenwaage und das Prinzip der Wägung mittels bekannter Vergleichsgrößen waren also während des gesamten Mittelalters stets bekannt. Oftmals jedoch fehlte es an den verlässlichen Vergleichsgewichten. Auch waren diese, wegen unterschiedlicher Maßsysteme, stets nur lokal begrenzt verwendbar. So verwundert es uns dann auch nicht, wenn wir in der 'De diversis artibus', dem Werk des Theophilus Presbyter über das Kunsthandwerk seiner Zeit (Wende 11/12. Jahrhundert), folgende Beschreibung zur Herstellung von Glockenbronze lesen:
'... quatuor partes sint cupri et quinta stagni ...'
('... vier Teile aus Kupfer, der fünfte aus Zinn ...')
Oder auch, zur Herstellung von Füllmasse aus Ziegelmehl und Salz für ein Zementierverfahren:
'... pondera in duas partes aequales et adde ei tertiam partem salis eodem pondere ...'
('... wäge es in zwei gleiche Teile und füge einen dritten Teil Salz von gleichem Gewicht zu ...')
Sicherlich ist es hier, in einer Schrift, welche Kunsthandwerk auf praktische Weise zu vermitteln versucht, sinnvoll, Verhältnisse bei den einzelnen 'Rezepturen' anzugeben anstatt genaue Gewichte - einerseits mögen sich die Mengen der Materialien ja zweifellos von Auftrag zu Auftrag verändern, andererseits wissen wir von den lokal unterschiedlichen Maßsystemen: das Pfund wog nicht überall dieselben 467,6 Gramm.
Aber wie sollte es dann, so stellen wir uns Neuzeitliche ganz unbedarft die Frage, auf einer einfachen, gleicharmigen Balkenwaage, wie sie wohl in jedem Kloster, wie sie jedem Handwerker zur Verfügung stand, möglich gewesen sein, ein beliebiges Verhältnis 4:1, wie oben in der Glockenrezeptur verlangt, auszuwägen? Wie haben das die mittelalterlichen Kunsthandwerker vermocht?
Nun, gar zu schwer fällt uns das nach einigem Nachdenken nicht: Die gleicharmige Balkenwaage ermöglicht es (ohne Vergleichsgewichte) in einfacher Weise eine Menge an Pulver oder Granulat in zwei gleiche Teilmengen zu unterteilen: Schichtet dazu einfach die Haufen in den beiden Schalen solange um, bis Gleichgewicht herrscht. Dann habt ihr die Menge halbiert. Nehmt nun die beiden Halbmengen von den Schalen und geht mit ihnen ganz gleich vor wie zuvor mit der gesamten Masse. Die vier resultierenden Haufen stellen jeder für sich dann ein Viertel der Gesamtmenge vor. Vier von den fünf benötigten Teilen hätten wir also bereits ...
Den fünften Teil (aus dem beizumengenden Material) erhalten wir, indem wir eins der bereits ausgemessenen Viertel zurück in die Schale leeren und nun das Zweitmaterial in der anderen Schale damit wiederum ins Gleichgewicht bringen. Eine feine, wenn auch etwas umständliche Methode, die es uns erlaubt, beliebige Mengen ins rechte Maß zu setzen - und zwar ganz ohne Vergleichsgewichte und elektronische Hilfsmittel ...
Damit euch aber nicht langweilig werden möchte bis zum Erscheinen unseres nächsten Beitrages und damit ihr auch recht wohl begreift, worin die Feinheiten einer solchen Verhältnisbestimmung beruhen, merkt euch folgende Hausübung an (deren getreuliche Erledigung ihr uns mit der Zusendung der gewissenhaft erarbeiteten Lösung nachweisen mögt, andernfalls ihr strenges Nachsitzen zu gegenwärtigen habt!!): Mischt also 4 Teile Zucker mit zwei Teilen Zimt; mengt noch je einen Teil Pfeffer und Salz dazu. Verquirlt die Mischung in 8 Teilen Milch und findet jemanden, der das ekelige Zeug dann auch noch trinkt ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Redensarten
und Handwerk

Alte Redensarten: Wenn einer den Löffel abgibt, ...
... dann muss er dazu nicht unbedingt im Restaurant sitzen oder zu Gast geladen sein bei Freunden - wiewohl traurigerweise nicht auszuschließen ist, dass genau jenes durchaus auch an den erwähnten Orten geschehen kann. Speziell dann, wenn der experimentierfreudige Küchenchef noch nicht viel Erfahrung besitzt im Zubereiten der exotischen Kugelfische, dafür aber umso mehr Begeisterung, oder die aufwartende Hausfrau sich um die Haltbarkeit der zur Bereitung der Creme verwendeten Eier recht wenig Sorgen zu machen pflegt ...
Allerdings würde das dann bedeuten, dass für gewöhnlich mehr als nur ein Löffel frei wird, ja, dass nachgerade ein ganzes Set von solchen Besteckteilen nach neuen Benutzern benutzerlos zurückbleibt. Denn natürlich wisst ihr, werte Leser, längst Bescheid, welche unglückseliger Ereignis damit gemeint ist, wenn einer 'den Löffel abgibt'. Um nicht weniger als eine Umschreibung - und zwar eine recht rüde und unverblümte - für den Tod eines Menschen handelt es sich.

Dasselbe meinen auch die sinnesverwandte Redensarten 'den Löffel wegwerfen' oder 'den Löffel an die Wand hängen'. Sieht man genau hin, so wird man Ähnliches in allen deutschsprachigen Gebieten finden. Ihr wollt nun sicher eine Erklärung dafür, wie es zu dieser makaberen Sinnbelegung des an sich harmlosen Besteckteils gekommen ist. Obwohl nun gerade wir von Sælde und êre die 'Weisheit nicht mit Löffeln gefressen haben', wollen wir dennoch eine solche Erklärung versuchen. Spitzt also die Löffel:
Essen und Leben bedingen sich - soviel ist klar. Wer nicht mehr isst, der muss tot sein ... oder wird es bald sein. Also könnte das symbolische Wegglegen des Bestecks und das damit verbundene Nie-mehr-Essen recht gut als gedanklicher Ausgangspunkt für eine Begründung der Redewendung dienen. Aber die Gabel, werdet ihr jetzt rufen! Warum heißt es dann nicht, einer hätte seine Gabel abgegeben? Oder sein Messer?
Mit dem Messer tun wir uns da mit der Erklärung ein wenig schwerer als mit der Gabel. Denn selbige Gabel war in alten Zeiten - und auf solche geht vorliegendes Sprichwort wie so viele andere auch zurück - nicht im Gebrauch. Zumindest nicht beim täglichen Mahl. Zumindest nicht am oftmals karg gedeckten Tisch der einfachen Leute. Denn beim Bauern standen Brei und Mus an der Tagesordnung, Eintopf und Suppe. Speisen also, zu derem Verzehr man keiner Gabel bedurfte. Und die man für gewöhnlich aus einem gemeinsamen Topf - richtig! - löffelte.
Dafür besaß jedes Haushaltsmitglied seinen eigenen, häufig selbst gefertigten oder ererbten, Löffel. Den man erst dann aus der Hand gab (vielleicht sogar fallen ließ), wenn man seiner nie mehr bedurfte. Außer man war in einem jene Landesteile beheimatet, in denen der Brauch herrschte, die Löffel verstorbener Angehöriger an die Wand zu hängen.
Wir wollen der Vollständigkeit halber nicht verschweigen, dass die Löffelabgabe zum Glück aber auch weniger drastischen Ursachen geschuldet sein konnte: So hören wir davon, wie Knechte beim Verdingen an einem Hof vom Bauern einen Löffel ausgehändigt bekamen, den sie dann, wenn sie weiterzogen, wieder abzugeben hatten. Das waren sicher keine Silberlöffel, die zu stehlen es sich gelohnt hätte, doch schade war es allemal. Wenn auch zum Glück nicht letal ...
Auch am Hof der Fürsten, entnehmen wir den Quellen, galt es, bei Aufhebung der Tafel jene herrschaftlichen Löffel (die nun durchaus aus Silber sein konnten oder vergoldet und kunstvoll gestaltet) wieder zurückzugeben, welche nebst viel anderem Tamtam helfen sollten, den Wohlstand und höfischen Gepflogenheiten des Gastgebers zu betonen.
Höfische, verfeinerte Sitten? Und wie war das mit der Gabel? Die brauchte man bei Tisch noch lange nicht. Denn 'wozu hat Gott dem Menschen zehn Finger gegeben', wenn nicht zum tüchtig Zupacken bei all den Leckereien? Beim Fleisch! Das übrigens bei Hof vortranchiert wurde - mit Messer und, man staune, Gabel! - in kleine, mundgerechte Stücke. Bei den Festgästen selbst war als kein Bedarf nach dem mehrzackigen, vorgeblichen Teufelswerkzeug (wer hat diese Mär bloß wieder erfunden?)
Und wenn's dann einmal gar vonnöten war, selbst Hand anzulegen beim Zerteilen, dann nahm man das eigene Messer zuhilfe, das man immer am Gürtel trug. Notfalls als Gabelersatz auch zum Aufspießen mit der Spitze. Warum aber heißt es dann nicht sprichwörtlich, einer hätte das Messer abgegeben? Vielleicht, weil Letzteres als Universalwerkzeug weniger gut den Zusammenhang mit der vitalerhaltenden Funktion Essen verdeutlicht hätte wie der spezialisierte Löffel ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Reisen im Mittelalter

Reisen im Mittelalter 3 - Kobelwägen: '... wie herrliche Schiffe von Tieren gezogen ...'
Zurück zum zweiten Teil der Artikelserie.
'... das in muoste tragen sin hangunder wagen, der gie sanft und feine ...'
Zwei Zitate sind es, mit denen der heutige Beitrag zum Verkehrswesen und zum Reisen im Mittelalter startet. Beide Male ist von komfortableren, vierrädrigen Wägen die Rede, welche - mehrere Innovationen nutzend, darunter eine, die sich ins Frühmittelalter zurückverfolgen lässt - im Laufe der um die Jahrtausendwende folgenden Jahrhunderte vermehrt zum Personentransport zum Einsatz kamen.
Sowohl jener Chronist, der bei seiner Beschreibung des umjubelten Empfanges, den Kaiser Friedrich II. und seine englische Braut Isabella 1235 in Köln erfuhren, von jenen 'herrlchen Schiffen, die von Tieren gezogen das Land befuhren' als auch jene Stelle in der Österreichischen Reimchronik des Ottokar von Steiermark, die uns vom sanften Gang eines Fahrzeuges berichtet, der einem kranken Mann Erleichterung beim Reisen verschafft, meinen in ihren Berichten den Kobelwagen.
Damit ist ein (vierrädriger) Wagentyp gemeint, dessen Wagenkasten nicht fest mit dem Wagenunterteil verbunden sondern in Längsaufhängung an Bug und Heck mit Metallklammern, Seilen oder Ketten an einem eisernes Kipfenpaar befestigtt wurde, wie dies auch die untenstehende Bilddarstellung zeigt.

Damit konnte - im Zusammenspiel mit den großen, schlaglochunempfindlicheren Speichenrädern - eine federnde Wirkung erzielt werden, wodurch ein erheblicher Komfortgewinn für den Passagier (oder auch zerbrechliche Ware) resultierte, wenn das Ganze auch eine recht schaukelnde Angelegenheit dargestellt haben muss.
Insofern verleitet dieser Ansatz, der sich in Texten - etwa in der Lebensgeschichte des heiligen Ulrich von Augsburg - bis ins 10. Jahrhundert zurückverfolgen lässt und von dem uns in einer im ersten Viertel des 11. Jahrhunderts entsandenen Handschrift der 'Aelfric Paraphrase' eine erste bekanntes Bilddarstellung überliefert ist, zudem zum Vergleich mit moderner Transporttechnik, als eben der gesamte Oberteil (inklusive der Beladung) abgehoben und ausgetauscht werden konnte - und somit einen Vorläufer unserer Containerschiffe und -laster darstellt ...
Aber warum Kobelwagen? Das mittelhochdeutsche 'kobel' steht ursprünglich für ein enges schlechtes Haus (und wohl auch in Verwandtschaft zum bekanntermaßen wenig luxuriosen Schweinekobel), aber auch im engeren Sinn für das 'Siechenhaus', das gebrechlichen und kranken Menschen Herberge geben sollte. Warum dieser Bezeichnung dann auf diese Art von Wagen übertragen wurde, erahnen wir durch Kenntnisnahme des Zitates aus der 'Reimchronik', waren doch derartige Wägen, wie dort beschrieben, lange dem Transport der Kranken, Älteren, Gebrechlichen aber auch der Frauen vorbehalten.
Werft einen Blick auf die Abbildung: Die Männer hoch zu Ross - der Herr (von Stand) saß (noch weit bis ins 16. Jahrhundert hinein) so lange es eben noch ging zu Pferde (und wenn das nun gar nicht mehr möglich war, wie in den letzten Lebenswochen des todkranken Kaisers Maximilian, dann stieg man immer noch lieber in eine Sänfte um! In diesem Zusammenhang verstehen wir nun vielleicht auch besser, welches Opfer Lancelot auf sich nahm, als er sich einen Karren zum Gefährt wählen musste und wie wenig schmeichelhaft die Bezeichnung 'Karrenritter' ist, die ihm aufgrund dieser Begebenheit verblieb ...).
Zurück zu unserer Abbildung: Der Wagenkobel ist alleine den Frauen reserviert, während der Kutschführer seinen Job vom Rücken des Zugpferdes aus erledigt und der Musicus, der angestellt ist, die offensichtlich gutsituierten Damen zu unterhalten hat, am hinteren Ende des Wagen Aufstellung genommen hat.
Also handelt es sich hier um einen Reisewagen für Damen des gehobenen Standes. Im höfischen Bereich kamen solche, auch als ausgesprochene Prunkwägen ausgeführte Fahrzeuge mehr und mehr zum Einsatz - etwa für die Damen der neapoletanischen Anjou-Dynastie des 14. Jahrhunderts. Und unter den 'herrlichen Schiffen'. die uns der Kölner Chronist zu Beginn des Beitrages beschrieben hat, wird man sich wohl ähnliche prächtige Fahrzeuge vorzustellen haben, auch wenn es dort nicht Damen waren, die die Fahrzeuge besetzten, sondern dem Geistliche, die zu Ehren des Kaisers und seiner Braut unter Orgelbegleitung herrliche Gesänge vorgetragen haben sollen.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Reisen im Mittelalter

Reisen im Mittelalter 2 - Karren und Wägen ... eine recht rumpelige Angelegenheit
Zurück zum ersten Teil der Artikelserie.
In einer Artikelserie, die sich das Reisen (im Mittelalter) zum Inhalt gemacht hat, darf der Wagen selbstverständlich nicht fehlen. Denn wer sich auf Reisen macht, der will dies, soferne er sich solches zu leisten vermag, schließlich recht angenehm und in aller Bequemlichkeit tun - würden zumindest wir Heutigen vermuten. Doch habt acht - den meisten musste damals Schusters Rappen gerade recht sein oder auch der störrische Esel! Das edlere Pferd dagegen war dem Herren bestimmt - doch auch dem mag, wenn er abends, nach anstrengendem Tagesritt aus dem Sattel glitt, der fürstliche Hintern recht unfürstlich geschmerzt haben.
Nun mag einer rasch einwerfen, fürstliche Hinterteile und geistliches Fußwerk hätten damals eben weit mehr zu ertragen vermocht als unsere büroverkrümmten Rücken heutzutage, wo wir uns doch lieber in die Schlange vor der Rolltreppe einreihen, denn daneben das Dutzend Stufen zu Fuß zu erklimmen. Zudem könne doch ein Ritt auf Meister Langohr etwas recht Romantisches an sich haben ... Recht mag er haben, mit diesen Einwänden, dennoch war das in die Ferne Ziehen dereinst wohl selbst für hohe Herrschaften eine recht anstrengende Angelegenheit!
So lasst sie denn einen Wagen nehmen, ruft ihr jetzt vielleicht, schließlich wären derartige Gefährte schon seit vielen Jahrtausenden bekannt (genauer gesagt, reichen ersten Zeugnisse und Funde ins 4. vorchristliche Jahrtausend zurück, in mehrere Gegenden zugleich - nach Mesopotamiem, in das Kaukasusgebiet und die Steppen Osteuropas -, was die unabhängige 'Erfindung' des Wagens an verschiedenen Orten nahelegt.

Ja doch. Wenn's denn nicht als unmännlich gegolten hätte für den adeligen Herren und verpönt. Man ritt - solange man dies vermochte. Die Resien in den Wägen überließ man (wohl auch, weil sie über lange Zeit recht unbequem blieben) Frauen und jenen Männern, die nicht mehr anders zu reisen vermochten: Alten, Kranken. Und Verbrechern!
Warum unbequem, fragt ihr? Gab es denn dereinst zur Zeit der Cäsaren nicht ein prächtig ausgebautes Straßennetz? Verkehrswege, viele tausend Meilen lang, welche, gepflastert und in regelmäßigen Abständen mit Trittsteinen versehen, um dem rastenden Reitersmann das Wiederaufsteigen auf seinen Gaul zu erleichtern, das Imperium durchzogen? Stand sie Wagenbaukunst nicht in hohem Ansehen, innerhalb und auch außerhalb der Grenzen? Finden sich nicht im klassischen Latein um die 17 Bezeichnungen für Wagentypen?
Wohl war es so, doch die Zeiten änderten sich. Das Kaiserreich im Westen verfiel und seine vielen lokalen Nachfolger vermochten die Straßen nicht zu erhalten. Oder legten auch gar keinen Wert darauf, schließlich sollten die immer neu nachstoßenden Eindringlinge und Horden nicht direkt zu den Siedlungen und Villen geführt werden. Neue Wege entstanden, abseits der alten Straßen; man benützte Saumpfade und Wege - allesamt für den Wagenverkehr nicht geeignet. Und wo man Straßen erhielt, geschah dies allenfalls lokal.
Als Indiz dafür, wie sehr die Bedeutung des Wagenverkehrs abgenommen haben mag, soll euch der Hinweis dienen, dass das Mittellatein kaum noch ein halbes Dutzend Bezeichnungen für Wägen kennt! Dennoch finden sich im Capitulare de villis, der Landgüterverordnung, die Karl der Große um 800 erlassen hat, mit Leder bedeckte Wägen erwähnt, die auf Heerzügen mitzuführen wären und wasserdicht zu sein hätten. Zuvor schon, noch in der Zeit der Merowinger, wissen wir vom Wagen als gebräuchlichstem Transportmittel für die klösterlichen Grundherrschaften.
In vielen Gegenden und über lange Epochen blieb dabei der zweirädrige (einachsige), von Ochsen gezogene Wagen (lat: carrecta, carrucca; frz.: charette; mhdt: karre) das übliche Transportmittel (für Waren un Güter). Der vierrädrige Wagen (mlat: carrecta, carrucca; frz.: charette; mhdt: carrus, quadriga, ...; frz.: char; mhdt: wagen) kommt erst ab dem 11. Jahrhundert wieder vermehrt in Gebrauch.
Die Gründe? Vielleicht die Zeit des Aufschwungs um die Jahrtausendwende. Der Bedarf an Transportmitteln für größer Lasten, jetzt, wo so viele neue Kirchen entstanden. Und Fortschritte technischer Art, wie etwa die Verbreitung von Ortscheit und Kummet, welches eine bessere Ausnutzung der Zugkraft erlaubt aber auch die Ablösung der Zugochsen durch das leistungsfähigere Pferd.
Die Weiterentwicklung des Speichenrades zum Sturzrad während des 13. Jahrhunderts machte das Rad bruchsicherer (wodurch auch der Einsatz von Rädern mit größerem Durchmesser und damit eine größerer Unempfindlichkeit gegen Unebenheiten und Schlaglöcher und folglich auch größerer Fahrkomfort ermöglicht wurde - in Zeiten, die keine wirksame Wagenfederung kannten, nicht unwichtig!) und die Beschlagung der Lauffläche mit Nägeln oder Eisenreifen ließ die Felge widerstandsfähiger werden.
Auch ist wohl die des Öfteren geäußerte Annahme, das Mittelalter hätte nur starre Wagenachsen gekannt, mithin also die Technik der drehbaren Vorderachse 'vergessen', allein aus praktischen Überlegungen kaum haltbar - Wagen mit starren Achsen wären schließlich beim Transport schwerer Lasten, wie eben Baumaterial aber auch vielerlei Kaufmannsgüter, faktisch unlenkbar gewesen ...
Dies soll uns fürs Erste genügen. Wer aber über übliche Transportlasten und derlei Dinge mehr etwas erfahren möchte, der möge sich auf die Fortsetzung der Serie gedulden ...
Weiter zum dritten Teil der Artikelserie.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Redensarten
und Handwerk

Alte Redensarten: Wer heutzutage vom Tuten und Blasen keine Ahnung hat ...
... muss darum nicht zwingend ungeignet sein für die Mitgliedschaft in einem Blasmusikorchester, kann er doch sehr wohl 'ins selbe Horn' wie seine Mitstreiter oder ihnen gar recht ordentlich 'den Marsch blasen'. Und sich zudem trösten, sieht er sich doch als solcher zumindest seit dem 16. Jahrhundert in guter - oder sollten wir eher sagen belächelnswerter? - Gesellschaft ...
Denn seit diesem längst verflossenen Zeitabschnitt ist die überschriftgebende Redewendung bezeugt. Und wenn etwa bereits Eucharius Eyering (Proverbiorum Copia, 1601) meint: Er kan weder thuetten noch blasen, dann ahnen einige unter euch, werte Leser, dass er dabei an etwas anderes denkt als an die Eingliederung eines solcherart Beschriebenen in das gesellige Zusammenspiel lustiger Musikantengesellen.

'Wie das?', mögen nun vielleicht die anderen fragen. Ist denn das 'Blasen' nicht die Tätigkeit des braven Hornisten und des gewichtigen Tubaspielers? Oder jene des überirdische Höhen erklimmenden Trompeters und des geschmeidigen Posaunisten. 'Geschmeidig, hihi ...', hören wir schon einige Wenige kichern, '... gibt's da nicht noch andere Bedeut...' Halt! Unverzüglich halt, unterbrechen wir solch schurkisch-schmutzige Gedanken! Denn schließlich ist hier ein seriöser Ort, an dem auch unverdorbene Jugend und anderes ordentliches Volk umtriebig seinen Wissensdrang stillen soll, ohne solcherart doppeldeutigen Schlüpfrigkeiten zu begegnen ...
Zudem bezeichnet das Blasen - um der Redewendung wissenschaftlich fundiert an den Kragen zu gehen - ursprünglich eindeutig das kräftige Ausstoßen der Luft beziehungsweise ein starkes Wehen des Windes; so bezeugt schon im althochdeutschen 'blasan', wo es zudem sinnverwandt noch für 'atmen, schnauben' stehen kann. Und weil die (Blech-)Bläser bekanntermaßen einen recht kräftigen Atem zum Spiel ihrer Instrumente benötigen, ist 'blasen', wie's uns scheint, recht bezeichnend gewählt für ihre Tätigkeit.
Tuten (mhdt. tuten) meint hingegen lautmalend 'einen lauten, dunklen Ton hören lassen' oder, folgerichtig, auch ein Signalhorn blasen und somit kräfig Schall zu erzeugen (mhdt. 'ertiuten': erschallen).
Warum aber ist nun mit dem 'Tuten und Blasen' sprichwörtlich etwas ganz anderes gemeint sein als die angesprochene Art der Tonerzeugung? Denn ihr wisst es ja längst: Vom Tuten und Blasen keine Ahnung zu haben, das meint, nicht den geringsten Durchblick zu besitzen. Unfähig zu sein (und, damit vielleicht ein bißchen mitschwingend, nicht einmal das zu kapieren ...)
Woher aber nun rührt tatsächlich die Bedeutung der Redewendung? Nun, wiewohl wir abends, mit dem Bier in der Hand, bei der ungläubigen Zurkenntnisnahme manch politischer Entscheidungen in den Nachrichtensendungen, dazu neigen, manch einer der darin auftretenden Persönlichkeiten genau das zu attestieren von dem hier die Rede ist, nämlich keine Ahnung vom Tuten und Blasen zu haben (und dabei vielleicht sogar noch 'kalt und warm aus einem Maul zu blasen'), reicht die negative Sinnzuweisung wohl weiter in die Vergangenheit zurück - ein Beweis mehr, wie wenig sich die Menschheit in manchen Belangen doch im Laufe der Jahrhunderte verändert hat.
Es sollen nämlich zwei wenig geachtete Berufsstände gewesen sein, die mit für sie charakteristischen Tätigkeiten dafür verantwortlich gezeichnet haben. Sowohl der Hirte wie auch der Nachtwächter nutzten nämlich das Horn; ersterer zum Locken seines (Rind-)Viehs, letzterer zum Alarmieren des friedlich schlafenden Stadtvolkes im Falle eines Brandes oder anderer Gefahren. Und weil man meinte, für die Ausübung dieser Berufe bräuchte es nicht viel mehr als nur die Augen aufmerksam offenzuhalten und im richtigen Augenblick das Horn zu blasen (heutzutage würden wir wohl von einem wenig anspruchsvollen Arbeitsprofil sprechen) , musste wohl einer, der nicht einmal dazu fähig war, der also nicht einmal richtig Tuten und Blasen konnte, ein ausgemachter Dummkopf sein.
Eine anderer Erklärungsversuch nimmt das typische Erscheinungsbild des Nachtwächters, wie er seinen Zeitgenossen erschienen sein muss, als Ausgangspunkt: Durch seine nächtliche Tätigkeit bedingt, war er wohl tagsüber recht oft übermüdet - und muss daher bei plötzlicher Ansprache auch oft genug begriffsstutzig und etwas langsam gewirkt haben. Was wir von Sælde und êre durch manch Selbstversuch durchaus bestätigen können: Spät heimgekommen und früh geweckt, da haben schon ganz andere als wir 'aus dem letzten Loch geblasen' (ohne dazu zwingend eine Flöte besitzen zu müssen) ...
Seid getröstet: Ist es nämlch einmal so weit, braucht man darob nicht allzusehr 'Trübsal zu blasen': Ein wenig Schlaf, möchten wir jetzt mit jenen Medizinern, die dies empfehlen, 'ins selbe Horn stoßen', reicht aus - schon sind Welt- und Kopfschmerz 'wie weggeblasen' ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

(Aus-)Bildung im MA
Steinmetze

Vom Steinmetzlehrling zum Werkmeister auf der Dombaustelle
Gotische Dome! Das Streben dem Licht entgegen. Noch heute staunen wir, wenn wir zu den Gewölben jener Wunderwerke hinaufblicken, steingewordene Häuser Gottes auf Erden, Versinnbildlichung der Kirche Christi, welche der Schwerkraft zu trotzen scheinen, und uns dabei unweigerlich fragen, wie die mittelalterlichen Baumeister derartiges zu erschaffen vermochten ohne all jener Technik, der wir uns heutzutage bedienen.
Wie war es möglich, ohne weitreichende mathematische Hilfsmittel, ohne die Methoden der modernen Vermessungstechnik, ohne theoretische Kenntnisse der Statik, ohne Dampfkraft und Elektrizität Bauwerke zu erschaffen, welche viele Jahrhunderten zu trotzen verstanden? Woher erlangten die Parlers, Deschamps, Ensingers und all die anderen Meister jenes Wissen und jene Erfahrung, die nötig waren, um die berühmten Kathedralen der Gotik zu planen und zu erbauen?
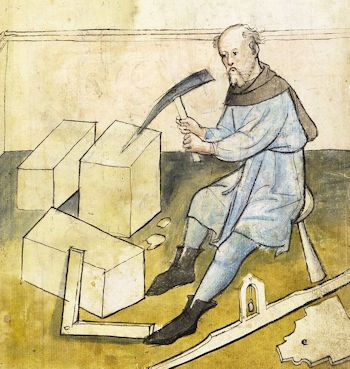
Vorwegnehmend sei gesagt, dass sich dieser Artikel nicht mit der Organisation der Dombauhütten beschäftigen will und auch nicht mit der Aufgabenteilung, die immer einen (oder in Ausnahmefällen auch mehrere) Veantwortlichen für die Verwaltung der Finanzen vorsah, die die Bauvorhaben verschlangen und nicht selten zum Stocken brachten, sowie den eigentlich bauausführend-leitenden Baumeister.
Handelte es sich bei Letzterem stets um einen erfahrenen Handwerker - entweder um einen Maurer- (magister caementarii) oder um einen Steinmetzmeister (magister lapicidae, magister sculptor) -, war der Finanzverwalter ein Beauftragter des Bauherrn oder des Bauherrnkollegiums und somit meist angesehener Patrizier oder auch Geistlicher, welche häufig auf begrenzte Zeit agierten. In den Quellen finden sich für beide Funktionen mit 'magister operis' beziehungsweise 'magister fabricae' verwirrenderweise dieselben Bezeichnungen, was eine Unterscheidung nicht immer einfach macht.
Wer Genaueres dazu erfahren möchte, sei auf den Artikel über den mittelalterlichen Werkmeister verwiesen oder aber um Geduld gebeten - wir werden hier in weiterer Folge sicher noch einige interessante Aspekte zur Organisation hoch- und spätmittelalterlicher Dombauhütten behandeln.
Hier interessiert uns vorerst, wo und wie sich die erwähnten Werkmeister, welche die Bauausführung praktisch leiteten und die in den Aufzeichnungen passenderweise auch als 'artifex' (Kunstfertiger) bezeichnet werden, die notwendigen Kenntnisse (neudeutsch würden wir Kompetenzen schreiben) für eine solche Stellung und Herausforderung erwarben.
Um es vorwegzunehmen: Es waren lange Jahre des Lernens und des praktischen Arbeitens, Jahre vielfältiger Erfahrungen und ständigen Weiterbildens notwendig, ehe der Lehrling zum Meister, ja vielleicht sogar zum Dombaumeister werden konnte. Verständlich, werdet ihr sagen, und wer würde das nicht ob der ungeheuren Herausforderungen, die eine solche Großbaustelle darstellte? (Seltsam, wagen wir hier einzuwerfen, das gerade heutzutage manch ein (selbst- oder von wem auch immer ernannter) 'Unterrichtsexperte' dieses Lernen und Bilden durch Selbst-'Begreifen' und -erarbeiten in Frage stellt, weil es doch das Internet gäbe, welches jederzeit und allenortens die Antwort auf alle unsere Probleme geben könne - fast so, als bräuchte es nicht die langjährige Übung um eine Fremdsprache wirklich gut zu beherrschen, fast so als genügte das bloße Betrachten der Grifftabellen, um ohne harte Fingerarbeit virtuos feurige Flamencorhythmen zum Leben zu erwecken, fast so als genügten einige Formeln aus Wikipedia, um komplexe technische Zusammenhänge zu verstehen und anzuwenden ... nun ja, weil wir solches nicht begreifen, sind wir wohl selbst keine Experten ...)
Doch eigentlich wollten wir euch nicht mit Unterrichtsexperten belästigen, sondern damit, wie sich jene alten Werkmeister ihr Wissen erwarben, das sie zur Planung und zum Bau der Kirchen, Dome und Kathedralen befähigte. Nun, ihre Ausbildung begannen sie in der Regel mit 14 Jahren als Lehrling (lereknecht, diener), wobei zwischen Maurern, die drei Jahre zu dienen hatten, und Steinmetzen zu unterscheiden ist; letztere brauchten nachdem sie das Maurern verinnerlicht hatten, noch zwei weitere Jahre, um das Schlagen von Quadern und Profilen zu erlernen.
Dabei gab es gewisse Voraussetzungen für die Aufnahme: So musste der angehende Lehrling ehelich geboren sein, um das Handwerk erlernen zu dürfen. Dies geschah bei einem Meister, dem er eine Lehrgebühr zu bezahlen hatte, welche er rückerstattet bekam, sobald er seine Lehre abgeschlossen hatte. Eine Lehrstelle zu finden mochte nicht immer einfach sein, durfte doch ein Meister nur einen oder zwei Lehrlinge zur selben Zeit beschäftigen. War er jedoch auf mehreren Baustellen zugleich tätig (was vertraglich jedoch oft untersagt wurde), dann durften es bis zu fünf hoffnungsfrohe Auszubildende sein. Bedenkt man nun noch, dass es meist die eigenen Söhne waren, die in des Vaters Obhut lernten, dann versteht man, dass auch damals schon Lehrstellen knapp werden konnten ...
Für den Steinmetz ist nach Abschluss der fünfjährigen Lehrzeit, nach der er (mit der sogenannten Ledigsprechung) zum Gesellen wird und damit auch Mitspracherecht in den Bauhütten erlangte, eine einjährige Wanderschaft Pflicht. Arbeit gab es bei den vielen Dombaustellen für den wandernden Steinmetz allemal - der Bedarf war hoch, und damit die auch die Gelegenheit, Erfahrungen über neueste Trends und Entwicklungen durch die Tätigkeit in mehreren, möglichst bedeutenden Bauhütten zu sammeln.
Nach Abschluss der Wanderschaft konnte sich der Geselle wiederum bei einem Meister verdingen und dort, bei entsprechenden Fähigkeiten, zu dessem Vertreter (Parlier, appareilleur - woraus unser moderner 'Polier' wurde) aufsteigen. Als 'Sprecher' war er nicht nur Stellvertreter des Meisters am Bau (wenn dieser beispielsweise auf einer anderen Baustelle weilt), sondern auch dessen Sprachrohr, um den Beschäftigten Anweisungen zu verdeutlichen, die Maße für die Steine vorzugeben, anzuzeichen und dergleichen mehr. Selbst leistete er dabei auch stets Steinmetzarbeiten ...
Um selbst Meister zu werden, musste der Geselle weiter zwei Jahre 'umbe kunst dienen'. Dazu braucht er nicht erst Parlier zu werden. Als solcher 'Kunstdiener' oder 'Meisterknecht' erlernt er das Anfertigen von Bildhauerarbeiten, das Anfertigen von Plänen und Rissen, von Schablonen, nach denen (ab dem 13. Jahrhundert) Zierteile und Profile geschlagen werden. Vorlagen findet er dabei in den sogenannten Steinmetz- beziehunsweise Bauhüttenbüchern, wie jenem des Villard de Honecourt.
Nach Ablauf dieser zusätzlichen Dienstzeit konnte der Meisterknecht selbst zum Meister werden. Über Prüfungen, die dazu abzulegen gewesen wären, ist nichts überliefert; wohl aber musste der angehende Meister zwei Bürgen beistellen und einen (teuren) Meisterschmaus ausrichten. Bis es dazu kommt, kann es alles in allem schon gute zehn Jahre brauchen, recht viel also, um die Karriereleiter hochzuklettern! Allerdings auch verständlich, wenn man sich die vielfältigen Herausforderungen vor Augen führt, die große Bauprojekte von der Planung über den Bau bis zur Fertigstellung bereithalten.
Schließlich will man irgendwann selbst zum bauführenden Werkmeister werden. Und wie konnte das geschehen? Indem man etwa als Parlier einer bedeutenden Bauhütte an eine andere Baustelle als solcher berufen wird. Oder aber den Posten des vormaligen Werkmeisters nach dessen Ausscheiden (durch Tod, Arbeitsunfähigkeit oder Abberufung) übernimmt. Alles das aber nur dann, wenn man sich bis dahin einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet hat - hart erarbeitet hat, erreichte doch die Arbeitszeit am Bau im Sommer gute fünfzehn Stunden täglich (immerhin inklusive der Essenspausen).
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Kunsthandwerk des MA
Rezepturhandschriften

Kunsttechnologische Schriften des Mittelalters - Teil 1: Zur Einführung ...
Das Mittelalter kennt eine Reihe kunsttechnologischer Traktate; darunter versteht man schriftliche Abhandlungen, welche verschiedene Aspekte, die zur Herstellung und Gestaltung etwa von Sakralgegeneständen, Gemälden, Buchmalereien, Plastiken von Bedeutung sind, behandeln. Darunter können Rezepturen zur Erzeugung von Tinten und Farben ebenso gehören wie die Auflistung der einzelnen Arbeitsschritte, die der Goldschmied bei der Herstellung seiner Erzeugnisse durchzuführen hat.
Diese Ausführungen sind in unterschiedlich ausführlicher Form erstellt: Zwischen den Extremen der genauen Arbeitsanweisung, die zur Belehrung und zur Ausbildung des Schülers gedacht ist und der Gedächtnisskizzen, die dem Erfahrenen nur den groben Handlungsfaden liefert, ihm aber, weil er solche nicht mehr beschrieben braucht, jegliche Details der einzelnen Tätigkeiten verschweigt, bewegen sich diese 'Rezeptbüchlein'.

In jedem Fall aber hat der neuzeitliche Leser damit zu rechnen, dass jene Tätigkeiten und Details, die die Verfasser solcher Traktate bei seinen Zeitgenossen als allgemein bekannt voraussetzen konnte, keine Aufnahme in seinen Text fanden (ähnlich wie die Autoren moderner Kochbücher beim Hobbykoch ein gewisses Verständnis von der Funktion eines Herdes voraussetzen und folglich ihren Rezepturen keine Bedienungsanleitung des Gerätes beilegen). Dieser Umstand, zusammen mit der Tatsache, dass mancherlei von diesem einst vorhandenen Allgemeinwissens verlorengegangen ist, erschwert uns Neuzeitlichen das 'Nachkochen' der angeführten Rezepturen beträchtlich.
Legt man dabei die Messlatte hoch, wünscht man also größtmögliche Authentizität zu erreichen, wird man sich vielfach eingestehen müssen, dass solche nicht mehr gewährleisten werden kann - zu groß sind die Unsicherheiten, zu bedeutend die Fragen, die die Traktattexte offen lassen. Zu dem weiter oben angeführten Umstand kommen ja noch andere dazu, welche zusätzlich erschwerend wirken.
Man bedenke, dass diese Texte üblicherweise in (vielleicht sogar stark verderbten) Latein verfasst wurden, in einer Zeit, in der es für viele der benötigten Tätikeiten, Materialien und Werkzeuge keine entsprechenden Bezeichnungen in dieser Sprache gab und somit der Traktatersteller mehr oder weniger geeignete Vokabeln dafür (er)finden musste. Zudem wurden vorhandene Begriffe (etwa von Pflanzen oder Farbstoffen) häufig in mehrdeutiger Weise verwendet.
Ziehen wir noch einmal unsere bereits verwendete Analogiebetrachtung zum modernen Kochbuch heran, dann stellen die mittelalterlichen Mengenangaben eine weitere bedeutende Schwierigkeit dar: Die damals verwendeten Gewichtssysteme unterschieden sich wesentlich von unserem heutigen, zudem waren regional viele unterschiedliche in Gebrauch, was uns eine genaue Dosierung alleine aufgrund der angegebenen Rezeptur fast unmöglich macht - wenn der Autor nicht überhaupt auf mengenmäßige Angaben vollständig verzichtet und uns stattdessen Angaben wie 'ein wenig', 'ausreichend', oder 'menge ein Viertel hinzu' hinterlassen hat.
Wissenschaftliche Institutionen versuchen heutzutage häufig solcherart auf die originalen Rezepturen zurückzuschließen, dass sie Theorie und Praxis verbinden. Sie gehen also ins Labor, wo sie unter Verwendung der mittelalterlichen Anleitungen und unter mehr oder weniger originären Begleitumständen an den Bestandteilen und Mengen herumexperimentieren - so lange, bis sie zufriedenstellende Ergebnisse erzielen. Ob diese dann tatsächlich als authentisch zu betrachten sind, muss dennoch bis zu einem gewissen Grad unsicher bleiben ...
... auch deshalb, weil - um etwa speziell auf die Farbherstellung einzugehen - die original verwendeten Pigmente nicht mehr verfügbar sind beziehungsweise nicht mehr mit Sicherheit identifiziert werden können. Oder aber, weil man in der Vergangenheit viellfach über die Giftigkeit manch verwendeter Materialien nicht Bescheid wusste - und diese heutzutage gar nicht mehr verwendet werden sollten beziehungsweise dies nur unter streng reglementierten Umständen erlaubt ist ...
Wie bereits an anderer Stelle (im handwerktechnischen Teil unserer Arbeitsgruppen) angekündigt, wollen wir von Sælde und êre uns in den nächsten Monaten etwas genauer mit mittelalterlichen Malpraktiken beschäftigen. Dazu begleitend ist die Artikelserie über mittelalterlichen kunsthandwerklichen Traktate gedacht, deren erster Teil und Einführung hiermit vorliegt.
Unter anderem wollen wir uns dabei in lockerer Folge mit solchen Klassikern wie dem soganannten Lucca-Manuskript (Compositiones ad tingenda musiva), dem Mappae Clavicula (Schlüssel zum Malen und Färben), der Schedula Diversarum Artium (Verzeichnis einzelner Künste) des Theophylus Presbyter und anderen mehr befassen, während wir uns an mehr oder minder appetitlichen Leimen und Ölen und Gallen die Finger schmutzig machen. Harret also voller Spannung ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Technologie des MA
Automaten

Automaten im Mittelalter - Teil 2: Fortsetzung in eine Zeit der Umbrüche
Zurück zum ersten Teil der Artikelserie.
Da war doch noch etwas ....? Richtig, unsere just erst begonnene Reihe, die sich mit Automaten befassen möchte, die das ach so dunkle Mittelalter noch lange vor den genialen Konstrukteuren der Renaissance hervorgebracht hat. Wer aber vom (europäischen) Mittelalter spricht, der sollte stets bedenken, wie eng sich die geistigen Kapazitäten jener Epoche der Antike verbunden und verpflichtet fühlten. Und dass es dem mittelalterlichen Gelehrten - oder sollten wir besser schreiben, Chronisten? - die längste Zeit mehr darum ging, das Wissen vorangegangener Epochen getreulich zu bewahren, denn zu mehren oder gar zu widerlegen ...
Also doch ein 'dunkles Zeitalter', dem Originäres fremd war? Dem selbst viel vom alten Wissen fehlte? Ausschließlich beherrscht vom Denken barbarischer Eroberer? Mitnichten - man braucht nur ein wenig genauer hinzusehen, in die Jahrzehnte und Jahrhunderte, die jenen bewegten Zeitaltern folgten, welche durch Hunnenstürme, germanische Reichsbildungen und die islamische Expansion charakterisiert waren. Kaum ebbten die großen Gezeitenhübe ab, lässt sich in vorerst unbeachteten Winkeln und Nischen der vorherrschenden Gedankenwelt Verschüttetes wieder erstehen sehen oder gar Neues, Einmaliges, das den bewunderten antiken Vorbildern fremd war.

Allenfalls Zwerge, werdet ihr jetzt sagen, die auf den Schultern geschichtsstaubbedeckter Riesen ihre 'Schülerexperimente' trieben. Und wenn dem so wäre? antworten wir. Dann müsst ihr nämlich auch die bewunderten Namen des italienischen Cinquecento unter diese Gnomenschar reihen - resultiert doch deren die Kunst und Kunstfertigleit in noch viel größerem Maße aus der Rückbesinnung auf die klassische Periode. Kein Grund also, solche Fähigkeiten zu verachten, die durch Beobachten und Kopieren erworben wurden - Letzteres eine Aussage, die besonders den Ingenieuren und IngenieusInnen unter unseren Lesern ein beifälliges Nicken entlocken müsste.
Um zu den Riesen zurückzukehren: Von den Alexandrinern haben wir bereits im ersten Teil der Serie gelesen. Hervorzuheben unter diesen Genies - als nämlich 'traditionsbildend' - wäre noch Heron (von Alexandrien), von dem man nicht einmal mehr die genauen Lebensdaten zu sagen weiß. Der nämlich hat mit den, in seinen Werken 'Pneumatika' und 'Automata' beschriebenen Vorrichtungen die Entwicklung mechanischer, pneumatischer und hydraulischer Automaten der nachfolgenden Jahrhunderte ganz maßgeblich geprägt.
Vielerorts eifrig studiert, diskutiert und mehr als einmal rekonstruiert, inspirierten die Schriften nicht wenige Erfinder und Konstrukteure zu eigenen weiterführenden Entwicklungen. Bis zu Descartes und darüber hinaus befassten sich bedeutende Denker des Abendlandes mit Herons Automaten und sein Heronsball gilt als erster Vorläufer der 'modernen' Dampfmaschine, mit der schließlich der Start in die industrielle Revolution erfolgte ...
Aber ehe es dazu kommen konnte, musste sein Wissen noch allerlei verschlungene und für uns 'Westliche' verborgene Wege nehemen, ehe es unserer Technik Ideen beisteuern und bedeutende Impulse geben konnte. Die große alexandrinische Bibliothek verschwand im Zuge der Wirrungen der nachchristlichen Jahrhunderte, Westrom ging unter, etwas später bedeutete die arabische Ausbreitung den endgültigen Zerfall der allesverbindenden antiken Mittelmeergemeinschaft. Von nun an gab es zwei Welten, die christliche und die islamische, die sich feindlich gegenüberstanden ...
Aber, von uns in Europa gerne übersehen, gab es da noch den Östlichen Teil des Imperiums, der erst Jahrhunderte später dem Ansturm der Osmanen erliegene sollte. Byzanz: Dessen Basileus fühlte sich als Romäer, als rechtmäßiger Nachfolger der römischen Augusti. Unter seiner Herrschaft wurde antikes Wissen bewahrt, blieben Autoren und deren Schriften, die man kopierte, bekannt, wurden darin beschriebene Konstruktionen nachgebaut oder gar verfeinert und verbessert.
Unabhängig voneinander schildern etwa Konstantinos Porphyrogennetos und Liutbrand von Cremona den byzantinischen Kaiserthron als mechanisches, mit singenden Vögel- und brüllenden Löwenattrappen besetztes Wunderwerk. Wie groß gerade das Erstaunen des 'barbaren' Liutprnds, der mehrmals in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts mehrmals als Gesandter des 'Westkaisers' Otto des Großen in Konstantinopel weilte, vor einem solchen technischen Spitzenprodukt sein musste, können wir nur erahnen. Doch gerade solche Berichte und die darin geschilderten 'Wunder' waren es, die den europäischen Blick wieder mehr gegen Osten zu wenden halfen. Und vielleicht sind es auch diese Beschreibungen und Reiseberichte gewesen, die späterhin Autoren zur Schaffung solcher Episoden, wie den wilden Ritt des notorischen Frauenhelden Gawain auf einem Automatenbett inspirierten ...
Heron der Jüngere, auch Heron der Byzantiner genannt, beschäftigte sich intensiv mit dem Errungenschaften seines antiken Namensvettern; so schilderte er auch in einem seiner(um 940 verfassten) Werke, die sich mit so nützlichen Dingen wie Belagerungsmaschinen und ballistischen Prinzipien befassen, auch Automaten, welche auf ähnlichen Mechanismen beruhten wie die des Alexandriners.
Aber es gab noch eine zweite, große 'Lebensader', welche antikes Wissen über die Wirren der Umbrüche hinweg zu transportieren imstande war: Denn unter der im 8. Jahrhundert anbrechenden Herrschaft der abbasidischen Kalifen wurde deren neugegründete Hauptstadt Bagdad für die nächsten 5 Jahrhunderte zu einem der großen Zentren von Bildung und Kultur, das unter anderem das akademieähnliche, sogenannte 'Haus der Weisheit' beherbergte. Dort arbeiteten Menschen verschiedener Konfessionen an der Übersetzung vor allem griechisch-antiker Texte ins Arabische (ein Umstand, der uns manch Originaltexte erhalten hat ...).
Neben Platon, Aristoteles, Galen, Archimedes, Euklids und manch anderen prominenten Namen, findet sich auch der des alexandrinischen Herons und Philon von Byzanz' in der Übersetzungsliste. Deren Schriften wurden zur Grundlage vieler Automaten und auch Uhrwerke, an deren Entwicklung die abbasidischen Kalifen großes Interesse zeigten. Namen wie Abu Musa Jabir ibn Hayyan (8. Jhdt.), der sogenannte 'Pseudo-Archimedes' (9. Jhdt.), Al-Muradi und Al-Khazini (11. Jhdt.) sowie Ridwan Al -Khurasami aus dem 12. Jahrhundert verdeutlichen neben vielen anderen die rege wissenschftliche Tätigkeit auf besagtem Gebiet.
Hervorragend erscheint uns in diesem Zusammenhang aber das 1206 vollendete 'Buch des Wissens von sinnreichen mechanischen Vorrichtungen' des herausragenden Ingenieurs Al-Jazari, in dem dieser viele Automaten - unter anderem Wasseruhren, Musikautomaten und automatisierte Schöpfwerke - auf den Grundlagen der heronschen Erkenntnisse beschreibt und das auch im Westen Bekanntheit erfuhr ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Technologie des MA
Automaten

Automaten im Mittelalter - Teil 1: Eine Einführung
Maschinen zu erschaffen, Automaten, Androiden gar und menschenähnliche Wesen - das stellt einen Menschheitstraum dar, der weit zurückreicht, bis in die Frühzeit der Mythen, in welcher die sumerische Muttergöttin Ninhursanga aus Ton und Speichel Enkidu dem Gilgamesch zum Bruder und Gefährten erschafft. Nicht weniger geschäftig zeigen sich die griechischen Olympier, etwa mit der Kreation der Pandora, bei der ein jeder der Göttlichen seinen Teil beiträgt - und somit Teil eines der ersten bekannten Konstrukteursteams darstellt.
Als besonders umtriebig auf dem Gebiet der Erschaffung humanoider Roboterwesen zeigt sich der Zeussohn Hephaistos, der sich - als göttlicher Schmied und passionierter Bastler mit den nötigen Fähigkeiten begabt -, wann immer es gerade nicht gilt, kampfeswütigen Göttersprösslingen ihre unbesiegbaren Waffen aus der Esse zu ziehen (ein Problem, das übrigens auch moderne Roboterkonstrukteure plagt), in der verbleibenden Zeit gerne mit der Erfindungen ausgeklügelter Gerätschaften und Automaten beschäftigt.
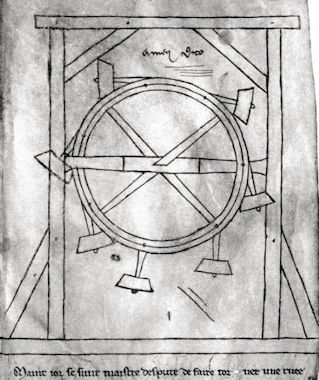
So lässt er den von ihm erschaffenen Bronzeriesen Talos dreimal täglich die Insel Kreta umkreisen - der als ungebärdiger Kerl, welcher Schiffe mit Steinen bewirft und, bis zur Rotglut erzürnt, die trotzdem Anlandenden schon mal in seiner Umarmung verglühen lässt, als frühes Muster eines Kampfroboters gelten kann. Andererseits, bedenkt man das Verhalten mancher Touristen ...
Zur Verteidigung des Hephaistos sei erwähnt, dass er sich nicht nur mit Militärtechnik befasst, sondern auch künstliche Dienerinnen erschafft, die intelligent, handwerklich geschickt und - kennt man die Olympier -, weil ausgesprochen hübsch, wohl auch echte Hingucker sind. Zumindest hätten wir Letzteres so ausgeführt, besäßen wir nur die Fertigkeiten dazu. Solche Fertigkeiten nennt jedoch der zyprische Bildhauer Pygmalion zur Genüge sein Eigen. Mit der Galatea erschafft sich der ausgewiesene Frauenfeind (Feministinnen bitte weghören) sein ganz persönliches weibliches Wunschbildnis, welches dann dank göttlicher Hilfe der Aphrodite zum Leben erwacht ... so ein Glück aber auch!
Dass es nicht immer nur die Götter sind, welche die Kunst des humanoiden Automatenbaus beherrschen, zeigen uns Nachrichten vom genialen kretischen Baumeister und Erfinder Daidalos, der neben manch praktischem Uttensil - man denke nur an die kontaktförderliche Kuhattrappe, die er der Pasiphae bastelte, oder an das verwinkelte Kellerabteil für den, aus diesem Fehltritt resultierenden, bedauernswerten Minotaurus - auch für zahlreiche bewegliche hölzerne Kultfiguren verantwortlich zeichnen soll ...
Mythen, na und, werdet ihr jetzt vielleicht ausrufen! Die gab es schon immer, die sagen nichts über wirklich existente Gerätschaften aus! Allenfalls über Sehnsüchte und Ängste! Nun, dann begebt euch einmal mit uns ins hellenistische, später römische Alexandria. Als Sammelpunkt des damaligen 'Who is who' der Wissenschaften, brachte es mit der sogenannten 'Alexandrinischen Schule' eine Reihe hochbegabter Konstrukteure hervor, die ihre genialen Entwürfe in die Praxis umzusetzen verstanden ...
Namen wie Heron, Ktesibios und Philon von Byzanz schwirren da im Zusammenhang mit Stichwörtern wie automatisch sich öffnenden Tempeltüren, kommerziell verwerteten Weihwasser- und Seifenspendern, schwebenden Streitwägen, sprechenden Orakelstatuen, mit zuflussgeregelten Wasseruhren, Spritzvorrichtungen, mechanisierten Schauspielen, zwitschernden und flügelschlagenden mechanischen Vögeln durch die Luft. Der Heronsball ('Aeolipile') als erste thermodynamische Maschine, die große Bibliothek mit Werken über Pneumatik und Hydraulik, Optik und ...
Und danach? Ein großes Loch, genannt das Mittelalter, in dem jegliches Wissen verschütten, jeglicher Drang nach Verbesserung und Weiterentwicklung unterdrückt wurde, das erst durch die einsetzende Renaissance überbrückt werden konnte, mit Rückgriffen auf die Alexandriner, mit den visionären, technischen Skizzen und manch tatsächlich erbautem Automaten des Leonardo da Vinci? Vollautomatischen Weihnachtskrippen und Galeonen - etwa des Hans Schlottheim - oder ausgeklügeltem automatischem Spielzeug des Juanelo Turriano, dem man sogar den Bau eines Androiden nachsagte, der ihm seine Einkäufe erledigte ...
Mitnichten ein so großes Loch, wie man auf den ersten Blick vielleicht vermuten würde. Denn ein zweiter verrät uns, wie die Einführung der Hemmung die Mechaniker des 'mittleren Zeitalters' zur Erfindung und Entwicklung immer ausgeklügelter Räderuhrwerke animierte, Uhrwerke, die nicht nur die Zeit anzuzeigen verstanden, sondern ganze Schauspiele bewegter Figuren und auch Astrolabien sein konnten ...
Man muss gar nicht nach Byzanz gehen, wo künstliche, sich auf den Thronlehnen aufrichtende Löwen eingeschüchterten Gesandtschaften entgegenbrüllten, oder in den arabisch-islamischen Raum, wo ebenfalls die antiken Werke erhalten blieben und der Automatenbau auf hohem Niveau betrieben wurde. Nein, auch unsere mittelalterlich-eropäische Überlieferung weiß uns von manch Leistung auf diesem Gebiet zu berichten. Dabei denken wir gar nicht an Sage und Volksmund - welche etwa vom tönernen Golem zu erzählen wissen, oder vom künstlichen Klosterbruder des Albertus Magnus, der Reisende an der Pforte nach ihrem Begehr fragte .
Genannt seine hier nur die Skizzensammlung des Villard de Honnecourt aus dem 13. Jahrhundert, hundert Jahre später die erste italienische 'Technologiehandschrift' des Giovanni de Fontane oder auch den Werken des Regiomontanus, dem die Konstruktion von Automaten - schon vor Leonardo - in Form eines künstlichen Adlers und einer eisernen Fliege zugeschrieben wurde ...
Grund genug, wie wir meinen, um diesen und noch weiteren Persönlichkeiten und den von ihnen geschaffenen Entwürfen, Maschinen und Automaten einen genaueren Blick in Form einer kleinen Serie zu widmen, was in nächster Zeit an dieser Stelle erfolgen soll. Lasst euch also überraschen ...
Weiter zum zweiten Teil der Artikelserie.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Redensarten
und Handwerk

Alte Redensarten: Egal, mit wem du unter einer Decke steckst, musst du dich stets nach derselbigen strecken, ...
... denn ansonst kann es schnell vorkommen, dass dir um Füße und Zehen ein eisiger Nachtwind weht. Doch erfahrene Leser unserer Wissensrubrik ahnen längst, dass hinter dergleichen Formulierungen meist mehr steht als nur der wörtliche Sinn - handelt es sich doch bei der Aussage, man habe sich 'nach der Decke zu strecken' wieder einmal um eine alte Redensart, die uns, bezugnehmend auf einstige Sitten, Vernunft anmahnen und belehren will.
Vorab sei aber allen jenen - vorwiegend groß gewachsenen - Zeitgenossen, denen Stund um Stund die Decke ihres viel zu engen Zimmerchens auf den Schädel zu fallen droht, Folgendes gesagt: nicht jene harte, steinerne Begrenzung ist gemeint, gegen die euer Kopf stets zu stoßen droht, nein, wir sprechen hier von der gänsedaunengefütterten, wohlig weichen, kuschelig unsere müden Gliedern schmeichelnden Bettgenossin, in deren wärmender Umarmung wir des Winters Härte vergessen.

Doch ach, wenn ihr arme Schlucker seid, Hungerleider, deren Decke nicht aus Seide ist, deren Fülle nicht auch Schnatterflaum, und ihre Größe dergestalt, als wärt ihr mit ihr schon vier Mal vor die Stadt geritten, um sie mit scharfem Schwert zu zerteilen und mit dem dortigen Bettelvolk christlich zu teilen. Dann nämlich kann euch geschehen, wovor schon Thomas Murner in seiner 'Narrenbeschwerung' zu warnen weiß:
'...
Des nym war vnd acht der decken,
Das du dich wißt darnach zu strecken.
Es stundt gar kalt in dynem huß,
Streckstu die füß zur decken vß.
...'
Wie jedes Sprichwort, vermittelt uns jedoch auch dieses eine tiefere Bedeutung - denn es meint uns, wir möchten nicht über unsere, vielleicht bescheidenen, Verhältnisse leben - eine Weisheit, die wohl in allen Epochen ihre Gültigkeit hatte und noch haben wird. Wie immer im Leben wird sich der Reichem jener, der eine große Decke besitzt, ungehemmt räkeln und strecken können, während der mit der kleinen sehen muss, wie er alle Glieder unterbringt, ohne dass ihm der Frost daran nagt ...
Apropos Bettgenossin: Wenn ihr nun fragt, ob nicht ein süßes Mägdelein in langen Nächten den Raureif zu vertreiben vermag, indem ihr zu zweien 'unter einer Decke steckt', dann lasst euch gesagt sein, dass solch Unterfangen ein ohnehin schmales Tüchlein nochmal enger werden lässt. Doch wir wollen's euch nicht verwehren; ...
... allenfalls ein wenig warnen. Rührt doch letzteres geflügelte Wort von einem vielerorts geübten mittelalterlichen Brauch, der uns in Retrospektive sehr romantisch anmutet: Nachdem nämlich die frisch Vermählten mehr oder weniger ungeduldig den festlichen Tag überstanden hatten, wurden sie des Abends von Eltern, Verwandten und Vertretern des Klerus zum ehelichen Bett geleitet und dorthinein gebettet und zugedeckt ... samt Segen und wohl auch einigen guten Ratschlägen der Muhmen, Basen und Vettern (wozu hat man schließlich die liebe Verwandtschaft ...)
Unter einer Decke stecken, meint also zuerst (Aufgehorcht, ihr Schurken!!) die liebe Ehegemahlin! Mit ihr 'im Bunde sein' - später aber auch, mit anderen sich gleichgesinnt zu wissen und zu vertragen. Wissen doch auch die höfischen Epen von der Übernachtung der Helden zu zweien im Bett, dann, wenn es galt, großen Trupps Gastfreundschaft zu gewähren, sie zuerst zu verköstigen, zu unterhalten und anschließend zur nächtlichen Ruhe zu betten (tunlichst fernab der eigenen Töchter).
Galt es dann zwar vielleicht, heldenhaft das ritterliche Schnarchen an der Seite zu ertragen, blieb doch die rechtliche Konsequenz aus, welche die erste Nacht im gemeinsamen Bett mit der Frischangetrauten mit sich brachte. Denn viele Rechtsregeln und -sprüche aus alter Zeit verdeutlichen, wie erst diese gemeinsame 'im Bett liegen' als Beginn der Ehe mit allen rechtlichen Folgen aufgefasst wurde:
'Ist das Bett beschritten, ist das Recht erstritten', schreibt Pistorius. Und der Sachsenspiegel klärt uns folgendermaßen auf: 'it wif trit in mannes recht, swenne si in sin bede gat', also tritt die Vormundschaft des Gatten über seine Frau erst mit dem Betreten des Bettes in Kraft ... hmm, und heute ... Vormundschaft des Mannes, sobald er und sie ... aber gut, das ist wieder eine andere Sache ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Reisen im Mittelalter
Schifffahrt

Mittelalterliche Schifffahrt 1 - ein gefährliches Unterfangen
Reisen stellten bis tief in die Neuzeit hinein gefährliche Unterfangen dar. Dies galt in besonderem Ausmaß dann, wenn das anvisierte Ziel Fahrten über See bedingte. Einer See, die an einem Tag, von Unwettern erregt meterhohe Wogen über ächzenden Planken ebenso zusammenschlagen lassen konnte, um in den folgenden Wochen als endlos glatte, von keinem Windhauch bewegte Oberfläche zum qualvolen Ort des Verdurstens zu werden.
Auf dem Meer bedarf es jedoch gar nicht erst extremer Wetterbedingungen, um in Not zu geraten. Alleine das Fehlen zuverlässiger, von der Witterung unabhängiger Navigationsmittel machten die Seefahrt über Jahrtausende hinweg zum riskanten, nicht selten langwierigen Abenteuer. Gewiss gab es die Sonne, die tagsüber eine Bestimmung der Richtung ermöglichte und - über die Messung der Sonnenhöhe - den Breitengrad, es gab nächtens die Sterne, es gab über Generationen gesammelte Erfahrungen über Strömungen und Winde, Landmarken, die anzusteuern waren ....
Zahlreich die Gefahren, die einem Reisenden begegnen konnten: Die primitiven, anfänglich ungedeckten Schiffe boten kaum Schutz gegen Sonnenglut und Regen. Sowohl sarazenische als auch 'christliche' Piraten lauerten, insbesondere in Zeiten, in denen keine starke Zentralgewalt wie früher die römische, Sicherheit auf den Meeren garantierte. Hunger, Durst. Mangelerscheinungen. Dazu noch die zahllosen Seeungeheuer, die zu jenen Zeiten die Meere bevölkerten. Wen wundert's, dass das Aufsuchen der zahlreichen Schutzheiligen für die Seefahrt zu den wichtigsten Resevorbereitungen zählte.

Und wenn man einen möglichen Schiffbruch strandend überstanden hatte, konnten die Überlebenden immer noch Strandräubern zum Opfer fallen, was sie im günstigeren Fall die Habe, im ungünstigeren auch das Leben kosten konnte (speziell dort, wo geltendes Strandrecht den Küstenbewohnern nur dann das Treibgut zusprach, wenn es keine Überlebenden des Schiffbruchs mehr gab ... da mag schon das eine oder andere Signalfeuer zur gefährlichen Klippe statt zum sicheren Ankerplatz geleitet haben!)
Sonne und Sterne als Hauptorientierungshilfen! Doch was, wenn Nebel und Bewölkung die Sicht auf die Gestirne verbarg? Wenn unvorhergesehene Strömungen vom Kurs abtrieben, wenn Stürme jegliches Wissen über den aktuellen Standort verwirbelten, jegliche Kontakt mit bekannten Küsten abbrechen ließen? Nicht auszuschließen, dass derartige Ereignisse manchesmal zur Entdeckung unbekannter Eilande führten - man denke nur an die Reise des Heiligen Brendan -, mit Gewissheit jedoch wesentlich häufiger zu Schiffbruch und Tod.
Wen wundert es, dass sich die Seefahrt in den Anfängen zumeist in Landnähe abspielte - man reiste nach Möglichkeit im Konvoi, in Sichtweite der Küsten, immer ein markantes Wahrzeichen im Blickpunkt, Felsen, Klippen, später auch Leuchttürme und Kirchtürme; zu Abend legte man an, zog die Kiele an den Strand, suchte frisches Wasser und wenn vorhanden Obst, entfachte die Kochfeuer und schlief auf sicherem Boden.
Der wichtigste Mann an Bord war der Steuermann. Von seiner Erfahrung war man abhängig, von seiner Vertrautheit mit der Natur. Wolken und Wind kündigten Wetterumschwünge an, es galt Flora und Fauna zu beobachten, Eigentümlichkeiten des Wassers wie Farbe und Salzgehalt, treibende Pflanzen, Fischarten. Vielfach waren es auch Vögel, welche Landnähe verrieten und deren 'Aktionsradius' man aus vielerlei Beobachtungen kannte.
Zumindest bis ins zweite vorchristliche Jahrtaustend zurück reicht die Praxis, Vögel auf der Fahrt mitzuführen und sich durch diese die Richtung zum nächstgelegenen Eiland weisen zu lassen - recht bekannt aus der biblischen Sinfluterzählung, welche schildert, wie Noah zuerst den Raben, dann die Taube losschickt, um solcherart nach Festland zu forschen.
Ein einfaches, nichtsdestotrotz wichtiges Hilfsmittel stellte (bis in die jüngere Vergangenheit hinein, wo es zunehmend durch das Echolot abgelöst wurde) das Lot dar, Leine und daran befestigtes Gewicht, mit dessen Hilfe man die Wassertiefe bestimmen und - bei geeigneter Ausführung - auch Proben des Meeresbodens nehmen konnte, was bei ausreichend Erfahrung wiederum gewisse Rückschlüsse auf die Position ermöglichte. An fremden Küsten und zwischen unbekannten Inselwelten wird man dagegen um die Hilfe einheimischer Lotsen - sofern vorhanden - nicht umhingekommen sein, wie der arabische Reisende Ibn Battuta über die Malediven berichtet.
Segelanweisungen, wie sie in schriftlicher Form in der Antike gebräuchlich waren und wie wir sie auch in isländischen Sagas finden, sind zuvor über lange Zeiträume mündlich überliefert worden und bleiben selbst im Spätmittelalter und bis hinein in die frühe Neuzeit, als wiederum schriftliche Fixierung gebräuchlich wird (1541 entsteht eine erste gedruckte Segelanweisung), von Bedeutung. Schließlich fanden sich selbst im 16. Jahrhundert noch unter den Steuerleuten der portugiesischen Ostindienfahrer zahlreiche Analphabeten - des Lesens unkundig, doch mit einem phänomenalen Fachgedächtnis ausgestattet.
Dagegen weiß Marco Polo in seinen Reiseberichten bereits im 13. Jahrhundert von 'klugen Seeleuten' im großindischen Raum zu berichten, 'die jene Meergebiete befahren' und Inseln beschrieben und auf Karten eingezeichnet haben.
Brachten also die Veränderungen der Völkerwanderungszeit in manchen Bereichen der Seefahrt einen Rückschritt - nicht in allen, wenn man die gewagten Reisen der Wikinger in Betracht zieht -, so brachte das Hochmittelalter eine Reihe von Entwicklungen mit sich, deren Einführung erst die Expansion der europäischen Völker an der Wende zur Neuzeit ermöglichen sollte. Als prominenteste dieser technischen Neuerungen sei der Kompass erwähnt, mit dem wir uns in weiterer Folge befassen werden ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Reisen im Mittelalter

Reisen im Mittelalter 1 - Reit-, Transport- und Zugtiere: Der Esel ...
Reisen gestalteten sich im Mittelalter bekanntlichermaßen weitaus weniger komfortabel als dies heute der Fall ist, wo wir mit einem solchen Ereignis zudem überwiegend angenehme Begriffe wie Sonne, Strand, Meer und - wie es zumindest die männlichen Mitglieder von Sælde und ere tun - blütenbekränzte Hulamädchen assoziieren. Urlaub also, Bildungsreisen, oder allenfalls eine geschäftliche Verabredung ins 12 Stunden entfernte Singapur, egal ob nun im Sommer oder als Flucht aus den schneekanonenverschneiten Alpen.
Welche Wandlungen das Reise- und Verkehrswesen mit dem Zerfall des (west-)römischen Imperiums und der damit einhergehenden Wandlung der okkzitentalen Welt erfuhr, darüber werden wir uns an anderer Stelle dieser Serie über das Reisen auseinandersetzen. Mit 12 Stunden war es da kaum einmal getan - eher werden's Tage, ja Wochen oder Monate gewesen sein.
Vorerst genügt es uns aber zu sagen, dass der größte Teil der mittelalterlichen (Land-)Bevölkerung in seiner Bewegungsfreiheit ohnehin auf die nächste Umgebung des heimatlichen Dorfes eingeschränkt blieb - und das oftmals ein Leben lang. Vielleicht war da noch der Weg zum Markt zu tun oder zum Verwalter des Gutsherrn, um die Abgeben zu erledigen, aber darüber hinaus blieb die Welt eine fremde.

Dennoch versiegte die Reisetätigkeit niemals zur Gänze - selbst nicht in jenen wirren Jahren des Umbruches, welche die Völkerwanderung und der Aufstieg des Islam mit sich brachten. Es galt Botschaften zu überbringen, Gesandtschaften auszutauschen, das Königtum war ein Reisekönigtum, stets gab es einen Austausch zwischen den Klöstern und auch der Fernhandel kam nicht vollständig zum Erliegen. Und dann war da noch fahrendes Volk, jene, die Strafen zu entfliehen suchten, später die Studenten, manch Kaufmann ...
Die meisten dieser Reisenden mussten sich allerdings mit 'Schusters Rappen' begnügen, waren also zu Fuß unterwegs. Wägen und komfortable Kutschen, wie sie in römischer Zeit in Gebrauch gewesen waren, konnten alleine schon wegen des (zumindest nördlich der Alpen) rasch verfallenden Straßensystems nicht mehr zum Einsatz kommen. Zurück blieben in vielen Landstrichen die Wasserstraßen, schlecht markierte Wege. Saumpfade.
Pferde waren ein teures Gut, das sich nur Wenigsten leisten konnten. Billiger und somit für einen größeren Kreis von Reisenden erschwinglich, waren die Saumtiere: der Esel, das Maultier, als Züchtung von Eselhengst und Pferdestute, und der Maulesel, als Abkömmling von Pferdehengst und Eselsstute. Zugleich waren diese Tiere für manche Routen, manche Aufgaben auch besser geeignet, auch wenn sie Rössern in der Leistungsfähigkeit deutlich unterlegen sind.
Ursprünglich im heißen Klima Arabiens und Nordafrikas heimisch, dürfte die Domestizierung des Esels im vierten vorchristlichen Jahrtausend erfolgt sein; als Karawanentier wird er jedenfalls bereits im dritten Jahrtausend erwähnt. Ob seiner nützlichen Eigenschaften verbreitete er sich bald nach Asien und über den Mittelmeerraum auch ins nördliche Europa. Genügsamer und somit billiger in der Haltung - Disteln und Stroh reichen ihm - und trittsicherer als das Pferd, konnte er auch auf solch engen, abschüssigen Gebirgspfaden eingesetzt werden, auf denen sein großer Vetter nicht mehr zu gebrauchen war. Zudem war der Esel Krankheiten gegenüber widerstansfähiger.
Dabei wurde er vornehmlich als Pack- und auch auch Reittier eingesetzt - da er kleiner als das Pferd ist, ist er auch leichter zu besteigen, eine Tatsache, die insbesondere Frauen, Kindern, Älteren zugute kam -, kaum jedoch als Zugtier. Etwa 150kg Traglast kann ein silcher Esel verkraften - was dem Gewicht eines Menschen und noch einigen Packen zusätzlicher Ladung entspricht.
Der Ruf, dem das Mittelalter unserem hier vorgestellten Grautier gab, war ein zwiespältiger - was wohl auch dem Verhalten solcher Eselstiere zuzuschreiben ist, die neben Zuverlässigkeit stets auch eine ordentliche Portion Störrigkeit zu bieten haben. So galt er als Symbol für die Laster Eifersucht, Geiz, Dummheit und Trägheit. Zugleich konnte er auch für die Tugenden Beharrlichkeit, Geduld, Demut, Enthaltsamkeit und Gehorsam stehen. Nicht umsonst finden wir ihn in den mittelalterlichen Darstellungen der Geburt Christi, als getreuer Helfer, der die Heilige Familie nach Ägypten trägt, oder auch als Reittier Jesu, das diesen nach Jerusalem trägt.
Manchem Heiligen ist er als Attribut beigefügt; wer gut genug ist, Jesus zu tragen, eignet sich auf alle Fälle für den Kleriker als Reittier - so diente er Anhängern der mitterlichen Armutsbewegung anstelle des Pferdes, soferne die nicht überhaupt zu Fuß gingen. Andererseits charakterisieren des Esels Ohren Ketzter, später auch Narren, und musizierende Grautiere symbolisieren in der romanischen Plastik Unvernunft und geistige Trägheit.
Maultier und Maulesel sind noch ein Stück robuster, wobei das Maultier größer und stärker ist als der Maulesel, in seiner Leistungsfähigkeit dem Pferd gleicht, diesem jedoch hinsichtlich Ausdauer, Genügsamkeit, Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten, Trittsicherheit, Lebensarbeitszeit überlegen ist und somit vor allem als Arbeitstier wohlhabender Kaufleute in Erscheinung tritt. Schwer beladen, waren es das Maultier und der Esel, welche in langen Kolonnen Waren über die Alpenpässe schleppten.
Natürlich wusste auch der Volksmund schon zuzeiten manches über den manchmal eigensinnigen grauen Gesellen zu berichten. Etwa, wie er ob seiner Trägheit so lange säumte, die Arche zu besteigen, bis Noah endlich der Kragen platzte und er ihm einen Tritt in den Allerwertesten versetzte. Ach ja - Volksmund eben: Wer denn gerade an Zahnschmerzen leidet, der mag nur getrost einen Esel küssen (oder zum Zahnarzt gehen ...) auf dass sein Leid verfliege ...
Setzt ihr dagegen euren Sprössling auf einen Esel, dann wird er rasch das Laufen lernen. Aber natürlich gibt's dabei einen Eselsfuß: Besagter Sohnemann oder besagte Tochter wird dann im weiteren Leben nicht eben von großer Intelligenz geplagt sein ... Dass fast jegliche Eselsinnerei für diverse Zauber nützlich sei - etwa soll sich das Gehirn trefflich für liebeszauber eignen -, braucht hier unseren magiekundigen Lesern nicht extra gesagt werden.
Die zwiespältige Eselsnatur kommt schließlich einmal mehr in den Vorstellungen, der Esel wäre ein dämonisches Tier, ja, in Gestalt eines Dreibeiners sogar der Teufel selbst, sowie - konträr dazu - in dem Glauben, die Begleitung eines Esels könne an 'teuflischen Orten' vor dem Bösen bewahren, zum Vorschein ...
Weiter zum zweiten Teil der Artikelserie.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Gesellschaft im Mittelalter

Lesestein, Lupe und Lesebrille - eine mittelalterliche Erfindung ...
Letztens starten wir in dieser Rubrik mit dem ersten einer Reihe von Artikeln, welche die mittelalterliche Symbolik von Farben zum Inhalt haben sollen. Zur Beschäftigungen mit einer solchen Thematik ist das Studium von Textquellen unumgänglich. Nun neigen manche von uns dazu, dem zunehmenden Alter mit einer gewissen Sehschwäche Tribut zu zollen (was uns nun, im Frühjahr, wo die Mägdelein den Lenz in leichter Gewandung begrüßen, besonders schwer ankommt ...), welches einer solchen Beschäftigung abträglich wäre, wenn nicht ...
... ja, wenn wir nicht dem Hochmittelalter eine Erfindung zu verdanken hätten - demselben Mittelalter also, das von Vielen gemeinhin als das dunkle, stets und ausschließlich nur rückständige, dem Schlagen, Hauen und Stechen verpflichtete, betrachtet wird - die Erfindung der Lesehilfe in Form von Brille, Lupe, Augenglas, Sehstein, usw. Also wollen wir uns, bevor wir mit der Farbsymbolik fortfahren, erst mit der Herkunft dieser so praktischen Hilfe befassen, die es uns erst ermöglicht, all die wunderbar kolorierten Details in den Handschriften zu erkennen.
Sollte Solches möglich sein, wird der eine oder andere fragen, dass einmal zur Abwechslung nicht die Antike als Ursprung gelten kann für eine sinnvoll zu gebrauchende Entwicklung? Genauso scheint es sich aber unserem Wissen nach zu verhalten. Denn weder in Europa noch anderen Regionen lässt sich vor dem 13. Jahrhundert die Verwendung von Sehhilfen nachweisen. Zwar gibt es Fundstücke antiker Linsen, doch die scheinen ausschließlich als Schmuckstücke Verwendung gefunden zu haben - jedenfalls existieren keine bekannten Quellen, die etwas anderes nahelegen würden.

Chinesische Gläser wiederum sollten, vor die Augen gehalten, als Form von 'Steinmedizin' helfen, Augenkrankheiten zu heilen. Ebensowenig kannten die Römer die Brille - so beklagt sich etwa Cicero in vorangeschrittenem Alter, dass er wegen seiner Sehschwäche nicht mehr lesen und schreiben könne.
Was der Antike bekannt war, war jedoch die vergrössernde Wirkung wassergefüllter Glaskugeln, wie von Claudius Ptolemaeus im 2. nachchristlichen Jahrhundert beschrieben. Diese Wissen wiederum gelangte an die Araber, wo um 1000 n.Chr. Ibn al-Haitam (im sogenannten Thesaurus Opticus) ein gläsernes Kugelsegment als mögliche Sehhilfe postuliert. Seine Schrift liegt dem Abendland seit der Mitte des 13. Jahrhunderts als lateinische Übersetzung vor.
Im Klosterleben mit seinen vielfältigen künstlerischen und wissenschaftlichen Tätigkeiten stellte das Lesen und Schreiben das tägliche Geschäft vieler Mönche dar. Dass in einer solchen Umgebung ein Nachlassen der Sehkraft als besonders großes Übel empfunden werden musste und derart starke Anreize zur Entwicklung praktisch anwendbarer Sehhilfen gegeben waren, ist nachzuvollziehen. Und so meinte man auch lange Zeit die eigentliche Erfindung der Brille - als die Umsetzung eines theoretischen Kozeptes in ein alltagsgebräuchliches Hilfsmittel nach Norditalien verorten zu können, in irgendein Kloster des späten 13. Jahrhundert, ohne dass man einen Erfinder mit Namen hätte benennen könnte.
1305 erwähnt der Dominikanermönch Giordano da Rivalto die angeblich erst wenige Jahre zurückliegende Erfindung der Brille; Erlässe des Rats von Venedig (1300, 1301 und 1319) regeln Einzelheiten der Herstellung und des Verkaufs von sogenannten Lesesteinen ('lapides ad legendum') und Lesegläsern, also Brillen ('vitreus ab oculis ad legendum').
Andererseits scheint die norditalienische Herkunft nicht mehr unumstößlich zu sein, ja, wir meinen sie als eher unwahrscheinlich annehmen zu können. Findet sich doch im lateinischen Vokabular 'De Nominibus Utensilum', das der Englische Gelehrte Alexander Nequam vermutlich um 1180 in Paris verfasst hat (und somit um ein Jahrhundert früher als obige Ereignisse datiert sind!), eine 'Einkaufsliste' für ein mittelalterliches Skriptorium zum Zwecke des Schulgebrauchs.
Darin benennt er neben den vielen bekannten Utensilieren, deren es in der Schreiberwerkstatt bedarf, auch 'cavillam et spectaculum', damit nicht 'durch Unsicherheit wertvolle Zeit verloren' würde. Beide Begriffe sind um 1200 in anderen Quellen als Lupe und Vergrößerungsglas belegt. 1230 beschreibt dann Robert Grosseteste vermutlich erstmalig explizit die Funktion des Vergrößerungsglases, Entferntes näher an das Auge zu holen. Drei Jahrzehnte später weist dann Roger Bacon auf die Bedeutung der Vergrößerungsgläser als Hilfen beim Lesen. Vermutlich ist also nicht die Toskana als Geburtsort des Augenglases anzusehen, sondern vielmehr eine unbekannte Örtlichkeit im nördlichen Europa, vielleicht in Frankreich, die im Zusammenhang mit der Produktion von Handschriften stand ...
Die in den Beschreibungen gebrauchten Begriffe 'cavilla' und 'spectaculum' scheinen die, auch in Abbildungen wiederzufindende Unterscheidung zwischen der mit einer Hand zu haltenden Lupe, dem sogenannten Einglas, und der vor dem Auge in Art der Brille befestigten Sehilfe wiederzugeben. Ursprünglich wurden wohl die zuerst entwickelten Eingläser mit einem Niet zur Nietbrille zusammengefügt, die man sich vorerst vor die Augen hielt (wie dies auch in Abbildungen bezeugt ist) oder auf die Nase klemmte. Erst später scheinen dann zusätzlich angebrachte Bügel die Hand für andere Aufgaben entlastet zu haben.
Nebst unterschiedlich gefertigten Brillenfassungen (Bügel-, Leder- und Drahtbrille) brachte das Voranschreiten der Zeiten im 15. Jahrhundert zu den bislang gebräuchlichen Konvexlinsen für Kurzsichtige höchstwahrscheinlich auch die Entwicklung von konkaven Linsen zu Zerstreuungsgläsern für Weitsichtige mit sich. Jedenfalls erwähnt Nikolaus von Kues einen konkaven Beryll (jenem Edelstein, aus dem die frühen Brillen geschliffen wurden und der der Brille auch den Namen gab).
Und die Aventiurenliteratur? Nun, dort findet sich bereits im 'Jüngeren Titurel', dessen Entstehungszeit auf ungefähr 1270 zu datieren ist, die Zeile 'Sam der berillus grozzet die die schrift ...' ('Wie der Beryll die Schrift vergrößert ...). Es gibt also seit diesem Zeitpunkt also auch Hoffnung für den kurzsichtigen Rittersmann - den man heutzutage mit modischer Brille auf manch Mittelalterfest ja auch antreffen kann ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Mittelalterliche
Symbolik
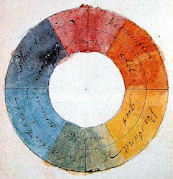
Symbolik in den mittelalterlichen Texten - eine Einführung
Es gibt eine Menge von Gründen, warum die Beschäftigung mit mittelhochdeutscher Literatur lohnend sein kann. Lohnend ist! Was sollte man dem Lesebegeisterten an dieser Stelle noch groß von den Gründen sprechen, die wir an anderer Stelle bereits ausgiebigst hervorzuheben suchten? Von der Schönheit der zumeist gereimten Texte, die sich nur im Original erschließen kann und in jeder Übertragung zwangsläufig genauso verlorengehen muss wie die Seele eines Gedichts bei Nacherzählung des Inhaltes in Prosa?
Von den Geschichten und Mythen, zu denen der Leser in diesen Quellen Zugang erhält - und die einem jeden Autor phantastischer Erzählungen unerschöpflicher und ungefilterter Quell sein könnten, abseits von Spitzohren und vollbusigen, kurzberockten (gut, diese beiden Punkte sprechen jetzt nicht wirklich zwingend gegen solche Klischees, eher dafür ...), ihre Schwerter überkreuzt am Rücken tragenden, vor Kraft und zugleich Liebreiz strotzenden Kriegerinnen? Der ersten derartigen Erzähler? Tolkien? Scott, Poe, Hoffmann? Tieck, Novalis? Mitnichten! Heinrich von Türlins lässt mit seiner Crone manch modernen Schreiberling alst aussehen, was überbordende Phantasie betrifft ...

Zugleich gibt es einige Umstände, die die Beschäftigung mit den originalen Texten erschweren; manch Umstand, wie etwa die Fremdartigkeit der Sprache - immerhin tut sich in 800 Jahren einiges, eyhh Mann, Alter! -, manch Umstand also liegt dabei klar auf der Hand; wobei vieles von dieser Fremdartigkeit auf ungewöhnliche Schreibung und Aussprache zurückzuführen ist, ein Umstand, der zumeist rasch zunehmender Gewöhnung und Bekanntheit weicht, ähnlich wie es uns ja mit erst völlig fremd klingenden Mundarten ergeht, wenn wir uns nur einige Zeit in ihrem Umfeld bewegen und dabei immer mehr Vertrautes feststellen.
Andere Schwierigkeiten liegen nicht so klar auf der Hand: Bedeutungswandel, der aus uns vermeintlich Bekanntem 'falsche Freunde' macht (hochgezît, wîb, ...). Stark veränderte soziale Umstände, die uns nicht mehr unmittelbar zugänglich sind, auf die jedoch (natürlich) nirgendwo in den Erzählungen erläuternd eingegangen wird, waren doch die Gegebenheiten dem Zeitgenossen selbstverständlich. Veränderte Denk- und Sichtweisen, ethische Normen, Lebensrhythmen ...
Zudem haben wir es immer auch mit Zitaten zu tun, Anspielungen, Hinweisen auf (antike) Autoritäten, auf Bibelstellen, auf zeitgenössische Persönlichkeiten und Ereignisse und dergleichen mehr. Und stets ist auch Symbolik im (literarischen) Bild. Die zu kennen, das setzen die mittelalterlichen Künstler und Autoren bei ihrem Publikum ebenso voraus, wie der heutige Regisseur, der den berühmten angebissenen Apfel ins Bild rückt, bei seinem, dass es nämlich den Firmennamen erkenne ...
Gesten, die ihre Bedeutung nicht an sich, sondern erst im Zusammenhang mit dem Gesamtensemble der Darstellung erhalten, Gegenstände und Lebewesen, deren Erscheinen im jeweiligen Kontext unterschiedlich zu deuten ist (das Einhorn als Symbol der Maria, aber auch als teuflisches Tier, die Lilie als Symbold der Reinheit, aber auch der Fleischeslust, ...) - ein Umstand, der uns Heutigen ebenfalls bekannt ist: So können wir beispielsweise einen kühl intellektuellen, bleichhäutigen Vulkanier stets von einem kühl intellektuellen, bleichhäutigen Jackson-Elben unterscheiden - obwohl doch beide spitze Ohren tragen, ein Umstand der in manchen Zirkeln zu ausgiebeigen Diskussionen Anlass geben soll! - selbst dann, wenn sich Mr. Spock einmal mittels Holodeck in Mittelerde einklinkte ... obwohl, so ganz sicher ...
Alles das sind Schwellen, die es zu überwinden hieße, wollten wir Texte bzw. Kunsterzeugnisse einer anderen Zeitepoche zur Gänze verstehen (soferne man Kunst überhaupt zur Gänze 'verstehen' kann); vielfach ist das aber gar nicht (mehr) möglich, alleine das Wissen darum hilft uns aber, allzu voreilige Schlussfolgerungen zu vermeiden. Anderes wiederum lässt sich doch noch erschließen - und um solches wollen wir uns hier in nächster Zeit in einigen Artikeln annehmen.
Über Gestik haben wir an anderer Stelle bereits gesprochen; hier wollen wir eine neue Reihe über die Symbolik öffnen und dabei jeweils einem besonderen Aspekt je einen Beitrag widmen, einem bestimmtem Tier, Gegenstand aber auch solch größeren Begriffsgruppen wie Farben, Stoffen - immer in bestimmten Zusammenhängen, und uns Gedanken über die Bedeutungen machen, die sich aus dem Auftauchen ergeben ...
Beginnen werden wir die Reihe demnächst mit den Farben und ihren Bedeutungen. Und zwar, recht zur beginnenden Frühjahrszeit, im Zusammenhang - womit wohl? - mit der Minne, natürlich! Auf dass ihr dann die Signale recht zu verstehen wisst, wenn ihr durch das Zwitschern der vogelîn spaziert, und die Wangen der hübschen Mägdelein zart erröten bei eurem Passieren und Flanieren ....
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Redensarten
und Handwerk

Alte Redensarten: Wenn einer, dem etwas über die Leber gelaufen ist, deswegen etwas auf dem Herzen hat ...
... dann muss es sich dabei nicht zwingend um ein bedauernswertes Unfsallopfer handeln, dem, ob des Anblicks der vielen großen und kleinen Krabbeltiere, die sich anschicken, seinen geöffneten Bauchraum zu inspizieren, die Aufregung im Zusammenspiel mit einem angeborenen Herzleiden Ungemach bereitet. Denn, es handelt sich bei obigen Formulierungen, wie du, erfahrener Leser, längst schon erahnen wirst, wieder einmal um Redensarten, die, in alte Zeiten zurückreichend, meist nicht wörtlich zu nehmen sind.
Doch diesmal wollen wir uns nicht einem einzelnen solchen Spruch widmen, sondern einer ganzen Gruppe davon, deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass sie sich unserer Innereien annehmen. Ihr wisst schon, das sind diese glitschigen Dinger, die wir inwendig stets mit uns herumtragen, deren Anblick in manchem (oder mancher) sogar Ekel auslöst - die uns aber ungeachtet ihres Aussehens einigermaßen nützlich sind, wie ich mir von einem befreundeten, sehr kompetenten Medizinstudenten versichern ließ.
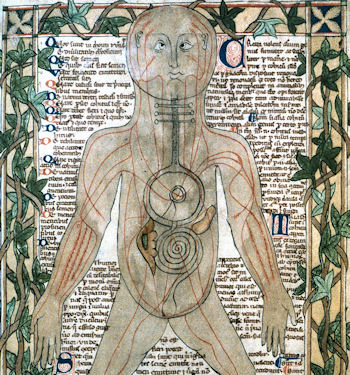
An dieser Stelle möchte ich betonen, dass man im medizinischen Bereich sehr sorgsam sein sollte mit der Auswahl seiner Berater und Ärzte, ja, dass man einen solchen zuerst 'auf Herz und Niere prüfen sollte', ehe man sich unter die Obhut seiner Skalpelle begibt. Das scheint uns nur recht zu sein, wo doch schon die Bibel erwähnt, dass der Herr selbst - '... der du die Gerechten prüfst, Nieren und Herz durchschaust ... (Jeremia, 20,12)', solches betreibt, ja nachgeradezu dazu aufgefordert wird, solches zu tun : 'Prüfe mich, HERR, und erprobe mich, erforsche meine Nieren und mein Herz! (Psalm 26,2)'.
Doch halt, entgegnen wir jenen unter euch, die jetzt meinen, den Herrn solcherart mit ihrem Internisten vergleichen zu dürfen, wo doch jener genau das selbe mit ihnen betreibt. Das ist natürlich im Alten Testament so nicht gemeint. Ehrlich, bei solchen dümmlichen Interpretationen geht uns stets 'die Galle hoch'! Man muss schon ein wenig genauer in die Texte hören, nicht bloß sie wortwörtlich auslegen.
Doch was könnte die Ursache sein, unsere inneren (und nicht nur die) Organe so häufig in Vebindung gebracht zu sehen, mit Empfindungen wie Liebe, Mut, Ängstlichkeit? Nun, einerseits wissen wir selbst, wie sehr uns dauernder Ärger 'an die Nieren gehen kann', plötzlicher übermäßiger Stress unser Gedärm beunruhigen und Liebeskummer (ja, ja, wir erinnern uns - irgendwann im letzten Jahrhundert - oder war's früher?) unser Herz schier zum Bersten ... Und dass der Volksmund ein feiner Beobachter und auch veritabler (wenn auch nicht immer feinzüngiger) Formulierer solcher Zusammenhänge sein kann, durften wir ja schon in mehreren Beiträgen verdeutlichen (Die ewigen Nögler, die das besteiten wollen, sollen uns jetzt nur nicht 'auf den S*ck gehen' mit ihren Einwänden!)
Andererseits reicht manches davon ins Mittelalter und darüber hinaus zurück - wir haben ja bereits biblische Zitate angeführt. Aber auch - wie auch nicht - griechische Einflüsse finden sich, Galen und die Viersäftelehre, Aristoteles, ... - welche den verschiedenen Organen Empfindungen zuweisen. Dies durchaus nicht in übereinstimmender Weise (war doch etwa nach platonischer Ansicht das Gehirn Ort des Denkens während Aristoteles für das Herz plädierte ...). Wir modernen Romantiker würden vielleicht den Streit salomonisch so enscheiden, als dass wir dem Gehirn zumeist den Vorang gewähren - außer in jenen (Liebes-)Situationen in den das Herz (sprich die Gefühle) die Führung übernehmen. Manchmal unter Ausschaltung des Intellekts ....
Um vielleicht speziell auf das Mittelalter zu sprechen zu kommen: Dem galten etwa die Nieren (wie allgemein die Innereien) als Heimat der Gemütsbewegungen (so sagt etwa Luther 'Meine Nieren sind froh' - und meint damit seinen Gemütszustand und nicht die beiden Filterteile ...). Insbesondere hielt man sie aber auch (zusammen mit den äußeren Änhängen, die als Fortsetzung galten) als Verortung des Geschlechtstriebes.
Die Leber wiederum wurde in Antike und Mittelalter als Sitz der Lebessäfte und damit verbunden der Temperamente verstanden. Insbesondere des Zorn! Damit verstehen wir, was es damit meint, wenn uns etwas 'über die Leber läuft'. Da hilft dann nur 'frei von der Leber weg herauszubrüllen', was einem die Galle staut um so 'dem Herzen Luft' und den Gedärmen Ruhe zu verschaffen.
Im Herzen schließlich waren solch Eigenschaften wie Mut und Treue aber auch Zweifel angelegt - darum finden sich in den mittelalterlichen Romanen und Mären auch Liebende, die soweit gehen, um sich ihrer ewigen Treue durch den Tausch ihrer Herzen (autsch!!) zu versichern. Klingt logisch, wenn man aristotelisch das Herz als Sitz der Persönlichkeit betrachtet. 'Dein Herz gewinnen' meint dann auch etwas mehr als nur die Zuneigung ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Gesellschaft im Mittelalter

Die mittelalterlichen Vorfahren und die Ehe - Teil 3: Alternativen aus dem deutschen Raum - die Munt-Ehe
Zurück zum zweiten Teil der Artikelserie.
Lange Zeit ist verstrichen, sei wir uns mit der Ehe beschäftigten. Falsch - wir, als glücklich Gebundene beschäftigen uns alltäglich mit den Segnungen uns praktischen Auswirkungen derselben. Vielmehr meinten wir, es wäre genügend Zeit seit unserem letzten Artikel über die Eheaspekte im Mittelalter verstrichen, um nun einige Ergänzungen nachzureichen. Ließen wir zuletzt einige Weise darüber räsonieren, wollen wir uns diesmal über einige Begrifflichkeiten unterhalten.
Und was würde sich in einer Zeit, in der wir ständig über Patchworkfamilien (deren deutsche Bezeichnung als Stieffamilie ja kaum noch bekannt, ja vielleicht auch gar nicht mehr gänzlich zutreffend ist), Lebensabschnittspartnerschaften, alternative Formen des Zusammenlebens, bis hin bis zur (*huch!) Polyamorie (die Unschuldigen, die noch nicht wissen, worum es sich dabei handelt, mögen bitte die sofortige Internetrecherche unterlassen und stattdessen gefälligst unseren sehr spannenden Artikel zu Ende lesen!), in einer Zeit wie dieser also besser eignen, als auf 'alternative' Formen des Zusammenlebens unserer Vorvorderen einzugehen - zwischen Mann und Frau wohlgemerkt, waren doch andere Beziehungen mehr als nur verpönt und somit auch literarisch mit kaum mehr als Verdammungen belegt.
Das wir uns hier dem Recht im germanisch-deutschsprachigen Raum widmen, liegt im Umfang der behandelten Thematik begründet, kann doch jedes europäische Land seine Eigenheiten aufweisen, die teils auf römisches Recht, teils auf (germanische) Volksrechte zurückgehen und trotz zunehmenden Einflusses der Kirche bis weit ins hohe Mittelalter und darüber hinaus zu verfolgen sind. Behilflich für unsere kleine Auflistung war uns dazu - wie so häufig - das bewährte 'Lexikon des Mittelalters' ...

Aber nun der Reihe nach: Greifen wir in die grauen Vorzeiten völkerwanderlichen Herumziehens und der folgenden Konsolidierungsjahrhunderte zurück, ist die Feststellung zu treffen, dass mit der Ehe (dem althochdeutschen 'ewa', das etwa mit Gesetz, Recht oder Vertrag zu übersetzen wäre) vordergründig keine Abmachungen zwischen Mann und Frau, schon gar keine Liebesbeziehungen betreffende, sondern vielmehr Verträge zwischen den beteiligten Sippen geschlossen wurden. Nicht die Ehe war die vorrangige Institution des Zusammenlebens, sondern die (Groß-)Familie, innerhalb derer sich die Brautleute einzuordnen hatten.
Demgemäß auch die Gebräuche und Gepflogenheiten bei der Munt-Ehe. Der Name rührt von der Vormundschaft unter der die Frau in jenen frühen Zeiten zeitlebens zu stehen hatte. War es zuerst der Vater oder ein männlicher Verwandter, unter dessen Schutz (althochdeutsch munt meint ja soviel wie Hand und Schutz, mittelhochdeutsch auch schon Bevormundung) sie stand, ging diese Vormundschaft mit allem was sie einschloss (also auch die Verwaltung des Vermögens der Gattin) mit erfolgtem Vertragsabschluss zwischen Vormund und Bräutigam auf den letzteren über (eheherrliche Gewalt).
Doch nun träumt nicht zu früh, ihr Schurken, von solch 'paradiesischen' Zuständen. Denn die Eheschließungen wurden von den Sippenoberen ausgehandelt, oft schon dann, wenn sich die zukünftigen Brautleute noch im Kindesalter befanden, stets mit der Absicht, dem vermeintlichen Wohle der eigenen Sippe oder des eigenen Geschlechtes zu dienen und nicht so sehr dem individuellen Glück der Eheleute. Letzteres war tatsächlich nebensächlich.
Für die Übernahme des Vormundschaft hatte der Bräutigam im Gegenzug den Muntschatz, auch als Wittum bekannt, zu entrichten. Ursprünglich an die Sippe der Braut gehend, danach den Muntwalt, wurde dieser Beitrag schließlich zur Brautgabe selbst, die in beweglichem Gut oder später auch Liegenschften deren Versorgung und Absicherung er nach einem möglichen Tod des Gatten oder nach einer Eheauflösung dienen sollte.
Doch bevor wir zur möglichen Auflösung der Ehe kommen können, muss diese ja erst geschlossen sein. Nach Abschluss des (Verlobungs-)Vertrages hatte noch eine Reihe von Rechtsakten zu folgen, die schließlich die eheliche Gemeinschft begründeten: Die eigentliche Trauung durch die feierliche Übergabe der Braut, die Heimführung (im Brautlauf) und schließlich durch das erfolgte Beilager.
Dafür erhielt die neue Hausherrin am Morgen nach der Brautnacht die 'Morgengabe' - ursprünglich wohl ein Schmuckgeschenk oder dergleichen (vielleicht auch, um damit ihre neue, hervorgehobenen Stellung im Haushalt hervorzuheben), später aber immer mehr dem Wittum ähnelnd und auch in der Art nicht mehr klar unterscheidbar. Mit zunehmender Einflussnahme der Kirche wurde es auch üblich, priesterlichen Segen einzuholen. Für uns ist die dabei mancherorts gehandhabte Praxis (siehe obige Abbildung) zumindest gewöhnenswert ... andererseits, was bedeutet Privatheit heutzutage im Zeitalter sozialer Netzwerke überhaupt noch?
Und wenn's nicht klappte (auf die Gründe werden wir noch zu sprechen kommen)? Dann konnte eine solche Munt-Ehe in Frühzeiten einfach durch beiderseitiges Einvernehmen getrennt werden - mit Erhalt der Besitztümer der Frau. Wenn diese sich allerdings etwas zuschulden hatte kommen lassen, dann durfte sie der gehörnte Gatte auch einseitig verstoßen (Wie war's umgekehrt? Fragt ihr das ernsthaft? Schließlich kommt so etwas bei Männern nie ...) - allerdings musste er sich, wenn dies aufgrund falscher Beschuldigungen erfolgte, der Feindschaft und Rache der Sippe seiner verstoßenen Gattin gegenwärtig sein. Und Unsereiner weiß ja, wie unangenehm böse Schwiegermütter werden können ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Glaube und Religion
Die Hölle

In der ordentlichen mittelalterlichen Welt des Honorius darf auch die Hölle nicht fehlen ...
Teufel nochmal, wo war doch schnell nochmal der Serienbeginn zu finden? Kein Problem - zur hier, gehts's zur Hölle, Teil 1 ...
'Superbi, invidi, fraudulenti, infidi, gulosi, ebriosi, luxuriosi, homicidae, crudeles, fures, praedonis, latrones, immundi,, avari, adulteri, fornicatores, mendaces, perjuri, blasphemi, malefici, detractores, discordes.
(Auszug aus dem Elucidarium des Honorius Augustoduensis)
So so, da sind sie also angeführt: die Hochmütigen, die Neider, Betrüger, Treulosen, Schlemmer, Säufer, Vergnügungssüchtigen, die Totschläger, die Grausamen, Diebe, Wegelagerer, Unanständigen und Geizhälse. Die Ehebrecher, Hurer, Lügner, Verräter und Gotteslästerer. Die Zauberer, Verleumder und Friedensbrecher! Diejenigen nämlich, die die Höllenqualen verdienen, ...

... zumindest wenn es nach Honorius Augustoduensis geht, der uns diese beeindruckende Liste mahnend in seiner sehr populären und oft rezipierten Schrift 'Elucidarium' (das Erleuchtete) warnend vor Augen führt. Dieser Honorius (etwa 1080 - 1150), war vermutlich ein irischer Benediktinermönch, in England geschult, in Frankreich geweiht (daher auch als Honorius von Autun bekannt) und später auch in Deutschland als Verfasser von Streitschriften im Zusammenhang mit der Gregorianischen Reform tätig, Schriften, die dem reformwilligen Klerus theologisches und philosophisches Wissen vermitteln sollten.
Dieses Wissen - für das anzuführen Honorius er auf solche Kapazitäten wie Augustin, Isidor von Sevillia, Gregor den Großen, Anselm von Canterbury zurückgriff - wollen wir nun heranziehen, um uns ein wenig umzusehen, wie es denn so aussieht mit der Hölle und ihren (unfreiwilligen) Dauergästen. Denn eines muss klar sein: Dorthin geht man nicht auf ein schnelles Wellnesswochenende ...
Was geht uns das alles an, werdet ihr jetzt vielleicht fragen, findet sich doch unser Beruf und schon gar nicht unser Tun in obiger Liste - eine Behauptung, welche wir niemals auch nur ansatzweise zu bezweifeln wagten. Schließlich wissen wir um die moralische Untadeligkeit unserer Leser Bescheid, so gut, dass wir füre einen jeden fast die Hand ins Feuer legen würden - wenn wir denn eins zur Hand hätten ...
Andererseits ..., wenn man bedenkt ... etwa dass die mittelalterliche Bezeichnung Wegelagerer für manch neues Berufsfeld auch nicht ganz von der Hand zu weisen wäre ... und was heißt schon vergnügungssüchtig? Lügen? Niiiieeee ... ganz, ganz ehrlich! Schlemmen gibt's bei uns auch nicht ... nur hin und wieder, an besonderen Festtagen und vielleicht dazwischen ... Die anderen Punkte? ... Hmm ... Also gut, lassen wir das. Vielleicht werfen wir doch einmal einen kurzen Blick hinter die Höllenpforten - zur Vorsicht, schließlich will man wissen, was da so abgeht ...
Obwohl - schuld an unseren Verfehlungen sind nicht wir, die Menschen. Begonnen hat's nämlich damit, dass nämlich einer, der glaubte, besser zu sein als die anderen, maßlos wurde in seinem Verlangen - eine altbekannte Geschichte. Ihr erratet's um wen es sich handelt? Richtig, den Erzengel Lucifer. Wär der am Boden (eigentlich im Himmel) geblieben, dann wär uns dafür manches erspart geblieben:
'Als er [nämlich] sah, dass er alle Ordnung der Engel an Glorie und Schönheit überragte, verachtete er alle und wollte Gott gleich, ja überlegen sein ... Er wurde aus dem Palast vertrieben, in den Kerker gestoßen, und so wie er vordem der Schönste war, wurde er danach der schwärzeste ...
(Auszug aus dem Elucidarium des Honorius Augustoduensis)
Durch Lucifers Fall und dem seiner Kumpanen war folgerichtig der zehnte Chor der Engel verwaist und den wollte Gott mit den Menschen erfüllen - was die Missgunst des Schwarzen erregte. Von Anfang an verfolgte er das Menschengeschlecht, versuchte es zu verderben - über die unselige Apfelgeschichte wissen wir ja alle Bescheid - und daher müssen wir uns seitdem mit einer Reihe (kleinerer und größerer) Schwächen, wie oben aufgeführt, herumschlagen. Klingt ungerecht, ist aber so ...
Wen es also am falchen Fuß erwischt, im Zusand der Todsünde nämlich, ohne priesterliche Absolution, den erwartet Heftiges und Unerfreuliches im Nachleben, wie wir hier heftig mit Honorius Worten anmahnen möchten:
'Wenn die Bösen an ihr Ende kommen, kommen scharenweise die Dämonen mit großem Getöse, schrecklich anzuschauen, mit furchtbaren Gesten, die die Seele mit härtester Qual aus dem Körper herausschlagen und grausam zu den Gefängnissen der Hölle hinabzerren ...
(Auszug aus dem Elucidarium des Honorius Augustoduensis)
Keine schöne Vorstellung, fürwahr. Und wenn ihr jetzt leuchtenden Auges meint, öfters ins Lichtspieltheater zu pilgern oder in den Viedeoverleih, um genau solches zu erleben, dann bedenkt wohl, dass diese Vorstellung, wie Honorius sie uns vor Augen führt, keinen Abspann kennt, dass sie niemals enden wird ... von wegen schnell mal wegzappen ... oder Werbepause ...
Und wie ist's dann wirklich, unten, im Infernus? Nicht fein, müssen wir hier warnen. Dort soll es eine Menge an sadistischem Personal geben, das große Freude zu haben scheint an abartigem Tun: Dort soll aufgehängt werden, geschnitten und gebrannt. Pech blubbert und Schwefeldämpfe -klar! - treiben durch die Gewölbe, in denen Wurmfraß und sich um Menschenleiber windende Schlangen ebenso an der Tagesordnung sind, wie noch allerlei andere Boshaftigkeiten - deren Beschreibung bereits damals, zu Honorius Zeiten, auf eine reiche Tradition von Jenseitsfahrten zurückblicken konnte.
Ja, ihr Lieben, vielleicht fragt ihr euch gerade, wo denn die nächste Kirche wäre, die Gelegenheit zur Absolution - nicht dass es nötig wäre, nur so, zur Sicherheit - und recht ist's gefragt, wie wir meinen. Ob damit alles gut würde? Wie's denn genau aussiht in der Hölle ... wenn euch solche interessiert, dann harrt auf die Fortsetzung ... und nicht vergessen: Schlemmt nicht übermäßig an den ersten Weihnachtskeksen ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Glaube und Religion
Die Hölle

Sünder einst und heute: Serienbeginn über die Hölle und ihre Kunden ...
Bekanntermaßen war dem mittelalterlichen Menschen das Jenseitige stets gegenwärtig im Denken, viel stärker als das bei uns heutigen der Fall ist. Was nicht verwundert, wenn man an die geänderten Lebensumstände da und dort denkt. Denn damals gab's Feuer und Schwert, Hunger und Seuchen, Reichtum, Prunk und Protz Weniger auf der einen Seite, dagegen erdrückende Armut der Vielen, gab's Bettler und Veganten, das Ausgeliefertsein an Jahreszeit und Witterungsbedingungen, Mautnehmer und Wegelagerer, eine gnadenlose Obrigkeit, die Grundzins und Zehent einforderte, Schuften bis ans Lebensende.
Heute dagegen ist alles anders - seht euch um: Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen, Süßigkeiten in den Läden - auch wenn's erst November ist, Jahreszeiten und Witterung sind überwunden - wenn's nicht gerade wieder ein Unwetter gibt, Flutkatastrophen oder Wirbelstürme, aber sonst ... Dafür nur leuchtende Augen, ist doch vom lebenslangen Schuften schon lange keine Rede mehr - für die einen arbeitet nämlich ohnehin das Geld, den anderen geht's noch viel besser. Die haben nämlich gar keine Arbeit mehr - Tendenz steigend! Ja gut, alle mögen darüber nicht glücklich sein, und ein paar mag es schon noch geben, die sich mit mehreren Berufen von morgens bis abends abrackern müssen, von der Vigil bis zur Laudes, um überhaupt das Nötigste zum ihrem und dem Leben ihrer Angehörigen zu erwirtschaften.

Aber sonst - bitte! Seht euch um: Sonst dürfen wir heutzutage alle in Berufen arbeiten, die unseren Fähigkeiten entsprechen, die uns Zeit zur Entfaltung und zur nötigen Erholung geben, ja, die uns glücklich machen - und weil sie dies so gut zu tun verstehen, dürfen wir demnächst sogar bis 70 weitermachen, 80 gar oder 110 ... vorbei sind die Zeiten schnöder altersbedingter Ausgrenzung, sind doch nach oben (auch im wörtlichen Sinn) der gelifteten Tänzerin und dem hüftgelenkserneuerten Bauarbeiter keine Grenzen gesetzt. Und sollte man auf der Anreise wieder einmal die Adresse des Büros vergessen - Umhängeschildchen und nettes Polizeipersonal helfen da schon weiter. Eine jede Firma freut sich doch täglich über das Eintreffen ihrer älteren Mitarbeiter.
Krankheiten? Kein Problem mehr, dank moderner Medizin - wenn man denn noch Zugang dazu hat. Und Seuchen - da gibt's schon lange keine mehr, vor der wir uns zu fürchten hätten ... mmh, außer vielleicht ... lassen wir das. Immerhin sind Zins und Zehent Geschichte. Na, ihr lieben Leute aus dem Mittelalter, da staunt ihr herab aus den Wolken, oder - Gott behüt! - herauf aus dem feurigen Schlund, was? Ja, zugegeben, da sind schon noch einige wenige Abgaben zu erledigen, kaum der Rede wert ... nein wirklich nicht ... Mehrwert- und Mineralölsteuer fallen mir da ein, beileibe keine Abgaben, die wahllos treffen, ein bisschen Lohnsteuer auch (mit lächerlichen 50 oder 75% Spitzensatz da und dort, Pensionsbeiträge, die uns in 20 oder 30 Jahren eine absolut sichere Pension bzw. Rente sichern werden). Ein paar andere noch: Müllabgaben - schließlich kippen WIR den Dreck nicht mehr einfach aus dem Söller, schließlich gibt's ein Sackerl für jedes ... -, Wasser, Fernwärme ... Was, diese Abgabenquote lässt euch erbleichen?
Dafür haben wir jetzt unsere Sparbücher. Dort legen wir unser so leicht erworbenes Geld dann an - ja, genau das, das uns Ende des Monats noch verbleibt. Ja, gut, nicht immer ... Schwere Gulden? Nein, nein, wo denkt ihr hin? Wir brauchen unser Geld nicht mehr mit uns herumzuschleppen, denn unsere Meister überweisen heutzutage unsere Entlohnung den Banken (nein, das sind nicht mehr ausschließlich Geldwechsler und nein, es gibt sie nun auch außerhalb von Florenz), und die sind so freundlich und bewahren es absolut sicher für uns auf (schließlich gibt es ja jetzt den Bankenrettungsschirm - ihr wisst nicht, was das ist? ... ein Schirm, der ... nun, das wär wohl zu kompliziert hier) - natürlich haben wir dafür eine Winzigkeit abzuführen von unseren Gold- und Silberlingen (... ja doch, abzuführen, für jeden Dreck, aber das ist doch nur recht und billig für die Leistung, oder? Freie Wahl, ob man's denn der Bank so anvertrauen will, statt lieber selbst gediegenes Metall im Beutel zu tragen? Bedingt, abheben kostet nämlich ...)
Aber halten wir uns nicht mit diesen Kleinigkeiten auf - wir wollen über die Errungenschaften der heutigen Zeit sprechen. Also, wo waren wir? Die Sparbücher, genau - das ist eine tolle Sache. Wir borgen sozusagen der Bank unser Geld, damit sie damit spekulieren kann, Aktienpakete schnüren, die so raffiniert zusammengestellt sind, dass keiner mehr weiß, was sie enthalten, Wetten abschließen, auf dass solcherart das Kapital vermehret werde. Das dann Wenigen große Gewinne beschert. Und das völlig risikolos - denn wenn's daneben geht, kommen die Kämmerer und Zahlmeister des Kaisers - ähh, des vereinten Abendlandes - und retten die Bank! Eine tolle Sache, wie wir finden!
Woher die Zahlmeister das Geld nehmen? Na, man braucht nur die Abgaben da und dort ein wenig zu erhöhen, ein bisschen die Mehrwertsteuer, ein wenig die Wasserabgaben, den Frondienst ... ähh, nein, die Arbeitszeit ein paar Jährchen verlängern, den Gürtel ein wenig enger schnallen, Phantasie Leute - und schon hat es sich wieder! Ist doch alles ganz einfach, oder? Ihr versteht jetzt, warum die Banken das Ganze so haben wollen? Aber nicht, warum wir ihnen unser Geld dafür anvertrauen. Tja, das, liebe Leute ist langfristiges Denken - wir geben's auf die Sparbücher, lassen es dort viele Jahre liegen - damit wir es später hoffentlich wiederbekommen. Nein, natürlich nicht mehr davon, wo denkt ihr hin? Im Gegenteil ... aber man kann ja nicht alles haben, oder ... ?
Weiter mit den Vorzügen der heutigen Zeit: Die Berufsauswahl ist so groß, da braucht keiner mehr Zolleintreiber zu werden, noch Wegelagerer heutzutage. Ihr könnt alles tun - sei's nun Inkassomitarbeiter, Pfändungsanwalt,, mein persönlicher Bankberater, Aufsichtsratvorsitzender einer Investmentbank oder auch Börsenmakler. Occupy die Wallstreet mit deinen Talenten, könnte man sagen ... und das also ist unsere neue, bessere Welt, in der wir mit unserer Technik und überlegenen Ethik dafür sorgen, dass Friede, Freude, Gleichheit allenortens herrschen, ein jeder glücklich sein Leben gestalten kann in seiner Heimat, niemand auf der Flucht zu sein hat ...
Der letzte Abschnitt: Irgendwie hat uns plötzlich das Gefühl ergriffen - warum's so ist, keine Ahnung -, es wär an der Zeit über weltliche Dinge hinaus wiederum das Religiöse, Jenseitige in Bedacht zu nehmen, so, wie's der mittelalterliche Mensch empfand. Was wäre an dieser Stelle besser geeignet als da auf verfluchte Sünder und die Hölle zu sprechen zu kommen. Aufs Fegefeuer vielleicht auch. Schließlich soll's uns vor der Adventszeit zur Warnung dienen und als Hoffnung, dass alle jene, die's verdienen ... ja, ist schon gut, wir lassen's damit bewenden. Nicht aber demnächst die Fortsetzung, worin es um Feuer und Qualen, ums Zerren und Henken und Vierteilen gehen wird ... es wird also eine Menge los sein, darum bleibt dran, wenn's hier heißt 'Tortures of the Hell 2'!
Weiter höllisch zu geht's im zweiten Teil dieser Serie ...
Wem aber bereits jetzt sein Lebenslauf und die Aussicht auf das Höllenfeuer allzusehr aufs Gemüt drückt, der möge hier, bei den Engeln auf schnellstem Wege Trost finden ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Redensarten
und Handwerk

Alte Redensarten - das hat Hand und Fuß, ...
Die Hand, das wichtigste Werkzeug des Menschen! Mit ihr lässt sich greifen, festhalten, zärteln und liebkosen. Mahnen, drohen, stoßen. Schlagen und verletzen. Töten. So wichtig ist sie, dass sich das in einer Fülle von Sprichwörtern und Redensarten ausdrückt, einer Fülle, die wir unmöglich in einem Artikel auch nur ansatzweise behandeln können. Dennoch wollen wir etwas, das uns allen so wichtig ist, nicht unter den Tisch fallen lassen (horch, horch - wiederum eine alte Spruchweise ...).
Damit aber Hand und Fuß bekomme, was wir hier auf begrenztem Raum beschreiben, wollen wir heute einen einzigen Spruch herausgreifen, die anderen aber - so sei beruhigt - nicht auf ewig verwerfen, sondern nur auf ein Späteres verschieben. Welchen nun? Ja doch, genau jenen, in dem wir uns wünschen, dass etwas 'Hand und Fuß besitze', womit wir Heutigen eine wohldurchdachte Absicht oder Tätigkeit meinen. Oder aber auch eine Sache, der nichts Wesentliches fehlt, an der also alles Wichtige (noch) erhalten ist.

Was immer er macht, es hat Hand und Fuß - das meint uns den Handelnden als planvoll vorgehenden Akteur, dem man sich gerne anvertraut, ja, dem man vielleicht sogar geneigt ist, das eigene Schicksal 'in die Hand zu legen.' Aber halt, halt, Letzteres führt uns für dieses Mal bereits zu weit. Hand und Fuß soll's an dieser Stelle haben, was im ursprünglichen Sinne soviel bedeuten könnte, wie komplett, also ganz und unbeschadet zu sein; zumindest ließe sich solches vermuten.
Und, ist's denn wirklich so? Ja und nein. Wie das, fragt ihr? Nun, wenn wir der Vermutung folgen, der alte Spruch habe mit den Gepflogenheiten jener Zeit zu tun, in der die rechte Hand und der linke Fuß von essentieller Bedeutung waren für den waffenfähigen Herren, dann genügten ebensolche Gliedmaßen, um ihn als kompletten Kriegersmann gelten zu lassen - die Rechte, zum Führen des Schwertes benötigt, der linke Fuß, um in den Steigbügel zu steigen und derart aufzusitzen. Andere Details - die Linke, der rechte Fuß, Nase, Ohren, Kopf? Allemal nicht so wichtig ...
Demzufolge galt dem mittelalterlichen Denken das Abschlagen der rechten Hand und des linken Fußes als eine besonders schlimme Bestrafung - erst ihr Fehlen 'verstümmelte' den Kriegersmann, wurde ihm doch damit die Wehrfähigkeit genommen. Und Linkshänder? Denen würden wir für solch einen bedauernswerten Anlass empfehlen: Mund halten und nichts verraten ...
Der Zwergenkönig Laurin übrigens - wir erinnern uns, mit dem hatte der wackere Dietrich von Bern einiges Ungemach - wusste jene Übeltäter, die so ruchlos waren, ihm die Rosenblüten im gleichnamigen Garten zu zertrampeln, mit dem Abschlagen von Gliedmaßen zu bestrafen - nämlich mit dem der - erraten! - rechten Hand und des linken Fußes. Recht so - die armen gebrochenen Rosen!
Und auch Wernher der Gärtner weiß in seinem 'Meier Helmbrecht' von einem Henker zu berichten, der von einem ihm zustehenden Recht, einem von zehn Verurteilten das Leben zu schenken, Gebrauch macht. Ein erster Anflug von Art humanen Strafvollzug also? Nicht wirklich, denn er bestraft den solcherart erwählten 'glücklichen' Helmbrecht für seine Untaten folgerichtig damit, dass er ihn, der sich in seiner Maßlosigkeit zum (Strauch-)Ritter emporschwingen wollte, Hand und Fuß abhaut, ihn also für alle Zeit zum Waffenunfähigen macht.
Wie man sieht, hatte des Scharfrichters Tun duchaus Hand und Fuß - zumindest wenn man das Denken seiner Zeit zugrunde legt. Wer also nicht so enden möchte, wie der arme Meierssohn, der sollte tunlichst keine reichen Pfeffersäcke und einfachen Bauernleut' plündern, sondern zum Erwerb des täglich Brotes lieber die 'eigen Hand und Fuß regen', was soviel meint, wie fleißig zu sein.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Gesellschaft im Mittelalter

Mordbrenner im ausgehenden Mittelalter und in der frühen Neuzeit - Teil 2
Zurück zum ersten Teil der Artikelserie.
Während wir im ersten Teil der Serie bereits ausführlich über die Gründe sprachen, die das Räuberunwesen und die Mordbrennergesellschaften im ausgehenden 15. und im 16. Jahrhundert zu einem immer größeren gesellschaftlichen Problem werden ließen, wollen wir diesmal ein wenig die Quellen zu Worte kommen lassen. Sie vermögen in ihrer Direktheit ein treffenderes Bild zu vermitteln als jede nachträgliche Schilderung.
(Dazu sei an dieser Stelle ausdrücklich auf das sehr informative Buch 'Räuber, Mordbrenner, umschweifendes Gesind', von Monika Spicker-Beck, erschienen im Rombach Verlag, verwiesen.)
Wenn der Krieg also 'ein Loch machte', dann standen sie vor der Tür der Bauernhöfe, die 'gartenden Landsknechte', deren Lebenswelt sie nicht selten entstammten, und fragten zur Überbrückung ihrer Notsituation darum an, ob denn nicht Hände im Haus benötigt würden, zum Schneiden des Korns oder dem Schlägern von Holz - im günstigsten Fall verdingten sie sich so!
Vielleicht klopfte der Gartknecht aber einfach auch nur um einen zerpfennig an; erhielt er ihn, mochte nicht viel geschehen, bekam er an Geldes statt Essen vorgesetzt, wird er's auch zufrieden gewesen sein. Aber Achtung, wenn es sich ein solcher Herumtreiber oder - schlimmer noch - ein ganzer Trupp davon am Hof gemütlich zu machen begann. Wie's der Landsknacht Sitte war, hielt man es mit den Eigentumsverhältnissen dann nicht immer so ganz genau und manch Bäuerlein mag erleichtert aufgeseufzt haben, wenn derlei Gäste wieder Abschied nahmen.
'Und wenn ir kumt ins bauren haus,
so lebt mit klugen witzen.
Einer gee ein, der ander bleib herauß,
luog, wo die hennen sitzen.
Aier und käs und ander probant,
das nemt frölich on alle schand!
Das ist der Kriegsleut sitten
...'
(Landsknechtlied, 16. Jhdt.)
Fröhlich und ohne Schande ... ein Ärgernis für die Landbevölkerung, aber immerhin wird's in den meisten Fällen noch verkraftbar gewesen sein. Anders - nämlich viel dramatischer - konnte sich eine solche Begegnung entwickeln, wenn die um Geld und Unterstützung Gebetenen dies verweigerten - sei's nun aus purem Geiz oder aber auch einfach darum, weil die eigenen Mittel begrenzt waren (mochten doch andere Gartknechte kürzlich vorübergezogen sein, die Ernte schlacht ausgefallen, Unwetter aufgetreten sein, ...); gewiss, gewiss, es widersprach den Regeln der Kirche, Hilfsbedürftige abzuweisen, aber noch mehr widersprach es den Regeln, die allzu Harschen darum sogleich zu meucheln ...
'... uf ein ainzechten Hof khomen weren. Niemandt dan ain frau und ein bub dahaim gesein. .... Hetten sie die frawen, inen ires gefallens zugeben, angeredt. Wer wol die frau etwas unwirß gsein und inen ubel zugerdt, was sie so umbzögen und damit dem buoben in der scheur zugeschrien, er solt baldt dem dorf zulauffen und den maister holen. Deß der Buob gethon. Wer seiner gesellen ainer dem buoben nachgeeilt und ee er zum dorf khomen den buoben ermördt. ... Hett die fraw das haus versperrt. Leinten sie ein laytter an, stiigen das haus ab, und hieben der frawen bede hendt ab, nemen was sie im haus fennden, zögen darvon und verkauften solichs den Juden ...
(Auszug aus den Prozessakten des Simin Menewitz)
Eine erschreckende Brutalität die aus diesem und vielen anderen Berichten spricht; ein Leben zählte manchmal weniger als ein Weniges an schnellem Gewinn. Nicht selten setzten Gartknechte im Frieden fort, was in Kriegszeiten ihr Beruf war - das Plündern und Töten. Schließlich galt es, die 'unseligen', weil soldlosen Friedenszeiten irgendwie auf der Gart zu überstehen und dabei auf die baldige Wiederkehr militärischer Konflikte finanzstarker Herren zu hoffen.
Doch es waren nicht nur die Landsknechte, deren soziale Situation zum Ausufern der Kriminalität führte. Nichtsesshaftigkeit konnte auch durch weitere Ursachen bedingt sein - wir hörten bereits davon. Denn auch die andere Seite des Gesetzes, die Obrigkeit, scheute sich in ihrer Gerichtsbarkeit nicht vor grausamen Urteilen. Reaktion auf Vergehen im Bestreben ausufernde Erscheinungen in den Griff zu bekommen? Und dabei zugleich den Nährboden legend für neue, durch Not erzwungene Untaten? Schwer zu entscheiden. Jedenfalls schaudert uns kaum weniger vor den Strafen, von denen wir in manch Urfehden zu lesen bekommen, denn vor den zuvor begangenen Untaten der Verurteilten ...
Besonders schlimm mutet uns dabei das Schicksal der Kleinsten an - wir hörten bereits davon: Häufig hatte nämlich bei Landesverweis des verurteilten Vaters die ganze Fammilie ihren Wohnsitz zu räumen - meist die Einbahnkarte in Not und Elend. Viel schlimmer als mit Vater und Mutter vertrieben zu werden, dünkt uns aber das Schicksal jener Kinder von zum Tod verurteilten Eltern, die 'gnedigklich' zwar dem Tod entgingen und 'nur' außer Landes gewiesen wurden - elternlos, auf immer zum Betteln und Dahindarben verdammt. Man möge ...
'... die zwei döchterlin den knaben an die hand geben und sie uff ein verschrybung ausser lands schwern lassen, mit dem anhang, wann sie daruber ergriffen, werden sie ertrenckt.'
(Auszug aus der Urgicht des Landfahrerpaares Erhart Pfeiffer und Margret Kechin)
... hieß es im Urteil, schließlich wären die Kinder zugegen gewesen beim Morden und Brennen und Stehlen der Eltern, so die Begründung. Dass solcherart Ausgestoßene wohl kaum mehr den Weg zurück in ein 'gott- und landesfürstgefälliges' Leben finden ´konnten, versteht sich fast von selbst. Sollten solche armen Würmer überhaupt das Erwachsenenalter erreicht haben, dann wohl am ehesten noch als Mitglieder von Bettler- und Räuberbanden ...
Wenige Quellen, doch sie einzuschieben, erschien uns ratsam, um ein deutlichers Bild von den Zuständen geben zu können, die Menschen zu einem Leben als Ausgestoßene und in Folge in die Kriminalität zwingen konnten. Nicht verschwiegen soll dabei aber auch, dass es sehr wohl einfach nur Umstände sein konnten, die günstige Gelegenheit der einsamen Begegnung, das rasche Geld, Bequemlichkeit und Gier, die zum Morden und Plündern verleiteten. Nicht immer waren die Umgebung und die Umstände schuld ...
Ihr aber habt erwartet, von den Mordbrennern zu hören und ihren Zeichen und Benennungen, wie von uns angekündigt? Nun, aufgeschoben ist nicht aufgehoben - dies mögt ihr demnächst in der Fortsetzung erfahren ....
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Gesellschaft im Mittelalter

Mordbrenner im ausgehenden Mittelalter und in der frühen Neuzeit - Teil 1
Vorsicht, Vorsicht, können wir nur warnen, wenn ihr an euren Türen seltsame, euch nicht vertraute Zeichen entdeckt und ein paar Tage - oder auch Nächte - später, vor eben jener Tür, eine Herzdame steht, um Einlass in euer trautes Heim zu begehren begehrt. Denn, zumindest wenn wir uns den Jargon und die Verhaltensweisen gewisser Vereinigungen und Gesellschaften des 15. und 16. Jahrhunderts vor Augen führen, könnte eine solche Begegnung anders enden, als von euch gerade erhofft.
Doch ehe wir euch auf diese Weise zuviel Unruhe ins Herz pflanzen, euch vor jeglicher Begegnung mit Einlass begehrenden Mägdelein abschrecken, und euch so zu einem enthaltsamen Leben verdammen, wollen wir ausholen und erklären, was es mit dieser Warnung auf sich hat. Oder hatte - im späten Mittelalter nämlich, als umherziehende Gartknechte, aber auch Vogelfreie, Bettler und andere Rechtlose zu einem immer größeren Problem wurden; nicht zuletzt waren es die sozialen Änderungen jener Epoche, die einen wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung hatten.
Unterpriviligierte, je rechtlose Bevölkerungsgruppen gab es natürlich auch schon früher, doch war es, wenn man den Quellen glauben darf, in deutschsprachigen Landen niemals so gefährlich, alleine zu reisen, wie damals, nahm doch die Räuberplage überhand, die Gefahr, alleine reisend, im Wald überfallen und ausgeraubt, ja sogar erschlagen zu werden.

Warum damals, fragt ihr? Einerseits führte der wirtschftliche Aufschwung, der zum Ende des 15. Jahrhunderts einsetzte, zu einem so raschen Bevölkerungswachstum, dass im Laufe des folgenden Jahrhunderts die Verluste durch die vorangegangenen Pestepidemien längst ausgeglichen, ja weit übertroffen wurden. Noch niemals hatten so viele Menschen in den Landen gelebt - und die Mittel zur Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktivität (Neurodung, Wiederbewirtschaftung von Wüstungen) waren rasch erschöpft.
Die Zunahme der immer noch überwiegend bäuerlichen Bevölkerung führte wiederum in jenen Gebieten, in denen die Erbteilung üblich war, dazu, dass die Schollengrößen immer kleiner wurden: eine kleinbäuerliche Schicht, hart am Existenzminimum entstand. Anderseits wuchs dort, wo diese Aufteilung des Besitzes nicht gebräuchlich, sondern der üblicherweise der Erstgeborne das Anwesen ungeteilt übernahm, die Gruppe der besitzlosen Taglöhner und Dorfarmen.
Das Überangebot an Arbeitskräften auf dem Land - und durch Zuzug in Folge auch in den Städten - führte zu einem Sinken der Löhne, bei gleichzeitiger Preissteigerung für Lebensmittel - ein teuflischer Kreis, der rasch in existenzbedrohende Armut, Verschuldung und Kriminalität führen konnte.
Letzteres wiederum mochte ebenso wie Krankheit in körperlichen Behinderungen enden, wenn etwa dem Dieb die Hand abgeschlagen wurde. Dies schränkte die Möglichkeiten zum ehrlichen Lebenserwerb ebenso weiter ein, wie eine Landverweisung, was meist das Ende der Sesshaftigkeit und häufig auch des Familienrückhaltes bedeutete. Aber nicht selten sahen sich auch Rückkehrer nach längerer Abwesenheit - sei es, weil sie als Landsknechte gedient hatten oder auswärtig eine oder mehrere Saisonen gewerkt hatten - einer Frau gegenüber, die sich inzwischen mit einem anderen Mann zusammengetan hatte.
Trautes Heim, nicht mehr mein, könnte man da sagen. Manch einer flüchtete, will man den Quellen und Prozessakten jener Zeit ('Urgichten') glauben, auch freiwillig vor seinem Weib, das ihm das Leben schwermachte. Allerdings müssen wir an dieser Stelle zur Verteidigung der holden Weiblichkeit anführen, dass 1. diese Berichte natürlich eine einseitige Sichtweise darstellen und 2. es heutzutage solche böse Frauen ohnehin nicht mehr gibt.
Nichtsesshaftigkeit - der klassische Weg in den sozialen Abstieg, in Not und Elend und nicht selten in die Kriminalität. Zuerst vielleicht nur aus einer günstigen Situation heraus geboren - weil ein reicher Pfeffersack so unvorsichtig war, mit einem zu reisen -, sei's durch den Einfluss eines Reisegefährten, der schon einschlägig Erfahrung aufzuweisen hatte und meinte, das Handwerk des Raubens und Tötens bedürfte eines Gehilfen.
Weil schon von den Landsknechten die Rede war: Diese stellten ein besonderes Problem - wann? - dar? Richtig, in Friedenszeiten, wenn's nichts mit dem Geschäft zu verdienen gab. Da die Lebenshaltungskosten groß waren, die Überbrückungssolde niedrig oder nie ausgezahlt, mussten auch sie als 'gartende', also herumziehende Knechte ('Gartknechte') versuchen, ihren Lebensinhalt zu verdienen, sei es durch Betteln oder indem sie sich den Bauern als Hilfskräfte verdingten.
Das 'harte Liegen' und der 'üble Fraß' war natürlich nicht jeden braven Landsknechts Sache - war man doch aus Zeiten, in denen der Krieg 'kein Loch' hatte und in denen der Sold floss, zumindest an seine täglich Ration Wein und kräftige Kost gewöhnt. Nicht selten plünderte und stahl man sich in Friedenszeiten - Gott behüt' uns davor! - dann aus des Bauern Stall das, was man zum leiblichen Wohlbefinden brauchte. Klar, dass in einer solchen Konstellation Konflikte zwischen Sesshaften und Umherziehenden programmiert waren. Ergab sich eine günstige Gelegenheit, musste manchmal schon ein Huhn daran glauben. Wenn's schlimmer kam, auch die Bauersfrau oder das Kind, die alleine zu Hause geblieben waren.
Zum Räuber und Totschläger konnte man also rasch werden. Wie aber schaffte man es in eine Räuber- oder - mit noch mehr 'sozialem Aufstieg' verbunden in eine Mordbrennerbande? Nun, darüber werden wir uns das nächste Mal gedanken machen. Und auch darum, warum die besagte Herzdame vor der Tür manchmal Gutes, manchmal weniger Gutes bedeuten konnte ...
Weiter zum zweiten Teil der Artikelserie.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Wirtschaftsorganisation
im Mittelalter
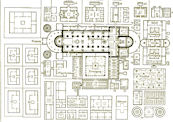
Geld und Münzen im Mittelalter - Wirtschaftssystem, Teil 4
Zum dritten Teil der Artikelserie.
Lang ist's her, dass wir hier über das mittelalterliche Wirtschaftssystem und die Wiedereinführung eines bedeutsamen Geldwesens im Rahmen der 793/794 stattfindenden Reform Karls des Großen geschrieben haben. Das (Karls-)Pfund (pondus caroli) zu 408 Gramm Silber wurde damals zum Ausgangsmaß einer reinen Silberwährung, aus dem 240 Denare oder Pfennige zu jeweils 1,7 Gramm geprägt wurden. Der Solidus (Schilling) besaß wiederum den Wert von 12 Pfennigen; 20 Schillinge gingen wiederum auf ein ganzes Pfund.
In den Geldverkehr kam nur der Pfennig. Pfund und Schilling waren reine Recheneinheiten. Im Westen bestand vorerst auch gar kein Bedarf nach Münzen höheren Wertes (zumal der Pfennig ohnehin eine relativ hohe Kaufkraft bedeutete - Schätzungen, die allerdings immer kritisch zu hinterfragen sind, sprechen von einem ungefähren Gegenwert für einen Pfennig (von 900/1000nChr.) von 30-40 Euro oder 10 bis zwanzig Hühnern ...), war doch der Fernhandel durch die Ausbreitung des Islams größtenteils zum Erliegen gekommen bzw. wurden dafür byzantinische Goldsolidus verwendet. Andererseits gab es in der Landwirtschaft kaum Überschussproduktion; es herrschten Tauschhandel und Abgabenwirtschft vor.
So weit, so gut, alles hatte seine Ordnung, zumindest für eine Weile - die Briten (immer ein wenig eigen) hielten sich sogar (zumindest dem Namen nach) bis 1971 an dieses System Karls: Pound/Shilling/Penny. Die auf die Reform folgenden 500 Jahre waren im Westen ein Zeitalter des Silbergeldes - bedingt durch das Wirtschaftssystem aber auch durch das Fehlen bedeutender Goldvorkommen.
Reisen wir von den Briten aufs Festland, und werfen wir einen Blick auf unsere alte österreichische Währung, die erst durch die Einführung des Euros abgeschafft wurde, dann finden wir den Schilling wieder; allerdings auch Groschen. Unsere deutschen Nachbarn hingegen besaßen bis zur Einheitswährung den Pfennig - aber auch die Mark. Groschen, Mark - ein Blick in die Vergangenheit verrät auch bei diesen Einheiten eine lange Geschichte. Aber es finden sich auch noch Heller und Kreuzer und Taler und Kölner und Friesacher und Aachener Pfennig, Hohlpfennig, Sterling, Prager Groschen ...
Wie konnte es von diesem einheitlichen karolingischen System zu einer solchen Vielfalt von teils nur lokal gültigen Münzprägungen kommen? Als damaliger Kaufmann hatte man ja fast ein Währungsexperte zu sein, um den Überblick über dieses Durcheinander von Zahlungsmitteln mit teils stark differierndem Wert zu behalten (- wir erinnern uns an die Aussagen der jüngeren Vergangenheit, die uns als einen Vorteil des gemeinsamen Euros die Vergleichbarkeit der Preise dargestellt haben).
Ein Hauptgrund ist mit Sicherheit in den politischen Veränderungen zu suchen, die in der Nachfolge Karls stattfanden: Schon unter seinen ersten Nachfolgern begann der Verfall des (groß-)fränkischen Reiches in mehrere Teilreiche, die häufig im Konflikt zueinander lagen. Äußere Einfälle - Normannen, Sarazenen, später auch Ungarn - und schwache Herrscher beschleunigten den politischen Verfall.
So konnte auch das Münzregal, also die Rechte zur Münzprägung, die seit Pippin dem Jüngeren ausschließlich in der Hand der fränkischen Könige lagen, nicht exklusiv gehalten werden. Fortan gab es wiederum viele, auch 'private' Prägestätten lokaler weltlicher und geistlicher Herren, aber auch von Städten, deren Entstehung häufig mit neuen Silberfundorten verknüpft war. Dass dem jeweiligen Münzherren die Entscheidung oblag, wieviel Korn - also Edelmetallanteil - er seinem Denarius beziehungsweise Pfennig spendete und damit auch, wieviel Geld sich für ihn aus einer gewissen Menge Silber 'herausschlagen' ließ, brachte mancherorts schon bald den Edelmetallgehalt auf Kosten anderer Beimengungen (Kupfer) zum Sinken.
Dies konnte soweit gehen, dass die umlaufenden Münzen in regelmäßigen Abständen eingezogen und durch solche mit niedrigerem Silbergehalt ersetzt wurden - ein gutes Geschäft für den Münzherren, das aber langfristig zur Abwertung lokaler Pfennige führte. Andere wiederum - wie etwa der Kölner Pfennig - behielten einen hohen Korngehalt und somit ihre Kaufkraft und erlangten dadurch überregionale Bedeutung.
Extrem trat dieser Vorgang der Geldverschlechterung in Italien auf, der wirtschaftlich am weitesten entwickelten Region des damaligen Europas; hier waren aus dem karolingischen Denaren, die ursprünglich 1,7g Silber beinhalteten 'leichtere' Münzen mit einem verschwindendem Silbergehalt (0,1g - 0,2g) geworden, sodass man eigentlich nicht mehr von einer Silberwährung sprechen konnte. Daher und auch aufgrund der ökunomischen Situation - die vielen Seefahrrrepubliken finanzierten sich hauptsächlich durch den Handel, es waren bedeutend höhere Geldmengen im Umlauf als sonstwo in Europa - entstand hier zuerst der Bedarf nach 'größeren' Münzen.
So begann Venedig kurz vor dem 4. Kreuzzug (1194) mit der Prägung einer größeren Silbermünze, des Grossos, der bei einem Gewicht von 2,19g einen Feingehalt von 2,1g aufwies - auch deshalb konnte man damit beginnen, weil man sich die Bereitstellung der Schiffskapazitäten für den Transport der Kreuzfahrer fürstlich in Silber entlohnen ließ. 40000 Mark Silber sollen es insgesamt gewesen sein (das Mark war eine neuere Gewichtseinheit, Mitte 9. Jahrhunderts erstmalig in Urkunden auftauchend, die zu jener Zeit etwa einem halben Pfund oder 215g entsprach), eine Menge an Edelmetall, aus der die Republik in Folge mehr als 4 Millionen Grossi prägen konnte.
Ein gutes Geschäft also für die 'tüchtige' Republik, der Kreuzzug, nicht nur aus diesen Gründen, wie wir wissen. Sei es wie es sei, kehren wir zurück zu unserem Thema: Aus dem Grosso wurde - erraten! - unser Groschen. Womit wir die anfangs Erwähnten wieder alle beieinander hätten: die Mark, den Pfennig, den Schilling und den Groschen. Der übrigens, weil auch für den Fernhandel gut geeignet, als größere Silbermünze bald Nachahmer fand.
Genua, Venedigs ewige Rivalin, durfte nicht nachstehen und nahm ihrerseits im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts ebenfalls die Produktion derartiger größerer Silbermünzen auf; vergleichbare Prägungen breiteten sich rasch über Norditalien aus und wanderten von dort nordwärts in den deutschen Sprachraum. Graf Meinhard von Tirol ließ sie seit 1274 als sogenannte Kreuzer (nach dem Doppelkreuz auf ihrer Rückseite) prägen. Wert waren sie zwanzig Veroneser Pfennige, daher auch die Bezeichnung als 'Zwanziger'.
Aus Frankreich wiederum, wo sie unter König Ludwig dem Heiligen erstmals geschlagen wurden, gelangte das Vorbild der sogenannten Turnosen, Groschen im Wert von 12 Denaren, in die Niederlande und in das Rheinland. Wer aber nun glaubt, dass dieser Siegeszug den Groschen in ähnlich schneller Weise durch ganz Europa führte, der irrt.
Warum das so war, und was es sonst noch alles über die vielen schönen Münzen zu berichten gibt, die damals im Umlauf waren, die wir jedoch in unserem Säckel schmerzlich missen, das mögt ihr in einer Fortsetzung erfahren ....
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Mittelalterliche Stadt
Feuer!!!

Feuersbrünste: Stete Gefahr für mittelalterlicher Städte - Teil 2: Bekämpfung
Zurück zum ersten Teil der Artikelserie über Brandschutz und Feuerbekämpfung.
Zuletzt berichteten wir im ersten Teil der Artikelserie von der Flut jener Vorschriften und Verordnungen, mit denen die mittelalterlichen Städt der immer wieder auftretenden, häufig verheerenden Brände Herr zu werden versuchten. Wir hörten von Bauvorschriften, von Förderungen für die Verwendung feuerfester Dachabdeckungen und von teils empfindlichen Strafen - und davon, wie dies alles dennoch immer wieder seinen Zweck verfehlen konnte.
Wen wundert's? Lag doch das Hauptproblem einerseits in der damaligen Bauweise und den - gelinde gesagt, beschränkten - Vermögensverhältnissen eines großen Teils der Stadtbevölkerung begründet, die eine teure Steinbauweise und Ziegelabdeckung unmöglich machten. Wir haben bereits besprochen, wie versucht wurde, dem entgegenzuwirken. Dennoch blieb Holz und blieben leicht entflammbare Materialien bis weit in die Neuzeit hinein ein vorherrschendes Element in der Stadt - man denke nur an Hamburg und andere norddeutsche Städte mit ihren vielen Fachwerkbauten.

Andererseits bedingte die Lebensweis eine stete Gefahr für die Entstehung von Bränden: Technologiebedingt war man damals auf offene Feuerstellen angewesen, sei's nun im Handwerk oder auch zur Bereitung des täglichen Mahles. Und da scheint es mit dem Bewusstsein für die Gefahren nicht immer weit her gewesen zu sein, wenn man die Maßnahmen der Kommunen als Maßstab dafür heranzieht.
Von den immer wieder ausgesprochenen Vorschriften und Verboten haben wir bereits gesprochen - gefruchtet haben sie, so scheint es, nicht (immer). Wie sonst können wir uns erklären, dass manche Räte Spitzelposten installierten, also Bürger dazu anwarben, in dieser Funktion unerkannt und unverfänglich die Straßen und Häuser der Stadt abzugehen und dabei auf Einhaltung solcher Vorschriften wie 'Feuer aus' nach der Abendglocke zu kontrollieren. Gemeldet wurden die ertappten schwarzen Schafe dann nächtens beim Rat - schließlich sollten die Spione unerkannt bleiben. Ein Teil der Strafen, die aus den erspähten Verfehlungen eingehoben wurden, standen dann dem Informanten zu ... gewiss ein Anreiz.
Handeln nach dem Motto 'Vorbeugen ist besser als Brennen und Jammern' also. Trotzdem, vielfach half das alles nichts - und nicht immer musste die Nachlässigkeit der Bürger Schuld daran sein. So erzählen uns Chroniken von Blitzschlag und Erdbeben als Auslöser verheerender Feuersbrünste, aber auch von absichtlichen Brandstiftungen.
Was aber waren nun die konkreten Maßnahmen, wenn's wirklich wieder einmal dazu kam? Nun, so vielfältig und unterschiedlich die mittelalterlichen Städte waren, so unterschiedlich konnten auch die entsprechenden Vorkehrungen und Verordnungen aussehen (räumlich und zeitlich betrachtet), die man für den Fall der Fälle getroffen und erlassen hatte. Daher im Folgenden nur eine beispielhafte Aufzählung ...
Die Kommunen begannen vermehrt öffentliche Brunnen zu graben, (Lösch-)Teiche anzulegen und Bachläufe umzuleiten - Maßnahmen, die nicht nur der besseren Brandbekämpfung dienten, sondern jedem Bürger und den Gewerbebetrieben im tagtäglichen Leben zustatten kamen.
Wir lesen von Abmachungen, die den Müller vor der Stadt verpflichten, im Falle des angeschlagenen Feuersignals, die Schleuse zu öffnen, um mehr als den gewöhnlichen Zufluss hinter die Stadtmauern zu leiten oder von Mahnungen, stets einen gefüllten Trog oder Eimer neben Feuerstellen bereitzuhalten (unser Weihnachtsbaum lässt grüßen!).
Mit der technischen Ausrüstung sah es schlecht aus: (Lederne) Eimer und wohl auch Löschketten waren die Hauptwerkzeuge, die zur Verfügung standen, vereinzelt meint man auch schon, primitive, mit Muskelkraft betriebene Spritzen (deren Erfindung ja in die Antike zurückgeht) im Einsatz vermuten zu können. Und natürlich auch alles an Werkzeugen, das half, brennende Teile oder hölzerne Häuserzubauten, wie Balkone und Außentreppen, rasch niederlegen zu können, um so ausreichend Abstände und Schneisen zu schaffen.
Und wer war für die Bekämpfung zuständig? (Die Feuerwehr, wir wir sie kennen, gab es nocht nicht.) Die Bürgerschaft war's; wie Militärdienst im Falle eines Angriffes auf die Stadt zu den Aufgaben der Bürger zählte, so auch die Brandbekämpfung - dies konnte aber von Fall zu Fall, von Stadt zu Stadt in unterschiedlichem Maß gefordert und organisiert sein.
Wir lesen davon, dass Neubürger sich beim Ablegen des Bürgereides unter anderem verpflichten mussten, einen Ledereimer für den Haushalt zu erwerben. Merans Feuerlöschordnung von 1317 schreibt Feuerhaken und Äxte zum Niederreissen der Häuser vor, andernorts (Augsburg) verlangte man Leitern,Feuerhaken, Schöpfgefäße, lederne Zuber und Eimer und Stangen. Um die Beförderung der Wasserbehälter zu erleichtern, waren an öffentlichen Brunnen spezielle Gestelle, sogenannte 'Schleifen' anzuschließen ...
Ab dem 14. Jahrhundert begannen die Städte auch zu regeln, wie denn die konkrete Brandbekämpfung stattzufinden hätte. Häufig war dabei die Brandbekämpfung auch speziellen Innungen und Zünften zugedacht, häufig jenen Handwerkern, denen man von Berufs wegen am ehesten zutraute, mit Feuer umgehen zu können. In Köln waren etwa die Zimmerleute, die Steinmetzen, die Schmiede und die Dachdecker mit speziellen Aufgaben betraut.
Im Baumeisterbuch des Nürnberger Baumeisters Endres Tucher lesen wir von der Nürnberger 'Feuerordnung' und davon, dass im Brandfalle Zimmermeister und Steinmetzmeister mit ihren Gesellen zum Brandschauplatz eilen mussten, mit ihren Beilen und Äxten, während die Bader ihre Kufen (also Tröge) mitzubringen hatten. Nach 'Brand aus' sollten Gesellen noch bis zum Morgenanbruch Feuerwache halten, um ein ein Neuaufflackern des Brandes zu verhindern.
Und wie sorgte man dafür, dass wirklich alle Helfer raschestmöglich am Brandherd erschienen - schließlich tat Eile gerade beim Ausbruch eines Feuern not! - und nicht der eine oder andere den Kollegen das gefährliche Geschäft überließ? Durch Wächter und Wächterstuben! Glockensignale! Und durch die Entlohnung, die Meister und Gesellen für ihren Einsatz nach dem Brand erhielten.
Die erfolgte aber nicht pauschal, sondern, wie etwa in Wien, Leipzig oder eben Nürnberg, in Form eines gestaffelten Prämiensystems, das denjenigen, der zuerst vor Ort war, belohnte. Jene, die dennoch und über Gebühr säumig waren, mussten mit schweren Strafen rechnen (wie übrigens auch die Bewohner jener Häuser, in denen das Feuern durch Eigenverschulden ausgebrochen war).
Wer in Nürnberg zuerst mit seinem Wagen mit wassergefüllten Kufen eintraf, erhielt 4 Pfund Pfennig, der Zweite musste sich mit 60 Pfennig zufriedengeben, der Vierte etwa mit zehn. Die Wiener Fuhrleute, die Wasser zur Brandstelle schaffen sollten, erhielten laut Feuerordnung von 1454 in der Reihenfolge ihres Eintreffens 100, 60 beziehungsweise 30 Pfennige.
Welcher Schelm aber nun glaubt, ein einträgliches Geschäft darin gefunden zu haben, alle Vorbereitungen zu treffen, die Tröge aufzuladen und zu füllen, und anschließend ein kleines Feuerchen zu legen, um dann gewisslich als Erster am Brandort einzutreffen und derart die Prämie dafür einzustreifen, der sei gewarnt: Die mittelalterlichen Kommunen kannten keine Nachsicht und Milde für enttarnte Brandstifter. So wurde 1456 in Wien jener Feuerteufel, der in der Neuenburgerstraße Feuer gelegt hatte, hingerichtet - und zwar folgerichtig durch Verbrennen!
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Mittelalterliche Stadt
Normen und Regelungen

Feuersbrünste: Stete Gefahr für mittelalterlicher Städte - Teil 1: Vorbeugung
Im mittelalterlichen Städtebau stellte Holz lange Zeit das vorherrschende Baumaterial dar. Fachwerkbauten, Häuser deren Dächer aus Stroh, Schilf oder Holzschindeln bestanden, beengtes Platzangebot - alles das war bis weit ins 16. Jahrhundert hinein Bestandteil der gängigen städtischen Bauweise - insbesondere in Vierteln, in denen die ärmere Bevölkerung angesiedelt war. In einer Zeit der offene Feuerstellen, Schmiedeessen und Backöfen, der Laternen, Kerzen und Fackeln und steigender Bevölkerungsdichte bedeutete dieser Umstand eine stete Gefahr für verheerende Großbrände - wie die vielerorts überlieferten Stadtchroniken nachdrücklich zeigen.
So musste beispielsweise alleine Wien in den knapp 80 Jahren zwischen 1252 und 1330 neun größere Brandkatastrophen über sich ergehen lassen; jene von 1276 soll dabei angeblich gerade einmal 100 Häuser verschont haben. Aber noch 1525 fielen weite Teile der Stadt den Flammen zum Opfer - man berichtet davon, dass 400 Häuser betroffen gewesen wären. Lübeck, Straßburg, Basel sind nur einige weitere Städte, die besonders häufig und stark von Bränden in Mitleidenschft gezogen wurden.

In Folge dieser immer wiederkehrenden (Groß-)Brände versuchten die Kommunen, die Brandgefahr durch eine steigende Anzahl von Verordnungen und Erlässen einzudämmen - was, man siehe den Fall Wien, das Unglück nicht immer verhindern konnte. Daher betrafen diese Verordnungen einerseits vorbeugende Maßnahmen zur Feuerverhütung, andererseits die Brandbekämpfung selbst. Eine der ältesten uns bekannten Feuerverordnungen, jene von Meran, reicht ins ausgehenden 11. Jahrhundert zurück, doch ist durchaus anzunehmen, dass viele andere Städte ähnliche Vorschriften kannten - wenn uns diese auch nicht schriftlich überliefert sind.
Wie versuchten also die städtischen Obrigkeiten der Brandgefahr zu begegnen? Eines der Hauptprobleme war wie bereits erwähnt das großflächig verwendete, leicht entflammbare Bau- bzw. Dachdeckmaterial. Dies durch feuerfestere Stoffe zu ersetzen musste also ein Ziel sein - welches aber durch den hohen Kostenfaktor für die dazu nötige Ziegelabdeckung lange Zeit nur einer priviligierten Bevölkerungsschicht möglich war. Dies versuchte man durch Vorschriften und - man höre und staune - mancherorts auch durch Förderungen voranzutreiben.
Vielfach waren aber die hölzernen (Fach-)werkhäuser gar nicht in der Lage eine schwere Ziegelabdeckung zu tragen - eine solche konnte dann allenfalls nach einem erfolgten Neubau aufgelegt werden; so schrieb etwa Nürnberg im frühen 14. Jahrhundert seinen Bürgern bei empfindlicher Geldbuße vor, dass Neubauten grundsätzliche in Ziegel oder Lehm zu halten wären.
Vielerorts wurden 'baupolizeiliche' Verordnungen und Regelungen erlassen - wer also meint Gesetzes- und Regulierungswahn wären eine moderne Erfindung, der irrt -, welche einerseits ein gedeihliches Zusammenleben fördern oder der städtischen Optik dienen sollten, andererseits sehr wohl aber auch der Brandvorbeugung dienen konnten. So sollte die Begerenzung auf eine Höhstanzahl von Stockwerken und eine maximale Bauhöhe und das Verbot von (zu weit) überkragenden Stockwerken (Raumnot lässt grüßen!) insbesondere in engen Gassen hinreichend Lichteinfall auch für die Nachbarn sicherstellen.
Klar aber auch, dass eine derart enge Bauweise, mit vorragenden Obergeschossen, angebauten Außentreppen und Schornsteinen, hölzernen Hofgalerien, das Übergreifen von Bränden erleichterte, die Feuerbekämpfung hingegen erschwerte. So wurden Kommissionen ('Geschworene') gebildet, die Aufstockungen, Zubauten, Häuserteilungen im Hinblick auf die gegebenen Vorschriften zu beurteilen hatten - und nicht selten Rückbauten und Abrisse verhängten.
Mit der zunehmenden Bevölkerungsdichte, dem sich differenzierenden Handwerk in den wachsenden Städten - und nicht zuletzt aufgrund leidvoller Erfahrungen - trafen die Kommunen aber auch abseits der verwendeten Baumaterialien immer umfangreichere vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung von Feiersbrünsten. Diese Maßnahmen konnten lokal durchaus unterschiedlich ausfallen beziehungsweise formuliert sein, zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt erfolgen, jedoch lässt sich dabei in jedem Fall ein einheitlicher Trend feststellen - bedingt durch das gleiche zugrundeliegende Problem städtischer mittelalterlicher Lebensweise.
Kochen, Backen, Schmieden - die offenen Feuer waren ein steter Quell der Gefahr. So versuchte man Gewerbebetriebe, die naturgemäß mit Feuer zu hantieren hatten, zu besonderer Vorsicht zu zwingen oder sie gar an die Stadtränder beziehungsweise vor die Stadt zu verlegen, was etwa im Fall der Schmieden durchaus den Nebeneffekt erhöhter Lebensqualität, weil weniger Lärmbelästigung, für den Stadtbewohner mit sich brachte. Die Leinenweber hatten den Flachs ausßerhalb der Stadt zu rösten, ebenso die Bierbrauer ihren Hopfen ...
Glocken fanden Verwendung, um dem mittelalterlichen Menschen Zeiten, Vorkommnisse und Ereignisse zu signalisieren. Vielerorts auch jenen Zeitpunkt am Abend, nach dem - bei Strafe - kein Schmied mehr Feuer mehr in der Esse haben sollte, ebenso die Bäcker nicht in ihren Backöfen. Auf den hohen Türmen (der Kirchen) wurden Wächterstuben eingerichtet, wobei die Hauptaufgabe der Turmwächter in der frühen Erkennung von Bränden bestand; durch die Gassen und Straßen patrouillierende Nachtwächter hatten das Löschen aller Lichtquellen - außer solche in feuersicheren Laternen - zu überwachen. Mancherort wurden Feuermauern errichtet, Häuser mit Zinnenbewehrung versehen, vielfach durch den Landesherrn oder die Kommune gefördert - beides Maßnahmen, um die Ausbreitung von Bränden zu hemmen.
Seit 15. Jahrhundert wurde auch dem Fegen der Schornsteine erhöhte Aufmerksamkeit zuteil, waren doch die Rauchfänge, die in unseren Breiten ursprünglich in Holzbauweise gefertigt oder aus Flechtwerk, mit Lehm überzogen, mehrfach Ursache für das Ausbrechen von Bränden gewesen. Der neue Beruf des 'Rauchlochfegers', auch 'Schluffeger' entstand - dass uns der Rauchfangkehrer als Glückssymbol fürs neue Jahr gilt, wird aus diesem Zusammenhang verständlich ...
Wir haben bereits erwähnt, dass Dächer in feuerfesterer Ausfertigung - Ziegel, Schiefer - überaus teuer, ja deshalb nachgerade ein Statussymbol darstellten, und dass breite Bevölkerungsschichten gar nicht in der Lage waren diese Kosten oder auch die für gemauerte Schornsteine zu übernehemn - darum Ländesherren und Räte mit Förderungen und Vergünstigungen nicht sparten, soferne solche feuerfesten Materialien verwendet wurden. Dies konnte sich in einer Teilübernahme der Kosten, durch kostenlose Bereitstellung eines mehr oder weniger großen Teils des benötigten Materials oder durch Steuerbefreiungen für eine gewisse Zeit manifestieren. Ein netter Zug der damaligen Obrigkeiten, wie wir übrigens meinen.
Und was, wenn das alles nichts half? Wenn dann trotzdem passierte, was man zu verhindern hoffte? Die Maßnahmen, die man zur direkten Brandbekämpfung setzte und warum sie nicht immer erfolgreich waren, darüber wollen wir euch im zweiten Teil berichten ...
Weiter zum zweiten Teil der Artikelserie.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Geschichten um
legendäre Orte

Glastonbury - berühmte Abtei und Tor in eine andere Welt (?)
Wenn wir uns mit den uns längst liebgewordenen Werken mittelalterlicher Autoren beschäftigen, aber auch mit jenen modernerer Literaten, begegnen uns vielfach Orte, welche sich im Rahmen der behandelten Sagenzyklen infolge ihres häufigen Vorkommens und der immer wiederkehrenden Rezeption längst eine besondere Bedeutung und Betrachtung verdient haben.
Man denke nur an das Camelot des Guten Königs Artus oder Arthur (der zuvor, zumindest bis Malory, in Caerleon residierte - nun gut, wer kennt das nicht, manchmal will man sich einfach mal verändern ...), oder den sagenhaften Wald Brocéliande, der die Helden der Tafelrunde stets zuverlässig mit schauerlich beschuppten Ungeheuern und reizvoll (un)bekleideten Feen zu versorgen verstand. Im Kyffhäuser wiederum steckt einer, der durch konsequentes Schlafen Ruhm erlangte - wohl der Traum (Achtung: Wortspiel!) eines manchen Schülers ...
Und weil nun schon vom Guten König Artus die Rede war, wollen wir zuallererst einen Ort betrachten, der mit seinem Verschwinden in Verbindung gebracht wird: Glastonbury nämlich, genauer Glastonbury Tor, jenen Hügel also, der mittelalterlichen Überlieferungen gemäß mit der sagenumrankten Insel Avalon ident sein soll.

Wir erinnern uns: Nach jener letzten Schlacht von Camlann, in der die guten Ritter der Tafelrunde das bewerkstelligten, was sie am Allerbesten beherrschten, die Bösen nämlich hinzumetzeln, blieb Artus auf den Tod verletzt zurück. Zum Glück gab's damals für die Prominenz schon unentgeltliche Krankentransporte - ein solcher, eine schwarze Barke nämlich, mit drei ebenso gewandeten Frauen darin, holte den König ab und brachte ihn in ein Jenseitssanatorium - die mystische Apfelinsel Avalon - in dem er wiederhergestellt werden sollte.
So weit, so gut - aber es ist hier nicht die Stelle, den damaligene Gegebenheiten genauer auf den Grund zu gehen (- dies wird zu gegebener Zeit an anderer Stelle geschehen). Vielmehr interessiert uns, wie es zu dieser Gleichsetzung kommen konnte zwischen den drei Hügeln von Glastonbury, einer Kleinstadt im südwestenglischen Somerset, von denen der auffälligste Glastonbury Tor ist, mit der Anderweltinsel Avalon. Eine Gleichsetzung, die zurückführt auf Williams von Malmesbury 'Geschichte von Glastonbury' und seine englische Königsgeschichte.
Tor ist übrigens ein Wort keltischen Ursprungs und bedeutet - nein, nicht das was ihr denkt -, es bedeutet 'Berg, Hügel', Glastonbury Tor somit etwa Glastonbury-Hügel. Nun, nicht sehr einfallsreich, wie wir meinen; da vermag der alte kymrische Name Ynis gutrin ('Glasinsel'), die Phantasie schon bedeutend mehr anzuregen. Auch Ynys yr Afalon soll der Flecken genannt worden sein von den alten Briten, also Insel Avalon ...
Schön und gut, wird der eine oder andere unter euch jetzt vielleicht sagen, aber wie kann etwas, das inmitten einer Ebene liegt, eine Insel sein? Wir könnten es uns jetzt einfach machen - schließlich fragt auch niemand danach, warum im Märchen die Fee zaubern kann und der Rabe sprechen. Aber so billig wollen wir es hier nun wieder nicht geben. Insel wurden die Hügel geheißen, weil sie einst inmitten eines unwegsamen Morrgebietes lagen, an drei Seiten vom Fluss umgeben, zeitweise geflutet und somit gut zu verteidigen.
Besiedlingsspuren reichen zurück ins Neolithikum, führen über die Kelten und Römer zu einer Festung des 5. Jahrhunderts, die dann durch eine Kirche St. Michaels ersetzt wurde; der Turm auf dem Tor ist übrigens der restaurierte der ursprünglichen Michaelskirche. Und damit wären wir schon im Mittelalter angelegt, in jener Zeit also, in der die besprochenen Mythen entstanden - ähh, wollten sagen, in der sich die geschilderten Ereignisse zugetragen haben (denn - psst - bezweifeln sollte man sie in jener Gegend tunlichst nicht, auf dass nicht Steine der empörten Einheimischen auf den Spötter einprasseln).

Christliche Missionare dürften an der Wende vom 5. zum 6. Jahrhundert hier, am Ort keltischer Heiligtümer und zugleich an jener Stelle, an der späteren Legenden nach erstmals Joseph von Arimathäa britisches Land betrat, begonnen haben, ihre Kirchen zu errichten. Um 601 erscheint dann das Kloster Glastonbury-Abbey, ganz in der Nähe des Tors gelegen, erstmals urkundlich belegt; 705 wird es, nach der westsächsischen Eroberung, von König Ine von Wessex neugegründet und in weiterer Folge zu einem der bedeutendsten der angelssächsischen Königreiche.
Prominentester Abt wurde der in Glastonbury geborenene heilige Dunstan, der nicht nur die Benediktinerregel einführte, sondern die Abtei auch großzügig ausbauen ließ und als späterer Erzbischof von Canterbury Glastonbury-Abbey in der gesamten westlichen Christenheit berühmt machte und zum Zentrum der englischen Klosterreform des 10. Jhdts. werden ließ. Auch nach der normannischen Eroberung behielt das Kloster, das bis zu 70 Mönche beherbergte, seine große Bedeutung bei.
1184 kam es infolge einer verheerenden Feuersbrunst, in deren Folge die Kirche und das Kloster fast zur Gänze zerstört wurden, zu umfangreichen Wiederaufbauten. Im Zuge dieser Restaurierungen wurden auch Grabungen durchgeführt und auf dem alten Friedhof - man höre und staune - die angebliche Gebeine des König Artus und seiner Gemahlin Ginover, ('wunderschöner, riesenhafte Knochen') in einem großen Eichensarg mit Steinkreuz und Bleikreuz aufgefunden, ein Umstand, der die Pilgersträme und die daraus resultierenden Einnahmen nach Glastonbury drastisch erhöhte.
Die Inschrift des (verschollenen) Bleikreuzes sprach laut Giraldus Cambrensis davon, dass es sich bei den Bestatteten um den Guten König und seine Gemahlin ('Winneveria') gehandelt haben soll. Wir an dieser Stelle fragen uns - gewohnt kritisch - ob wir dem Zeugnis des Giraldus trauen sollen, der uns versichert alles mit eigenen Augen so gesehen zu haben. Nun, wir wollen ihm keine schlechte Absicht unterstellen - aber vielleicht wollte er einfach glauben, dass wahr sein müsse, was für die Abtei gut sei.
Denn, unter uns Eingeweihten - wir wissen natürlich, dass des Guten Königs Artus Gebeine nirgends je hätten gefunden werden können; ist er doch nicht gestorben, sondern in die jenseitige Welt entrückt worden, wo er an seinen Verletzungen gepflegt wird und darauf wartet, in der Stunde der höchsten Not rückkehren zu können um Britannien vor dem Ansturm wilder Barbarenhorden zu erretten. Moment mal, welches Britannien eigentlich? Das der Angeln und Sachsen, der Plantagenets, der Yorks und Lancasters, der Tudors und Windsors? Sprechen die überhaupt keltischen Dialekt?
Apropos Tudors: Heinrich VIII nämlich - wer sonst? - ließ die Abtei 1539 trotz aller Popularität in der ihm eigenen Liebenswürdigkeit aufheben: Den letzten Abt, Richard Whiting und zwei seiner Mönche ließ er wegen Hochverrats hinrichten. Immerhin haben wir ihm so die romantischen Ruinen zu verdanken, neben dem Tor und dem jährlich stattfindenden Glastonbury-Freiluftfestival Hauptattraktion für die zahlreich einfallenden Touristen.
Übrigens, der Gral, den ja Josef von Arimathäa mitgebracht hat, der soll gerüchteweise dort auch ... aber nein, das ist nun wirklich wieder eine andere Geschichte.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Gesellschaft im Mittelalter

Leben am Hof - Teil 2: Eine frühe 'Hofordnung': Das 'De ordine palatii'
Zurück zum ersten Teil der Artikelserie über das Leben am mittelalterlichen Hofe.
Der fürstliche Hof als vielgestaltiges Phänomen: realer Ort und Idee zugleich. Dort wurde beraten, regiert und verwaltet, dort wurde ein komplexes Netz von Beziehungen und Abhängigkeiten gespannt. Es galt, ein Gleichgewicht der Eliten zu erhalten, die Mächtigen in die Entscheidungsfindungen einzubinden und für die eigenen Ziele zu gewinnen.
Demzufolge hatte 'der Hof', also die Lebensführung und Prachtentfaltung dort, auch das Ziel, das fürstliche Ansehen zu erhalten und zu fördern: Festinszenierungen mit vielgängigen Mählern, Turniere, aufwendige Schauspiele, Musik, Tanz und Lustbarkeiten, Literaten, die ihre neuesten Aventüren und Minneliedern zum Besten geben, Spielleute und anderes fahrendes Volk, großzügige Geschenke zum Abschied - gewiss nicht der Alltag, aber der vielbeschworene Höhepunkt ritterlich-adeligen Seins - wo sonst sollte man dergleichen finden, wenn nicht am Hof des Fürsten?
Zugleich war er der Ort, an dem es galt das alltägliche, weitaus weniger glamouröse Leben zu organisieren, mit seinen Wachdiensten, dem Betreiben der Küche und der Vorratshaltung, der Beschaffung von Lebensmitteln, sei es durch Eigenproduktion, Jagd oder Handel, der Instandhaltung der Gebäude und Räumlichkeiten, der Organisation der Bediensteten, der Verhandlung mit Lieferanten und dergleichem mehr.

Wie also soll man sich einem solch komplexen Gebilde nähern? Nun, im ersten Teil unserer Artikelserie erwähnten wir die Hofordnungen, wie sie für das spätere Mittelalter häufig überliefert, als ein adequates Mittel, um sich mit der Struktur der Ämter an den Höfen diverser Herrscher und Fürsten vertraut zu machen. Finden sich dazu noch Rechnungsbücher, die eine detailierte Aufstellung aller Ausgaben - etwa für Lebensmittel und Bekleidung - geben, dann lassen sich daraus schon Rückschlüsse ziehen, wie sich das alltägliche Leben an einem solchen Hof gestaltet hat - wenn auch gewiss nur im groben Rahmen.
Für die früheren Zeiten fehlen uns solche Ordnungen und Ausgabenlisten; dort sind wir auf vereinzelte Beschreibungen angewiesen, denen wir auch stets mit gewissen Vorbehalten begegnen müssen, handelt es sich dabei doch häufig um belehrende oder anmahnende Werke, deren Zweck es sein sollte, Idealzustände beziehungsweise Abweichungen davon aufzuzeigen und die als solche nicht immer die wirklich herrschenden Verhältnisse darstellen müssen.
Eine solche Schrift ist das im ersten Teil bereits erwähnte 'De ordine palatii', des Reimser Erzbischofes Hinkmar von Reims, der seinerseits als bedeutende Persönlichkeit sehr stark auf die karolingische Thronfolgepolitik Einfluss nahm. Verfasst hat er die Schrift 882 für den jungen westfränkischen König Karlmann. Auf diese Belehrung wollen wir, als frühes Beispiel für eine mögliche Hoforganisation, in dieser Folge kurz eingehen.
Prolog und Epilog und sieben Kapitel sollen dem König Grundsätze und Leitlinien für eine gute Regentschaft liefern ('ad reerectionem honoris et pacis ecclesiae ac regni'). Die Kapitel lassen sich ihrerseits wieder in zwei Teile untergliedern, deren erster (Kap.1 - 3) die Problematik königlicher und geistlicher Gewalt in allgemeiner Form zum Inhalt hat.
Für unsere Artikelreihe interessanter ist der zweite Teil. Darin entwirft Hinkmar ein teilweise sehr detailliertes Bild von der Reichsverwaltung und von der personellen Zusammunsetzung und der Organisation des Hofes. Dabei stützte er sich auf eine ältere, leider verlorengegangene Schrift des Adalhard von Corbie, das 'libellus de ordine palatii' (frühes 9. Jhdt.)
Was zählt uns Hinkmar nun an Ämtern und Hierarchien auf? An oberster Stelle des Hofes finden sich selbstverständlich der König und die Königin sowie deren Kinder ( 'Anteposito ergo rege et regina cum nobilissima prole sua ...'), darunter aber auch eine Reihe von Ämtern, deren Aufgabe in der Verwaltung des Hofstaates lagen und die wir an anderer Stelle zum Teil bereits erwähnten.
Da wären zu nennen: der Seneschall als Leiter des königlichen Hauswesens ('senescalcus'), der Kämmerer, der die Verantwortung für die persönlichen Gemächer des Königs trug ('camerarius'), der Mundschenk ('buticularius'), der oberste Marschall oder auch Stallgraf ('comes stabuli') und der Pfalzgraf ('comes palatii').
Diese fünf Ämter besaßen eine besondere Stellung, waren sie doch den anderen Hofämtern übergeordnet. Den Trägern, ausgezeichneten Persönlichkeiten, denen häufig auch wichtige Aufgaben in der Verwaltung des Reiches übertragen wurden, oblagen größtenteils nur organisatorische Aufgaben; für die konkret auszuführenden Tätigkeiten war ihnen jeweils eine Reihe von Unterbeamten zugeteilt, ihnen direkt weisungsgebunden.
Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass es am fränkischen Königshof üblich war, die Ämter mit Personen zu besetzen, die unterschiedlichen Völkern des Reichs entstammten, die sich derart am Hof repräsentiert sehen konnten. (Um dies zu gewährleisten, wurden fallweise Ämter sogar mehrfach besetzt; andererseits - um die Sache noch komplizierter zu machen - konnten auch Personen mehrere Ämter bekleiden oder bei Abwesenheiten rasch Umbesetzungen erfolgen.)
Neben den Obgenannten finden sich in Hinkmars Aufzählung etwa noch der dem Seneschall unterstellte Quartiermeister ('mansionarius'), der anzuzeigen hatte, wo sich der König aufzuhalten gedachte und dem außerdem die Obhut der Gemächer Großer bei deren Abwesenheit unterstand. Die Erwähnung von Falkner ('falconarius') und von vier obersten Jägern ('venatores principales quatour') verdeutlicht wiederum den Stellenwert, den die Jagd am karolingischen Königshof besaß.
Der Meister der Türhüter oder Obertürwart ('magister ostinarium, ostinarius') hatte, mit einem Stab hinter dem König schreitend, die Funktion eines Zerimonienmeisters inne, an den sich auswärtige Bittsteller wenden mussten. Der Kellermeister ('scapoardus'), dem - natürlich, du Glücklicher! - der für den Weinkeller verantwortlich war, taucht in karolingischer Zeit nur bei Hinkmar auf. Dem Bäckermeister unterstanden niedrige Dienstleute, teilweise auch Hörige oder Unfreie des Hofes.
Der Zahlmeister ('dispensator') und der Säckler ('sacellarius') waren dem Kämmerer unterstellt und unterstützten ihn im Bereich der Finanz- und Güterverwaltung. Dem Schwertträger ('armiger') der das Richtschwert des Königs zu tragen hatte, kam aber auch die Aufgabe zu, diesem persönliche Dienste zu leisten - etwa das Reichen von Früchten und Süßigkeiten.
Nicht unerwähnt soll im Zusammenhang mit den Hofämtern die Hofkapelle ('capella') bleiben, die originär karolingischen Ursprungs war - dafür sei auf den entsprechenden Artikel verwiesen.
Neben diesen namentlich erwähnten 'Dienstposten' fanden sich am Hof allezeit Milites ohne Ämter, Berater, Bittsteller, Gäste und deren Gefolge. Nicht vergessen werden darf auf die Frauen freien Standes ('Hofdamen'), die in der Umgebung des Herrschers, seiner Gemahlin und ihrer Töchter anzutreffen waren - Titel oder genaue Aufgaben sind allerdings nicht bekannt. Wie groß der gesamte Hofstaat des Königs war, wie viele Personen mit dem Herrscher jeweils von Pfalz zu Pfalz zogen, lässt sich allerdings nicht mit Sicherheit sagen. Schätzungen sprechen von Größenordnungen zwischen 300 und 1000 ...
Eine besondere Macht- und Vertrauensstellung ergab sich für die Inhaber der Hofämter dadurch, dass sie einzigen Beamten waren, die direkten Zugang zum König hatten (in Angelegenheiten, die ihren jeweiligen Tätigkeitsbereich betrafen und in der entsprechenden Rangordnung); alle anderen Bittsteller mussten sich um die Vermittlung durch die Obgenannten bemühen. Nicht uninteressant dürfte in diesem Zusammenhang der Verweis auf die obgenannte Besetzung der Ämter mit Vertretern verschiedener Völkerschaften sein, bestand doch die Wahrscheinlichkeit, beim 'eigenen' Vertreter eher Gehör zu finden ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Das Frankenreich
Frühmittelalter

Capella regis - die Hofkapelle der Frankenkönige
Die Hofkapelle mit ihren Kappelanen gehörte zu den Institutionen des Karolingerhofes (und später zu jenen aller europäischen Königshöfe). Ihr oblagen die geistlichen Belange des Hofes ebenso wie jene schriftlichen Verwaltungstätigkeiten, die in der Merowingerzeit noch - nach römischem Vorbild - von weltlichen Kanzleireferendaren erledigt worden waren, nun aber, als Folge der schwindenden Schriftlichkeit, ebenfalls von Geistlichen übernommen werden mussten. Die Hofkapelle übernahm somit auch die Aufgaben der königlichen Kanzlei, ihre Kapläne wurden zu den Notaren der Frankenkönige (und später der Salier und Ottonen) und des Reichs, ihre Leiter waren einflussreiche Persönlichkeiten, aus deren Reihen die Kaiser nicht selten Bischöfe ernannten.
Der Begriff 'capella' geht auf den Mantel (cappa) des Heiligen Martins zurück, der als bedeutsame Reliquie im Besitz der Merowingerkönige (679, Theuderich III.) bezeugt ist. 710 geht er auf den karolingischen Hausmeier Grimoald über und bildet später das Herzstück des königlich-karolingischen Reliquenschatzes, der nun selbst als capella benannt wird. Der Mantel war von derart großer Bedeutung, dass ihn die fränkischen Könige laut Walahfried Strabos Zeugnis mit in die Schlacht führten.

Im Laufe des 8. Jahrunderts fand eine Übertragung - besser Erweiterung - des Begriffes 'capella' statt: Nun wurde auch der Ort, an dem dieser Reliquienschatz verwahrt wurde, nämlich das Oratorium der jeweils als Aufenthaltsort dienenden Königspfalz - schließlich wanderte der Schatz mit den Reisekönigen - als 'capella' bezeichnet. Um 800 wurden bereits alle Pfalzoratorien als capellae bezeichnet, später geht der Name auf alle königlichen Eigenkirchen und auf die der weltlichen Größen über; ein weiter Weg vom Mantel der Heiligen Martins zu unseren Kapellen ...
Der 'capellanus' schließlich, also die Person des Geistlichen, wird zuerst 741 in Verbindung mit dem Hausmeier erwähnt - somit zu einer Zeit, in der der Martinsmantel bereits einige Zeit im Besitz der Karolinger ist. Vermutlich geht seine Bezeichnung auf die Aufgabe, die kostbare Reliquie zu hüten zurück; zumindest bezeugt Walahfried ausdrücklich den Zusammenhang zur 'cappa' des Martin.
751 wurde Pippin der Jüngeren zum König akklamiert, der letzte (längst nur noch nominelle) Herrscher aus dem Merowingergeschlecht, Childerich III., abgesetzt; damit wurden die capellani zu Hofgeistlichen, die fortan regelmäßig in der Umgebung des Königs bezeugt werden. Sie bilden eine eigene Gemeinschaft, die sogenannte 'capella' (auch als 'capella regia' oder 'palatii' bezeichnet).
Zu den Aufgaben der Kappelanen zählte nicht nur - wie bereits oben erwähnt - die Behütung der heiligen Reliquien und - in ihrer Funktion als Hofgeistliche - als vornehmste Aufgabe die Abhaltung des herrschftluchen Gottesdienstes; zunehmend erhalten sie weitere Aufgaben: die der Beurkundung, der Verwaltung und auch der Einsatz in diplomatischen Missionen. Die schriftliche Verwaltungstätigkeit der Kanzlei liegt nun - anders als noch in der Merowingerzeit - vollständig in der Hand der Kapellane.
In ihrer Tätigkeit als Urkundenschreiber werden sie als 'Notare' bezeichnet, sie erhalten dafür einen eigenen Ressortleiter, der den Titel 'Kanzler' führt, und dessen Stellung immer bedeutsamer wird. Allerdings bleibt er dabei immer noch dem obersten Kapellan (dieser wird seit 825 als 'Erzkapellan' (archicapellanus) bezeichnet) unterstellt.
Die Hofkapelle überlebt den Zerfall des karolingischen Reiches. An den Höfen der Nachfolgestaaten werden jeweils eigene Hofkapellen, wobei die Bezeichnung 'Erzkapellan' für den Leiter in vielen Ländern bald durch die des 'Erzkanzlers' ersetzt wird. Die Hofkapellen behielten auch ins hohe Mittelalter hinein ihre Wichtigkeit (speziell die Ottonen machten großen Gebrauch von der Institution, aus deren Reihen sie viele Reichsbischöfe ernannten), die erst mit dem Investiturstreit' abzuklingen begann. Die Aufgaben der Kanzlei begannen sich zu verselbstständigen, die Hofkapelle verlor ihre politischen Bedeutung und behielt nur ihre religiösen Aufgaben am Königshof. Und heute? Heute bezeichnet der Kaplan den Hilfsgeistlichen in der Pfarre, der noch keine Alleinverantwortung trägt ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Technologie des MA
Salzgewinnung

Methoden zur Salzgewinnung im Mittelalter
Salz ist allen Säugetieren lebensnotwendiger Stoff. Der Mensch benötigt täglich etwa 6 Gramm davon für die Funktion seines Organismus, schließlich nimmt das weiße Kristall Einfluss auf so wichtige Körperfunktionen wie das Nervensystem, den Blutkreislauf und die Verdauung. Ein Zuviel daran (an dieser Stelle ein Achtung! an alle notorischen Pommes- und Erdnussliebhaber und Kartoffelsalzern unter unseren Lesern) kann dabei ebenso schädlich sein wie ein Zuwenig - man denke nur an schädlichen Bluthochdruck und dergleichen.
Anders als das Tier, verwendete der Mensch das Salz bereits frühzeitig für die geschmackliche Verbesserung seiner Nahrung, wahrscheinlich schon seit seiner Sesshaftwerdung. Aber auch und vor allem für die Konservierung seiner Lebensmittel stellte das Salz über lange Jahrhunderte hinweg das wichtigste Hilfsmittel dar. Man denke nur an seine bakterienhemmende Wirkung oder daran, wie es die Austrocknung von Fleisch verhindert.

So wurde es zur Pökelung von Fisch und Fleisch verwendet, zur Konservierung von Gemüse, Eiern und Milchprodukten wie Butter und Käse. Hält man sich nur die rigiden Speisevorschriften im christlichen Mittelalter vor Augen, die in Fastenzeiten Fleischgenuss strikt untersagten, und die Tatsache, dass in diesen Zeiten etwa der Hering landesweit einen begehrten Ersatz fürs Fleisch darstellte, dafür aber für den langen Transport von den Fanggebieten erst haltbar gemacht werden musste (man hat etwa für die Haltbarmachung von fünf Fass Heringen ein Fass Salz zu veranschlagen!), kann man sich unschwer verdeutlichen, wie wichtig das Salz der damaligen Zeit gewesen ist.
Dementsprechend begehrt war 'das weiße Gold', dementsprechend viel Reichtum ließ sich aus der Förderung und dem Handel damit gewinnen, aus der Ablösung der entsprechenden Regalien. Von den diversen Förder- und Produktionsstädten sprechen uns heute noch die zahlreichen Orte, die das Salz im Namen führen oder das alt- beziehungsweise mittelhochdeutsche 'hal', wie etwa im bekannten Hallstatt, wo das älteste uns bekannte Bergwerk bereits im Neolithikum entstand - zum Zwecke des Salzabbaus, wofür sonst?
Reichtum aus Handel kann stets nur erwachsen, wenn die gehandelten Güter aufgrund lokaler Knappheiten einen großen Wert erzielen; so der Fall beim Salz, dessen Verteilung im Mittelalter ein sehr ungleiche war. Das hängt einerseits mit den Vorkommen, andererseits aber auch mit umweltbedingten und mit den technischen Gegebenheiten, auf die eine Gesellschaft zurückgreifen kann, zusammen. So finden maritime Länder im angrenzenden Meer natürlicherweise ein unerschöpfbares Salzdepot vor, aus dem etwa die Griechen des Altertums ihren gesamten Bedarf decken konnten
Welches waren also die Methoden, mit denen im Mittelalter Salz gewonnen wurde? Im Wesentlichen drei: Neben der Gewinnung aus dem salzhaltigen Meerwasser konnte das Salz untertags abgebaut werden, oder aber durch Anreicherung von Wasser in Solen und anschließender Erhitzung gewonnen werden - ein Vorgang, der die natürliche Verdunstung durch Zuhilfenahme des Feuers ersetzt oder beschleunigt.
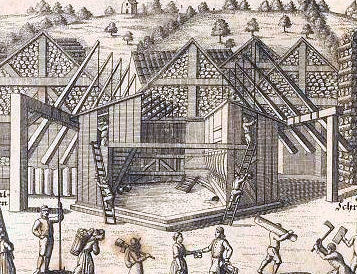
Während nun der ob seiner höheren Sonneneinstrahlung bevorzugte Mittelmeerraum seinen Salzbedarf nahezu ausschließlich duch das Anlegen von ausgedehnten Salzgärten (Voraussetzung für das Anlegen solcher war und ist allerdings das Vorhandensein ausreichend ausgedehnter, flacher Küstengebiete), in denen das Meerwasser verdunstete und ein wenig reines und daher minderqualitatives Salz zurückließ, war dies aufgrund schlechterer Witterungsverhältnisse im Norden nicht in der selben Form möglich.
Während der Abbau unter Tag (Beispiele dafür waren Bergwerke in Siebenbürgen, bei Krakau, aber auch in Katalonien) mit der verfügbaren Technologie einen hohen Aufwand bedeutete und daher im gesamten Mittelalter nur von geringer Bedeutung blieb, wurden recht häufig Zugänge zu natürlichen Salzstöcken ergraben, in welche dann Wasser eingeleitet, das Salz ausgelaugt und die 'Sole' - nach vollständiger Sättigung - gefördert und in hölzernen Rinnen bis zur Salinenhütte abgeleitet wurde. Kennzeichnend für die Salzgewinnung war während des gesamten Mittelalters die enge räumliche Nachbarschaft von Salzvorkommen und den Produktionsanlagen, den Salinen.
Fünf Produktionsschritte waren erforderlich, um an das Endprodukt zu gelangen: Zuerst wurde die Sole mit Hilfe von Schöpfwerken zutage gefördert. Anschließend musste die Sole über Rinnen und Rohrleitungen zu den Pfannen der der sogenannten Siedehäuser transportiert werden (soferne der Solebrunnen nicht unmittelbar benachbart war). Durch Erhitzen der Pfannen verdampfte man die Flüssigkeit - zurück blieb das Salz, das anschließend in den Dörrhäusern noch getrocknet wurde. Zuletzt stand noch die Verpackung für den Transport an.
Zur Förderung kamen dabei Schöpfgalgen (Ziehbrunnen, bei denen das Gewicht am kurzen, Eimer und Seil am langen Hebelarm befestigt waren) ebenso zum Einsatz wie Haspelwerke mit Schwungrädern oder - seit dem 15. Jahrhundert - auch mechanisierte Schöpfwerke.
Ein sehr arbeisaufwendiger Vorgang, der in den Salinen Schichtarbeit rund um die Uhr erforderte um an die nötigen Salzmengen zu kommen. Knochenarbeit, bei der eine strikte Arbeitseinteilung eingehalten wurde. So setzte sich in Halle an der Saale eine solche Schicht aus 8 Hasplern, die für die Bedienung der Haspel verantwortlich waren, 2 Störtzern (welche die Eimer mit der Sole in einen Sammelbehälter zu leeren hatten) und 2 Zäpfern, die aus diesem Behälter die Zober befüllten, welche die 16 Soleträgern anschließend in die Siedehäuser tragen mussten.
Heutzutage, dank des Fortschrittes der Technik geht's leichter und den Beruf des Soleträgers gibt es auch nicht mehr. Kein großer Nachteil, wenn man die Anstrengungen bedenkt ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Redensarten
und Handwerk

Alte Redensarten - Zittern wie Espenlaub ...
Da sitzen wir nun und zittern und von vielerlei Art können die Gründe dafür sein: Die Kälte, die der Winter ins Land treibt, wäre zu nennen; die Angst, nachdem wir uns an schaurigem Schauspiel ergötzt haben und anschließend, in der Stille der Nacht, jede Diele knarren hören; Ungeduld, die uns eine Sache kaum erwarten lässt. Ärger und Zorn vielleicht, wenn sie nur heiß genug in uns kochen ...
Ist dieses Beben ausnehmend stark, dann sagen wir, der Bemitleidenswerte 'zittere wie Espenlaub', und wir meinen damit auch, dass er gar nicht mehr lassen kann davon; manchmal sind dann sogar noch weitere Begleiterscheinungen damit verbunden - Zähnenklappern etwa, oder das nervöse Beknabbern der Nägel, Erbleichen, und dergleichen Erbaulichkeiten mehr. Das Französische, das die Wendung ebenfalls kennt, spricht etwas unbestimmter vom 'zittern wie ein Blatt.'.

Bereits in der Bibel findet sich häufig die Wendung 'mit Furcht und Zittern', welche uns zeigt - ähnlich wie der gebräuchliche Ausdruck 'mit Zittern und Zagen', der auf die Lutherübersetzung zurückgeht - wie sehr das Zittern schon frühzeitig mit Angst assoziiert wurde. Wohl aus ureigenster menschlicher Erfahrung. 'Ich kann nicht so schnell zittern, wie ich friere' hat dagegen eindeutig mit dem Kälteempfinden zu tun.
Der Zusammenhang des menschlichen Zitterns mit dem nervösen Rascheln des Laubes bei Wind, ist eine zu natürliche Assoziation, als dass sie die naturverbundeneren Menschen der Vergangenheit nicht benutzt hätten. Und so muss das Blatt auch in der mittelhochdeutschen Literatur schon früh dafür herhalten, um körperliche, aber auch mentale Zustände zu beschreiben: 'der vierde ..., der bidemt vor girde als ein loup' Einen Bauern, den der Helmbrecht eins beraubt hatte, lässt der Autor Wernher der Gärtner aus lauter Gier nach Rache zittern wie Laub, als sich ihm die Gelegenheit zur Revanche bietet.
Und der Zusammenhang mit der Espe? Auch der findet sich bereits im Mittelhochdeutschen, wenn etwa die Grimms in ihrem Deutschen Wörterbuch eine Quelle folgendermaßen zitieren: 'er bibent unde wagente vor sorgen als ein espin loub' (er bebte und wurde erschüttert vor Angst wie ein Espenlaub.) Oder, einer späteren Epoche zugehörig, den Prediger Mathesius (1562): 'der engstiget und förchtet sich und erschrickt vor einem rauschenden blat oder bebet on underlasz wie ein espenlaub'.
Was aber trieb unsere Vorfahen, der Espe socherart zum geflügelten Wort zu verhelfen und nicht einem andern Baum? Wohl die besondere Beschaffenheit ihrer Blätter; mit einem langen Stiel ausgestattet, sind sie dafür verantwortlich, dass die Espe beim leiseststen Luftzug schon zu zittern beginnt, dann, wenn in allen anderen Wipfeln noch Ruh' ist. Nicht umsonst wird sie, die zur Familie der Pappeln gehört, auch als Zitterpappel bezeichnet.
Doch halt - den Stiel und die besondere Beschaffenheit der Blätter als Grund für das Zittern der Pappel zu nennen, ist natürlich Unsinn. Der wahre Grund liegt tiefer und führt weiter in die Vergangenheit zurück. Und hat mit dem Kreuzestod Christi zu tun! Was genau, darüber sind sich die regionalen Erzählungen allerdings nicht einig.
Heißt es einerseits, die Espe zittere, weil sie die Kreuzigung miterleben musste, meinen andere Überlieferungen, sie habe dies als Strafe zu ertragen, weil sie sich als einziger Baum dem Leiden Christi gegenüber teilnahmslos gezeigt habe, während alle anderen Bäume bebten. Aber auch Mutmaßungen, ihr Zittern rühre davon, dass sich der Verräter Judas an einer Espe erhängt hätte, oder gar davon, dass das Kreuz des Herrn aus ihrem Holz gefertigt gewesen wäre, finden sich.
Wer allerdings jetzt, wo es doch schon Psychiater gibt, für den empfindsamen Mann, der schon gerne mal eine Träne vergießt, ebenso wie für stets missverstandene FrauInnen, für das hausübungs- und auch sonst gestörte Kindlein und auch für den liebeskranken Pudel, wer jetzt also gram vor Mitleid nach einem Baumpsychologen ruft, für das solcherart schlimm und stets gebeutelte Esplein, der tut so, als wolle er 'der Espe das Zittern lehren' - also unnütz. Schließlich gehen Bäume nicht zum Psychiater!
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Gesellschaft im Mittelalter

Leben am Hof - Teil 1: Fest und Alltag
Das Leben am Hof - sei es an des Kaisers Pfalz, an der Königsresidenz, oder auch am Landesfürstenhof oder an jenem des Erzbischofes -, träumten wir nicht alle schon einmal davon, in einer Reihe zu stehen mit all jenen prächtig gewandeten Herren, davon, die holden Damen und noch holderen Mägdelein zu bewundern, dem Favoriten beim Tjosten zuzujubeln und anschließend an der Festtafel das üppige Mahl und die edelsten Tropfen zu genießen?
Schließlich will man den den lieben langen Tag eher an der Seite Robert Taylors - äh, Lancelots und Ivanhoes, beim Jagen und Trinken und Damenschauen verbringen, denn im Büro - Tür an Tür mit dem alten Griesgram von Chef, über verstaubten Ordnern oder vor flimmernden Bildchen erregender Kurven und EXCEL-Diagramme.
Aber, so fragen wir uns, wie exakt entspricht das Bild, das uns Hollywood in Cinemascope bietet, dem wirklichen Leben, wie es damals am fürstlichen Hof stattfand? Ihr mögt ja einwenden, jene Helden, von denen die Rede war, verbrachten ihre Zeit im Dienste des guten Königs Artus, des besten aller vergangenen und noch kommenden Herrscher, und an dessen Residenz war stets Feiern angesagt und Aventiure und niemals Langeweile - nun ja, letztere zumindest selten und allenfalls zu Beginn einer Geschichte - also wird das Bild so falsch nicht sein!

Doch nicht überall ist Caerleon und nicht jeden Tag kann Pfingsten sein, und so wundern wir uns, wie denn das Leben am mittelalterlichen Fürstenhofe ausgesehen hat - und dabei interessiert uns der Tagesablauf des Höflings und das Dienstpersonals, der Herrin des Hauses und ihrer Damen ebenso, wie jener des Fürsten selbst. Also lasst uns beginnen - mit einer neuen Serie und dabei gleich mit der Warnung vor dem Alltag, damit alle jene Knäblein, die als Berufswunsch den des Herrschers hegen, gleich voran erkennen mögen, ob sie sich den eignen würden für den Posten seiner Magnifizenz, des Herzogs der Buckligen Welt oder jenes des Königs vom Sauerland.
Das spätere Mittelalter also - um endlich zu beginnen - kennt die sogenannten Hofordnungen, mit denen versucht wurde, das Leben eines Hofstaates zu reglementieren. Davor können wir nur auf Beschreibungen von Autoren zurückgreifen, wie auf das 'de ordine palatii' des Hinkmar von Reims, aus dem ausgehenden 9. Jahrhundert, oder aber auf literarische Werke.
Letztere haben den Nachteil, dass sie uns fast ausschließlich von spektakulären Ereignissen berichten, von besagten Festen und Kämpfen und wundersamen Erscheinungen - hingegen kaum vom tristen Alltag, der doch auch hin und wieder (vielleicht öfter, als den Hofsassen lieb war) geherrscht haben muss, wenn man etwa der langen Winterzeit gedenkt, in der sich das Tageslicht bereits am späteren Nachmittag verabschiedet. Damals nämlich war der Tagesrhythmus noch im wesentlichen Ausmaß bestimmt vom Vorhandensein natürlichen Lichtes ... Doch Achtung, das bedeutete für den fürstlichen Untertan keinesfalls Untätigkeit; allenfalls ein kürzerer Arbeitstag war angesagt, wie wir noch hören werden.
1136 wurde in England mit der Constitutio domus regis, die noch unter König Heinrich I. erarbeitet wurde, die erste Vorläuferin späterer Hofordnungen erlassen. Das Handbuch zählt alle Hofämter auf und listet die Gehälter der Bediensteten ebenso auf wie ihre Rechte und Pflichten und sollte bis ins späte 13. Jahrhundert Gültigkeit behalten.
Hofordnungen sind aus Frankreich dann seit 1261 überliefert, aus Aragon ab 1266, aus England - wie besagt - seit 1279 und Burgund seit 1407. Interessanterweisse fehlt eine solche Ordnung lange Zeit für den deutschen Königs- und Kaiserhof, ein Umstand, der wohl damit zu tun hat, dass der Kaiser, länger als alle anderen Herrscher Europas, seine Regierungsgeschäfte immer noch von Pfalz zu Pfalz reisend betrieb. Allerdings finden sich Hofordnungen für die einzelnen Territorialherrschaften des deutschen Reiches ab dem frühen 15.Jahrhundert - etwa für Brabant, Sachsen, Tirol, Bayern, Brandenburg
Für den Wiener Hof der Habsburger - denen doch eine gewisse Vorliebe für starres Hofzeremoniell nachgesagt wird - findet sich eine derartige Ordnung folgerichtig erst mit dem Beginn des 16. Jahrhunderts, einer Zeit also, in der auch das Kaisertum sesshaft wurde.
In weiterer Folge soll hier das Leben am Fürsthofe beschrieben werden, insbesondere, inwieweit Wirklichkeit und schöner Schein auseinanderklafften. Und - das lasst euch schon vorab gesagt sein - das Klaffen konnte gar ein weites sein ...
Weiter zum zweiten Teil der Artikelserie.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Redensarten
und Handwerk

Alte Redensarten - Den Stab über jemandem brechen, ...
... das bedeutet auch heutzutage noch kaum Gutes für den Bedauernswerten, dem das Schicksal widerfährt, solcherart beurteilt zu werden. Früher jedoch, in den Zeiten mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Gerichtsgebarung, waren damit bedeutend mehr und auch tiefgreifendere Unanehmlichkeiten verbunden - zumindest für den Angeklagten, der sich einer Gerichtsverhandlung zu unterwerfen hatte. Denn auf den Gerichtsvollzug geht diese Redensart zurück.
Gesten und Rituale und die zugehörigen Objekte waren für die mittelalterliche Herrschaftspraxis von großer Bedeutung; der Mensch dieser Zeit war visuell geprägt und sollte und wollte durch Symbole - seien es nun Handlungen oder materielle Dinge - beeindruckt werden. Ein solcher zeichenhafter Gegenstand, der ein Amt und die damit zugehörige Gewalt des Trägers verkörperte, war der Stab.
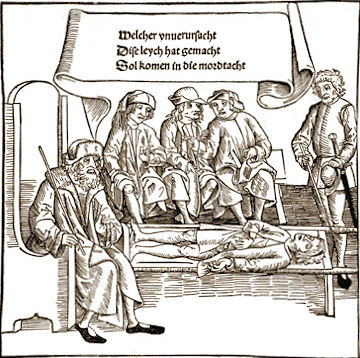
Wir finden ihn im Krummstab der Bischöfe; dieser sollte ja nicht nur Ausdruck für die Macht seines Trägers sein, sondern diesen auch daran erinnern, sich seines Amtes würdig zu erweisen. Das kaiserliche und königliche Szepter stellt die höchstrangige weltliche Ausformung dar; aber auch andere hohe Würdenträger, Herzöge, Fürsten und Landesherren, können Stabträger sein. Herolde und Boten konnten einen Stab mit dem Zeichen ihres Herren mit sich führen, als Ausweis für ihren Auftrag.
Auch militärischen Führern wurde der Marschall- oder Feldmarschallstab zum Abzeichen der ihnen übertragenen Gewalt. Ihre Berater bildeten den Generalstab, aber nicht nur dessen Mitglieder konnten 'Schulden haben wie ein Stabsoffizier'.
Am augenfälligsten tritt uns der Stab möglicherweise im Rechtswesen entgegen, wo er als Richterstab Verwendung findet. Letzterer steht für die Tugendhaftigkeit und Gerechtigkeit des Richters, und er ist es auch, der zur titelgebenden Redensart Anlass gegeben hat.
Um Recht zu sprechen, benötigte der Richter den Stab, eines der ältesten germanischen Rechtssymbole, das wir kennen; dieser ist Ausdruck der ihm verliehenen Macht zur Rechtssprechung. Folgerichtig hat ihn der Richter während der gesamten Dauer der Gerichtsverhandlung in der Hand zu halten.
Mit ihm wird die Verhandlung eröffnet ( 'Da ich mit gewaltigem Stab zu Gericht saß ...', beginnt manche Urkunde), auf ihn ist zu 'staben' oder an 'an den Stab zu geloben' (vergleiche Wolframs Parzival: 'sus stabt er selbe sînen eit' ), also der Eid zu leisten, während er berührt wird.
Und schließlich wird dem zum Tode Verurteilten der Stab über dem Haupt zerbrochen ( 'Nun helfe dir Gott, ich kann dir nicht ferner helfen') und vor die Füße geworfen; heutzutage meint 'den Stab über jemanden brechen', sich ein - vielleicht zu hartes - abschließendes Urteil über ihn zu bilden, was aber immerhin noch erträglicher sein dürfte als die ursprüngliche Gebarung.
Aber auch solche Redensarten wie 'Soweit der Stab zu gebieten hat, ist ein rechtes Gericht' und 'Wen der Stab begreift, der wird antworten' (was meint, dass der vor Gericht Geladene die Pflicht hat, zu erscheinen), zeigen die enge begriffliche Verbindung des Stabes zur Gerichtsbarkeit.
Der ursprüngliche Richterstab war aus Holz, bevorzugt aus dem der Hasel, aber auch Ahorn, Kirsche oder Nuss fanden Verwendung. Möglicherweise wurde er anfangs für jede Gerichtssitzung neu geschnitzt - zumindest war das nach jedem Zerbrechen nötig. Aus der späteren Neuzeit sind kunstvoller ausgeführte Stäbe erhalten; gedrechselt, mit Knäufen und Kugeln, manchmal auch mit Vergoldungen und Siberbeschlägen versehen, konnten sie auch Namen, Wappen und andere figürliche Darstellungen tragen, die mit dem Thema Gerechtigkeit zu tun haben.
Einen solchen Stab zerbricht man nicht mehr gerne. Daraus lässt sich aber nicht automatisch folgern, dass deswegen weniger Todesurteile ausgesprochen wurden; angenommen wird, dass einfache Ersatzstäbe für das Zeremoniell herhalten mussten. Wie tröstlich ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Gesellschaft im Mittelalter

Frauenkarrieren im Mittelalter - Teil 3 : Die Heilige und Äbtissin - Scholastica
Zurück zum vorigen Teil der Artikelserie.
Stellte der vorangegangene Artikel der Serie über Fauenkarrieren im Mittelalter mit Christine von Pisan eine sehr selbstbewusste und selbstständige Vertreterin des weiblichen Geschlechts dar, die im 14. Jahrhundert als Schriftstellerin einen bedeutenden Platz in einer von Männern dominierten Domäne einnahm, so wollen wir heute einige Jahrhunderte in der Zeit zurückgehen und eine etwas standesgemäßere 'Berufslaufbahn' vorstellen. Nämlich die einer Vorsteherin einer Klostergemeinschaft, die es sogar zur Heiligen brachte.
Wir sprechen heute über Scholastica von Nursia, die die Schwester - vermutlich Zwillingsschwester - des Benedikt von Nursia gewesen ist, des Begründers des Benediktinerordens und Verfassers jener 73 berühmten Regeln, die das Klosterleben so vieler Epochen nachhaltig geprägt haben. Geboren um 480 n.Chr, fällt ihre Wirkungszeit und die ihres noch berühmteren Bruders in jene Umbruchsphase zwischen Spätmittelalter und Frühmittelalter, in die Zeit der Völkerwanderung, in der sich das Mönchstum, vom Osten des ehemaligen Reiches ausgehend, auch im Westen zu etablieren begann.
Alle Nachrichten, die wir über Scholasticas Leben haben, gehen auf das Buch II der Dialoge Gregor des Großen zurück, in dem er über das Wirken Benedekts berichtet; weitere Mitteilungen aus jener Zeit sind uns über sie nicht bekannt, weshalb manche Forscher sogar meinten, ihre Existenz abstreiten zu können. Ebenso, wie Benedikt selbst: beide wären dann von Gregor als Idelafiguren erschaffen worden - eine Behauptung, die aber wohl als zu weit hergeholt erscheinen darf.

Neben der bekannten Vita Benedikts, die ihn nach bewegten Jahren schließlich nach Monte Cassino führt, erfahren wir auch wenige Details von Scholasticas Leben. Bereits von Kindheit an soll sie Gott geweiht gewesen sein. Ob sie, die traditionell als erste Benediktinerin gilt, tatsächlich in einem Kloster lebte, oder - wie in jener Zeit für Frauen häufig üblich - als 'geweihte Jungfrau', lässt sich aus Gregors Beschreibung nicht mit Sicherheit erschließen. Jedenfalls soll sie ihren Alltag stets in der Nähe des Bruders verbracht haben - zuerst im Kloster in Subiaco, dann bei Monte Cassino selbst, und sich dabei auch in regelmäßigen Abständen mit ihm zu geistlichen Gesprächen getroffen haben.
Um ein solches Treffen zwischen ihr und dem Bruder - ihr letztes - rankt sich eine schöne Legende: Als Benedikt wieder einmal die Schwester besuchte und der Tag schließlich um war, wollte er zurück ins Kloster aufbrechen. Er lehnte ab - wohl um die Nacht nicht außerhalb seiner Mönchszelle verbringen zu müssen und damit gegen eine Regel zu verstoßen. Sie aber betete zu Gott - woraufhin ein Gewitter aufkam und Benedikt an der Heimreise hinderte. Gott hatte ihren Wunsch erfüllt. Gregor begründete dies in seinen Dialogen mit der Erklärung, weil 'sie mehr liebte'.
Benedikt blieb also, vom Unwetter gehindert, die ganze Nacht bei der Schwester, in erbauliche Gespräche übers Himmelreich vertieft, und verließ sie erst am folgenden Tag - ein Abschied für immer. Denn drei Tage später verstarb Scholastica im Kreise der Mitschwestern - ihre Seele aber sah Benedikt in einer Vision in Gestalt einer Taube in den Himmel aufsteigen, wodurch er große Freude empfand. Er ließ den Leichnam der Schwester nach Monte Cassino bringen und sie in jenem Grab bestatten, das für ihn bestimmt war; nach seinem Ableben leistete er ihr dann Gesellschaft ...
Gregor zeichnet die Scholastica als Frau, der die Gaben vollkommener Gottesliebe und wunderwirkenden Gebetes gegeben war. Im 8. Jahrhundert sollen Teile ihrer Gebeine als Reliquen nach Fleury und Le Mans gebracht worden sein. Alberich von Montecassino erweiterte die Geschichte der Scholastic im 11. Jahrhundert schließlich noch um einige angebliche Wundergeschichten. Kein Wunder also auch, dass Scholastica heiliggesprochen wurde. Das Doppelgrab der Geschwister soll übrigens 1944, nach den Zerstörungen durch die damals stattfindenen alliierten Angriffe, wieder wieder zum Vorschein gekommen sein.
In jener Umbruchsepoche zwischen Antike und Mittelalter kam es übrigens gar nicht so selten vor, dass Geschwisterpaare als Gründer von Mönchs- bzw. Monialengemeinschften in Erscheinung traten - dies meist in Form von Doppelklöstern; zum Beispiel seien hier der Heilige Pachomius und seine Schwester genannt. Auch konnten Frauen bereits in der Spätantike und auch später als Gründerinnen und Leiterinnen von Klöstern hervortreten - im Mittelalter gab es sogar Beispiele dafür, dass Frauen auch Doppelklöstern vorstehen konnten und ihnen somit im geistlichen Umfeld doch gewisse Aufstiegschancen offenstanden ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Redensarten
und Handwerk

Alte Redensarten - Jemandem auf den Leim gehen, ...
... das kann man heutzutage, in Zeiten von Investmentberatern, selbsternannten Experten (Schul-, Wirtschafts-, Finanz- und dergleichen mehr ...), Politikern, die um unser Wohl besorgt sind, und redegewandten Staubsaugervertretern schnell einmal; und das alles, obwohl die bezeichneten Berufsgruppen (für die selbstverständlich die Unschuldsvermutung gilt) zwar mit viel Überzeugungskraft, manch beeindruckender Statistik und vielen lustigbunten Prospekten arbeiten - aber gar nicht mit Leim selbst ....
Warum bezeichnen wir also jenen unseligen Zustand, wenn wir jemandem 'aufgesessen' sind, als 'auf den Leim gegangen'? Richtig, wie der erfahrene Leser an dieser Stelle es längst erahnt hat, geht diese Redensart, denn um eine solche handelt es sich wieder einmal, auf eine altehrwürdige Tätigkeit (nun ja, Tierschützer würden hier - wohl zurecht - einwenden, als so ehrwürdig könne man diese Tätigkeit wohl auch wieder nicht bezeichen) zurück, die sich bereits in der Antike nachweisen lässt. Nämlich auf die der Vogelfängerei. Und zwar im speziellen Fall auf die Vogelstellerei unter Verwendung von sogenannten Leimruten.

Heutzutage verboten - obwohl dieses Verbot leider noch längst nicht überall eingehalten wird -, funktionierte die Methode derart, dass man eine Rute oder Stange mit einem Leim- oder Pechgemisch bestrich. Wenn sich nun ein unvorsichtiges Vögelchen auf eine solche Leimrute setzte, klebte er fest, war also auf den Leim gegangen und dem Vogelsteller in die Falle.
Den Piepmatz dazu zu bringen, sich am Leim festzukleben, das war die wahre Kunst des Fängers und dazu gab es, abhängig von der gejagten Vogelart, unterschiedliche Methoden. Glück im Unglück hatte der Gefangene, wenn er anschließend sein Leben als Zier- oder Singvogel verbringen sollte; andernfalls blieb ihm nur noch ein kurzes, denn dann landete er auf der Speisetafel.
Einerseits konnte der Vogler versuchen, seiner Jagdbeute durch Berühren (Dupfen)zu fangen. Dazu verwendete er eine lange, zusammengesetzte Rohrstange, deren vorderes Ende einen in Leim getränkten Aufsatz trug. Zu dieser Methode finden sich zahlreiche Belege römischer Autoren (etwa bei Properz, Petronius, Ovid, u.a.; 'harundo' war die lateinische Bezeichnung der verwendete Rohrstange, die als kennzeichnend für die Berufsgrupp der Vogelsteller galt.) Diese Methode setzte einerseits wenig scheue Vögel als Beute voraus, andererseits die Möglichkeit für den Jäger, sich in der Nähe der Vögel zu verbergen.
Andererseits konnten zur Jagd mit der Leimrute Lockpfeifen, die Vogellaute nachahmten, oder auch Lockvögel selbst verwendet werden, die, in Käfigen postiert oder mit Riemen am Fuß an Äste gefesselt, allzu neugierige Artgenossen in die Nähe der leimbestrichenen Ruten bringen sollten. Mithin verwendete man auch Raubvögel als Lockmittel, welche die aufgebrachte Vogelschaft zu vertreiben suchte. Oder man lockte einen Fressfeind an, der sich im Köder leichte Beute erhoffte - und sich schlussendlich schwer getäuscht sah. In allen Fällen war nur ein Fehltritt vonnöten um dem Vogler auf den Leim zu gehen ...
Auch bestand die Möglichkeit, dem Lockvogel, der an langer Schnur gebunden war, eine kleine Leimrute selbst anzubringen ('Finkenstich' ). Stürzte sich ein Jäger auf diese vermeintliche Beute, war es um ihn geschehen. Unsere Märchen, etwa jenes von der goldenen Gans, an der alle, die sie berühren, festkleben, bewahren noch ein Andenken an diese Methode.
Rezepte für die Herstellung eines entsprechend Leimes finden sich auch. Der lieben Tiere (und unserer blutrünstigen Leserschaft) wegen, wollen wir auf hier auf eine genaue Anleitung zur Erzeugung verzichten - schließlich kann man heutzutage das Brathuhn bereits günstig und ohne großen Zeitaufwand im Supermarkt erwerben. Nur soviel sei verraten, dass entweder die Schale oder die Beeren der Mistel zur Erzeugung verwendet wurden, eventuell noch unter Zusatz von Mehl und Harz. Aber genug davon ...
Der Vollständigkeit halber sei hier noch erwähnt, dass dem Vogelsteller auch andere Fangmethoden zur Verfügung standen, etwa durch die Verwendung von Fallen ( 'Schlaggarne', Meisenkästen) und Ködern oder, indem man die Vögel in großflächige Netze oder Reusen trieb. Alternativ konnte man die Netze in bekannte Flugschneisen stellen ... pfui sagen wir da, dies wollen wir heutztage, in Zeiten von gesundem Fast Food und bekömmlicher Tiefkühlnahrung, bei uns nicht mehr sehen. Leider ist diese Methode in manchen südlichen Gegenden immer noch Brauch.
Wir jedoch meinen, bevor ihr euch ein Singvögelchen im Käfig zulegt, mögt ihr lieber die in vielen Städten frei zugänglichen Bestarien besuchen oder aber euch selbst ein fröhliches Liedlein pfeifen, wann immer euch danach ist. Eure Lieben und Nachbarn werden es euch herzlich danken ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Alte Maße

Alte Maße - das Fuder Wein
Alte Chroniken bilden für den Mittelalterbegeisterten eine wahre Fundquelle, wenn er an historischen Begebenheiten interessiert ist. Doch egal, ob es sich um Jan Enikels Fürstenchronik handelt, oder um Otto von Freisings Geschichte von den zwei Staaten , immer finden sich neben mehr oder weniger weltbewegenden Begebenheiten in Nebenbemerkungen auch viele Details, die uns Heutigen manches über die damalige Lebensführung verraten könnten - wenn wir über die Kenntnisse gewisser Begriffe Bescheid wüssten.
So bedeutet das Verständnis dieser Begriffe des damaligen alltäglichen Lebens zugleich ein besseres Verstehen der Lebensbedingungen. Nicht zuletzt handelt es sich bei solchen Begriffen um Maßeinheiten, deren Größenordnungen wir heutzutage - in den Zeiten von Kilogramm und Liter - nicht mehr so recht einschätzen können. Dem wollen wir versuchen in einer Folge von Artikeln abzuhelfen.
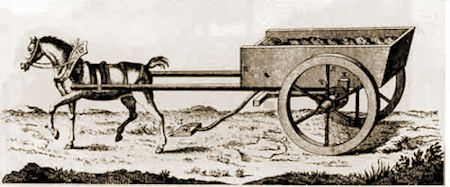
Also findet sich beispielsweise in der Lebensgeschichte des Erzbischofs Albero von Trier, eines tatkräftigen und bedeutenden Kirchenmannes des 12. Jahrhunderts, der mit Schwert und Lanze wohl ebenso vertraut war, wie mit der Bibel, folgenden ausagekräftige Sequenz, die uns staunen macht:
'... quingentos adduxit milites, et triginta vini carratas et immensam copiam victualium secum advexit, carris fere opinione infinitis'
(Zitat aus der Gesta Alberonis, dem Bericht über die Taten des Erzbischof Albero von Trier, Mitte 12. Jhdt.)
Sie berichtet uns also davon, wie der Erzbischof mit einem stattlichen Gefolge von 500 Rittern an den Hof des König Lothar kam - mit einem schier unermesslichen Wagenzug im Gefolge, auf dem Lebensmittel in unermesslicher Fülle und 30 Fuder Wein herbeigerollt wurden. Tatsächlich zum Staunen - aber andererseits müssen wir uns die Gegebenheiten der damaligen Zeit vor Augen führen - eine solche Menge an Lebensmitteln diente nicht nur der Sicherstellung des eigenen Wohls und dem der Gefolgsleute - wiewohl Albero durchaus im Ruf stand, Tafelfreuden und nächlichen Unterhaltungen zugetan zu sein - nein, es war wohl zuallererst Zurschaustellung des eigenen Reichtums und Wohlstandes - und damit wohlkalkulierte Politik.
Wohl wahr - aber das ganze Zeug musste immerhin auch gegessen und getrunken werden - schließlich will man ja nichts verderben lassen. Lebensmittel in unermesslicher Fülle, darunter können wir uns im Zeitalter von Supermärkten und vollen Kühlschränken schon etwas vorstellen. Aber was das Fuder sein soll, erschließt sich zumindest den verweichlichten Städtern unter uns nicht mehr so recht. Wohl aber, wenn wir im lateinischen Original von Wagen(ladungen) lesen ...
Den deutschen Begriff Fuder finden wir schon im althochdeutschen fuodar und im mittelhochdeutschen vouder mit der Bedeutung Fuhre aber auch sehr große Menge. Wir haben es also hier mit Wagenladungen zu tun - oder Mengen, die einer Wagenladung entsprechen, also einer Fuhre, wobei das Fuder sowohl ein Raummaß als auch ein Flüssigkeitsmaß darstellen kann.
Wenn also von einer Wiese von zehn Fuder Heu die Rede ist, dann handelt es sich um Grundstück, deren Heuertrag im Normalfall zehn Wagenladungen beträgt. Einachsig? Zweiachsig? Ein- oder Zweispänner? Wagen und Karren gibt es viele, daher variieren die Fudermaße regional je nach Gebrauch sehr stark.
Aber halt, bevor wir uns im Heu verlaufen! Eigentlich wollten wir wissen, was den Albero an Wein auf seinen Wagen mit sich karren ließ. Das Fuder als Flüssigkeitsmaß ist's, was hier zählt. Erinnern wir uns: Dreißig Wagenladungen, waren's, 30 Fuder also und somit - wiederum ist mit starken regionalen Schwankungen zu rechnen - macht bei bester Rechnung dreißig mal 1800 Liter. Alle Achtung meine Herren, da habt ihr nächtens viel zu leisten. Wenn der Wagen hingegen mit zwei Faß berechnet wird, gibt das immer noch 800 Liter pro Wagen - gänzlich verdursten müssen der gute Erbischof und seine Recken selbst bei dieser Rechnung nicht. Wir sind beruhigt.
Ein Fuder - die Weinmenge, die sich aus einer Fuhre Trauben pressen lässt, ein Fuder Heu, aber auch ein Fuder Erz, gleich etwa 20 Zentner, als Gewichtsangabe im Bergbau, jede dieser Mengenangaben mit großen regionalen Variationen - das kann schon recht verwirrend sein. Wenigstens ist es heutzutage einfacher geworden, mit den Maßen umzugehen. Wer hat denn in Zeiten der Krise auch noch ganze Fässer im Keller lagern? Und ein Liter Wein ist nun ein Liter Wein - ob nun in Neapel oder in Oberpullendorf. Also Prost!
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Gesellschaft im Mittelalter

Frauenkarrieren im Mittelalter - Teil 2 : Die Schriftstellerin - Christine de Pisan
Zurück zum Beginn der Artikelserie.
Frauen und Mittelalter - da haben wir also im vorangegegangenen, einführenden Artikel der Serie die Behauptung aufgestellt, das Leben der mittelalterlichen Frauen (wenn man denn von 'der' mittelalterlichen Frau überhaupt sprechen kann) wäre nicht in allen Fällen nach dem bekannten Klischee verlaufen, das da nämlich die bedingslose Abhängigkeit vom Mann - sei es nun der Ehemann, Vater oder ein sonstiger Vormund - gewesen wäre, einhergehend mit Rechtlosigkeit und Geringerschätzung. Es wird wohl in vielen Fällen so gewesen sein, das wollen wir gar nicht abstreiten.
Aber, so sagten wir eben, es gab in der damaligen Zeit auch Ausnahmen, Frauen, deren Leben aus vielerlei Gründen nicht diesem bekannten Schema entsprochen zu haben scheint. Nun denn, dann ist es an der Zeit Belege für diese Behauptung anzuführen. Das wollen wir tun - in lockerer Folge, ohne dabei einen Anspruch auf eine irgendwie geartete Ordnung zu erheben, weder zeitlich noch geografisch. Möge aus der Summe dieser Belege dennoch irgendwann ein Bild darüber entstehen, was denn - in Einzelfällen - möglich war an Karrieren ...
Die Erste, die in unserer Artikelreihe porträtiert werden soll, ist Christine von Pisan, die als eine der bedeutendsten Frauengestalten des späteren Mittelalters gilt, hat sie doch als erste Frau ihren Lebensinhalt durch die Schriftstellerei bestritten. Dass sie dies konnte, war natürlich neben ihrer unbestreitbaren Begabung auch den besonderen Umständen ihrer Herkunft und ihrer Lebensführung zu verdanken.

Der Reihe nach: Christine wurde 1365 in Venedig in eine gelehrte Familie geboren, wo ihr Vater, der Bologneser Professor und Astrologe Tommaso da Pizzano im Dienst der Serenissima stand. 1368 folgen ihre Mutter und sie dem Vater an den Pariser Hof des französischen Königs Karl V., wo sie in allen Ehren aufgenommen werden. Vermutlich wird die junge Christine von dieser priviligierten Umgebung sehr profitiert haben - zumindest hat sich ihre Ausbildung nicht nur auf das Erlernen von Handarbeitstechniken beschränkt. Vielmehr dürfte sie sich schon frühzeitig intensiv mit Literatur beschäftigt haben - zeigt sie doch ihre spätere schriftstellerische Tätigkeit als sehr belesen.
Vorerst verläuft ihr Leben in glücklichen Bahnen - so heiratet sie 1380 (als Fünfzehnjährige, in einem Alter, das damals für Frauen aus gehobenen Schichten als durchaus standesgemäß galt) einen pikardischen Edelmann, Etienne de Castel , der als Notar und königlicher Sekretär arbeitete. Eine glückliche Ehe, der eine Tochter und zwei Söhne entstammten, deren älterer - Jean Castel - später ebenfalls als Dichter tätig wurde.
Glückliche Zeiten vergehen leider nur allzuschnell - so auch in Christines Fall. Ihr Unglück wurde uns jedoch zum Glück; wer weiß, ob bei anderen Lebensumständen all das, was sie uns hinterlassen hat, überhaupt entstanden wäre ... Was ist geschehen? Eine Reihe von Schicksalsschlägen trifft sie. Der Tod Karls V. verschlechtert die wirtschaftliche Situation der Familie, ihr Vater verliert an Einfluss und stirbt und schließlich erliegt 1390 ihr geliebter Ehemann einer Seuche und lässt sie und die Kinder zurück. Fortan muss sie selbst für den Unterhalt aufkommen.
Dabei tun ihr ihre Ausbildung und Literaturkenntnisse gute Dienste, verdient sie sich doch vorerst als Kopistin. Ihr Leben war nichtsdestotrotz beschwerlich - so schreibt sie selbst: 'Streitfälle und Prozesse, das tägliche Brot der Witwen, setzten mir von allen Seiten zu' , ein Umstand, dem sie wohl nichtzuletzt ihrem Stand als 'unbehütete' Witwe zu verdanken hatte.
Um 1394 begann sie dann mit dem Schreiben erster eigener Gedichte, in denen sie vorest ihrem Schmerz um den Verlust des geliebten Ehemannes Ausdruck gab. Ihr Werk in Vers und Prosa sollte jedoch später eine erstaunliche Breite entfalten. Es gelang ihr, zahlreiche adelige Gönner zu gewinnen, darunter so bedeutende wie die Herzöge von Berry und Burgund oder Isabella von Bayern, für die sie prächtige Handschriften anfertigen ließ.
Als Beispiele für ihr überaus umfangreiches Werk sei die Lyriksammelhandschrift 'Cent ballades d'Amant et de Dame' erwähnt, aber auch die im Auftrag Philipps des Kühnen verfasste Verherrlichung des französischen Königtums 'Livre des fais et bonnes meurs et bonnes du sage roy Charles V' , in der sie neben zeitgenössischen Zeugnissen auch eigene Erfahrungen einbringt, oder das berühmte 'Livre de la Cité des Dames' ('Buch von der Stadt der Frauen'), in dem eine Idealgesellschaft der Frauen beshcrieben wird.
Sie scheut sich aber auch nicht, im Disput mit männlichen Zeitgenossen eigene Standpunkte zu vertreten, so etwa in der Auseinandersetzung um den 'Roman de la Rose' , diesen beruhmtesten französischen Roman des Spätmittelalters, dessen Fortsetzung von Jean de Meung betont frauenfeindlich gestaltet wurde, worauf sie in Briefen ihre Ablehnung zum Ausdruck brachte und damit eine Debatte unter Gelehrten und zugleich den ersten Literatenstreit auslöste.
1418, inmitten der unsicheren Zeiten des Hundertjährigen Krieges, zog sie sich aus Paris in das Dominikaner-Kloster in Poissy, in dem vermutlich ihre Tochter lebte, zurück. Für lange Zeit erlosch nun ihre schriftstellerische Tätigkeit, doch hat sie 1429 noch ein Gedicht zur Verherrlichung der Erfolge der Jeanne d'Arc veröffentlich. Um 1430 dürfte sie, die uns heute als eine gilt, die vehement für die Rechte der Frauen eingesetzt hat, dann gestorben sein ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Gesellschaft im Mittelalter

Frauenkarrieren im Mittelalter - Teil 1: Einführende Worte
Frauen und Mittelalter - ein kontroversielles Thema. Was gibt es darüber nicht bereits alles zu lesen und zu sehen in Bibliotheken, Filmen und in den Weiten des Netzes. Gelehrte Theoretiker und weniger gelehrte Praktiker bemüßigen sich allethalben, uns über das Verhältnis der Geschechter aufzuklären, darüber wie es damals stand um das Zusammenleben zwischen Mann und Frau und welche Möglichkeiten Letzterer in einer Welt offenstanden, die von grobschlächtigen Raufbolden beherrscht wurde.
Interessant ist dabei, dass das Resümee durchaus unterschiedlich ausfallen kann. Soll sich denn die mittelalterliche Maid nicht vor allem durch ihre Sittsamkeit und Gefügigkeit ihrem Herrn und Meister gegenüber auszeichnen? Man denke nur an die Behandlung, die Hartmanns Erec seiner Eneide zumutet, an das Schweigegebot, das er ihr auferlegt ( - und nun, liebe Männer, ruft nicht gleich aus 'ja das hätte was, bei der nächsten Fußball-Liveübertragung im TV!'). Demut, Güte und Liebreiz - und jederzeit ihrem Manne untertan! Tja, früher, früher war halt alles noch viel, viel ... ähem ... viel anders.
Andererseits schlendert unsereiner nicht selten über Mittelaltermärkte und fährt dann erschrocken zusammen, wenn ihm anstelle eines solcherart zarten weiblichen Wesens ein grimmig dreinschauendes Schwertweib über den Weg läuft? Mit zwei Bihändern über dem Rücken, unter deren Last wir selbst wahrscheinlich längst zusammengebrochen wären? Dann tritt uns nicht das schmachtende Burgfäulein vors geistige Auge, der wir gerne unsere Minnelieder singen würden, nein, wir entsinnen uns vielmehr schaudernd manch meuchelnder Frankenkönigin. Oder auch steineschleudernder Walküren, die ihre Ehegesponse in der Hochzeitnacht alles andere als freundlich behandeln.

Solcherart fragen wir uns, wie sie nun wirklich ausgesehen hat, die Situation der Frau im Mittelalter. Aber kann man überhaupt von einer einheitlichen Situation ausgehen? Oder muss man nicht unterscheiden zwischen dem frühen Mittelalter, als noch verschiedene Stammesrechte gebräuchlich waren, oder aber in den mittelmeerischen Gebieten altes römisches Recht, und späteren Zeiten, als Stadte und Handel ihren Aufschwung nahmen?

Und wie sieht es aus, mit den Unterschieden zwischen der Behandlung der adeligen Dame in ihrem Umkreis und jener der Bauersfrau? Und wie wirkte sich die zunehmende Entwicklung und wirtschaftliche Stärke der Städte auf die Stellung der dortigen Frauen aus? Die Stände? Gab es gar Berufe, in denen Frauen relativ selbstständig ihren Lebensunterhalt verdienen konnten? Welche Bedeutunge hatten Klöster und Bewegungen wie die Beginen?

Was ist mit dem schönen Bild, das uns die Epiker, die Minnesänger und die Troubadure von der mittelalterlichen Minne liefern? Nur ein Idealbild, das mit der Realität nichts zu tun hatte? Warum gab es dann weibliche Trobairitz, wenn Frauen nichts anderes zugestanden wurde als die Herrschaft über den Haushalt und allenfalls noch repräsentative Aufgaben?
Schließlich wären da noch die mächtigen Frauen zu erwähnen, die als Regentinnen ihrer unmündigen Söhne Politik machten, die zahlreichen Äbtissinnen, die Einfluss auf das öffentliche Leben nahmen, eine Eleonore von Aqitanien, und, und ... und auf der anderen Seite wiederum die Bauersfrau, von der wir aufgrund der spärlichen Quellen, kaum sehr viel mehr sagen können, als dass ihr Leben ein sehr hartes, weil äußerst arbeitsintensives war.
Nun, wir maßen uns hier kein Urteil an, wie's wirklich war. Vielleicht gab es ja diese eine Wirklichkeit gar nicht, und die Stellung mancher Frau wird sich wohl mehr aus dem täglichen Zusammenleben ergeben haben als aus den geltenden Rechten (ja ja, zuhause hat nicht immer der Herr die Hosen an ...). Also könnten wir's hier beenden. Andererseits schreiben wir nun einmal gerne übe das Mittelalter. Und über Frauen sowieso ...
Und so wollen wir zwar nicht schweigen - was vielleicht gut wäre, um nicht den Zorn von BihänderInnen schwingenden Feministinnen zu erregen -, sondern stattdessen einen anderen Ansatz wählen, um dieses Thema zu behandeln. Anstatt also einen allgemeingültigen Überblick geben zu wollen, werden wir in lockerer Folge einige Frauenkarrieren aus dem Mittelalter schildern. Vielleicht gelingt es uns so - parallel zu unserer Serie über Bedeutung der Ehe in der damaligen Zeit - nach und nach ein Bild davon zu vermitteln, was Frauen damals möglich war ...
Weiter zum zweiten Teil der Artikelserie.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Redensarten
und Handwerk

Alte Redensarten - Jemandem einen Korb geben, ...
... und das richtig, solches will gelernt sein. Davon weiß gewisslich auch manch Mägdelein, manch Galan aus unserer getreuen Leserschaft ein leidvolles Liedlein zu singen. Denn die Abfuhr in Liebesdingen - das nämlich ist gemeint, wenn wir davon sprechen 'einen Korb zu geben' - soll nicht zu unfreundlich und niederschmetternd ausfallen; schließlich sollen die Ambitionen der hoffnungsvollen Bewerber nicht derart zertrümmert werden, als dass sie allenfalls noch Tonsur und den Gang ins Kloster als verbleibenden Lebensweg ansehen. Andererseits mag eine zu freundliche Darlegung des abschlägigen Bescheids zu Missdeutung und weiterer aggressiver Bewerbung führen.
Ein Blick zurück in alte Zeiten, mag alles noch viel verwirrender erscheinen lassen. Denn damals - mag man mittelalterlichen Abbildungen trauen - war es anscheinend nicht unüblich, dem Liebsten, der heimlich unter dem Turm stand, einen Korb hinabzulassen, um ihn anschließend darin zu sich hochzuziehen. Nicht umsonst spricht der Volksmund: 'Zuerst die Arbeit, dann erst das Vergnügen.' Wie wahr, wie wahr! Merken wir hier an: Ursprünglich war's also fürs Erste gar nicht schlecht, einen Korb zu bekommen.

Aber vorsicht, warnen wir, ehe zu früh euch der Jubel übermanne - denn erstens, das Stelldichein soll heimlich verbleiben, niemand es bemerken. Allzulautes Frohlocken könnte euch um das Kosen bringen und um das Schmeicheln, dafür aber eine Menge Pech einbringen - wortwörtlich. Außerdem, werdet ihr, die ihr immer fragt, nun wissen wollen, wie denn das zarte Mägdelein soch ein herrliches Mannsbild wie ihr eines seid, dereinst überhaupt hätte hochziehen können?
Nun, wenn denn das Fräulein - wir behalten die Verkleinerungsform bei; ganz bewusst entsprechen wir nicht zeitgeistigen Strömungen, die uns dies verbieten wollen - schließlich ist das 'frowelin' dutzende Male in mittelhochdeutschen Texten zu finden -, wenn also dieses süße Objekt manch literarischer Begierde nicht gerade tägliche Übungen im Speer- und Steinewerfen und im Ringen getrieben, dann hat sie wohl eine Winde für ein erfolgreiches Stelldichein benötigt. Alternativ zum Korb am Seil - so schon gehört - konnte auch langes Haar herhalten; nur, wer will schon warten, bis es endlich lange genug?
Also wären wir wieder bei der Winde, wie sie etwa die Manesse'sche Handschrift zeigt. Gut, wenn das Kämmerchen der Jungfrau solch eine praktische Ausstattung aufbieten kann, gut, wenn der Korb herabgelassen ist. Und Vorsicht beim Hochziehen, auf dass das Knarren nicht etwa das gestrenge Väterchen aus dem Schlummer reiße ...
Woher kommt dann aber die negative Bedeutung, die wir der Redensart geben? Daher wohl, dass nicht jede Schöne dem Bewerber wohlgesonnen war. Und wenn dann schlechtes Blut herrschte zwischen Mann und Weib, dann konnte es wohl passieren, dass letzteres dem ersteren einen Korb sandte, der den heute gültigen Sicherheitsauflagen bei Weitem nicht mehr entsprechen würde - worin nämlich der Boden listigerweise - und List ist die Waffe der Frau - so gestaltet war, dass er unter dem Gewicht des Liebeskranken durchbrach.
Als Liebhaber durchgefallen , diese Bewertung hat ja auch heute noch einen durchaus unangenehmen Beigeschmack - damals war es dann durchaus wörtlich so zu verstehen. Womit wir der Sache Korb gleich eine zweite Redensart zuordnen konnten. Denn wer wüsste sonst, warum man bei einer Prüfung ausgerechnet durchfallen könnte ...
Und weil wir schon einmal dabei sind, all die Gemeinheiten zu erwähnen, die dem Fräulein in den Sinn kommen mögen - etwa weil ihr zu Ohren gekommen, dass der Vorstellige bereits alle Türme zwischen Winchester und Akkon bereist -, dann soll auch dies nicht unwähnt bleiben: Dass nämlich der Liebeshungrige so hoch gezogen werden konnte, dass der Boden fern, das Kämmerchen aber noch nicht nahe genug war, das rachsüchtige Mägdelein aber vorzeitig von der Winde ließ und stattdessen alleine, aber dafür mit jeder Menge Schalk im Herzen, in ihr Bettchen stieg.
Jemanden hängenlassen nennt sich das, was die Dame uns derart demonstrierte. Werden wir hängengelassen, vom Freund, Vertrauten oder wen auch immer, dann ist das bereits keine feine Sache. Damals aber wurde es peinlich - wenn nämlich der Hahn zu krähen begann und nach und nach das ganze Burggesinde zusammenlief um zu sehen, zu staunen, zu lästern und zu kichern.
Luther übrigens kannte unsere heutige Redensart übrigens in der Form 'durch den Korb fallen' , was unschwer auf die selbe Herkunft schließen lässt. Übrigens findet sich der Korb in vielerlei Brauchtum wieder, so etwa im 17. und 18. Jahrhundert in einer abgeschwächten Form. wenn die Umworbene dem Werbenden als Zeichen der Ablehnung einen bodenlosen Korb ins Haus schickte. So eine bodenlose Gemeinheit mag er dann gedacht haben - statt froh zu sein darüber, die Nacht nicht mehr in unbequemer Höhe verbringen zu müssen wie voreinst ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Gesellschaft im Mittelalter

Die mittelalterlichen Vorfahren und die Ehe - Teil 2: Isidor von Sevilla
Zurück zum ersten Teil der Artikelserie.
Die Ehe ... Wie soll er also aussehen, der Held, wie das edle Weib? Wie jene auswählen, die fortan und für den Rest unseres Lebens an unserer Seite weilen werden - in guten wie in schlechten Zeiten? (Nebstbei angemerkt: In mittelalterlichen Handschriften finden sich auch Hinweise zur Gestaltung der heutzutage so propagierten 'Lebensabschnittsgemeinschaften - doch darüber sei hier ein andermal berichtet.) Manch einer von uns steht ratlos vor der schweren Aufgabe, aus der großen Anzahl an holdlächelnden Jungfrauen die beste, manch eine davor, den wackersten Jüngling aus der Schar auszuwählen.
Da wir von Sælde und êre es uns nicht allein nur zur Aufgabe gestellt haben, unsere treuen Leser zu informieren, sondern darüber hinaus sie auch in schwierigen Angelegenheiten des Lebens zu beraten, wollen wir euch also bei dieser Entscheidung nicht alleine stehen und ob so großer Auswahl verzweifeln lassen. Denn bevor etwas über den Alltag der Ehe gesagt werden kann, muss erst die rechte Wahl getroffen sein. Und da - hört, hört - ist es uns gelungen, die erfahrensten Ratgeber (heutzutage würde man vom Eheberater und Beziehungscoach sprechen) für euch zu verpflichten, auf dass sie euch die Richtung weisen mögen.
Wer sind sie, wollt ihr jetzt sicherlich die Antwort, diese Weisen, die das können? Nun, es müssen Fachleute sein, ohne Zweifel. Autoritäten. Kapazitäten! Solche, die wissen, wovon sie sprechen. Schließlich ist uns der beste Rat für euch auch gut genug. Und darum, wer Geringerer sollte es sein als ein echter Heiliger, dem wir in dieser Angelegenheit das erste Wort erteilen, Isidor, dem guten Erzbischof von Sevilla nämlich, auf dass er euch treffliche Anweisungen gebe ...
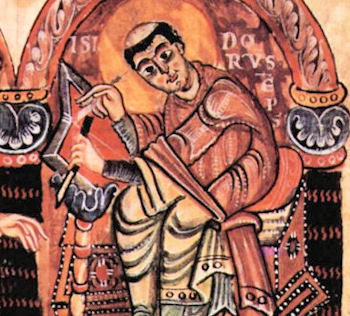
Zwar ist es schon eine Weile her, da Isidor seine Etymologiae verfasst hat, die 'wahre Bestimmung der Dinge', die als sein wichtigstes Werk gilt. Im frühen 7. Jahrhundert war es, als das Mittelalter noch ganz jung und frisch war - andere würden sagen in der ausklingenden Antike -, als er diese Enzyklopädie spätantiken Wissens im Reich der Westgoten verfasste. Dennoch, wer wären wir, um nicht auf die Meinung der Alten zu hören? Also lasst es uns tun, lasst uns auf seine Ratschläge lauschen.
Was er uns über unser Thema mitzuteilen hat, finden wir trefflich im IX. Buch der Etymologiae aufgeschrieben, worin er uns gar manches von den Sprachen, Völkern, Reichen, Kriegen, Bürgern und Verwandtschaften zu berichten weiß. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Krieg und Ehe, wie denn das zueinander passe, nun, das müsst ihr dann schon selbst herausfinden im Laufe vieler Jahre ... Aber zuerst seine Ratschläge, wie denn der geeignete Partner zu wählen sei:
'Bei der Auswahl des Ehemanns pflegt man [das Mägdelein, Anm.] vier Dinge zu beachten: Tüchtigkeit (virtus), Herkunft (genus), Schönheit (pulchritudo), Weisheit (sapientia). Von diesen ist die sapientia das Wichtigste für die Zuneigung in der Liebe.'
...
'Ebenso treiben bei der Auswahl der Ehefrau vier Dinge den Mann zur Liebe: Schönheit (pulchritudo), Abstammung (genus), Reichtum (divitiae) und gute Sitten (mores). Besser ist es, wenn man bei ihr nach den Sitten statt nach der Schönheit fragt. Heutzutage aber fragt man nach den Dingen, welche Reichtum und Gestalt empfehlen, nicht aber die Anständigkeit der Sitten.
So so, also die Weisheit als erstes Entscheidungskriterium; ob das jedes Mägdelein unserer Leserschaft so gehandhabt hätte ohne Isidors Rat? Und gute Sitten statt Schönheit gar? Oder Reichtum? Hmm ... Wenn dies so sein soll, dann wollen wir uns aber auch noch zu Gemüte führen, was denn nun aus seiner Sicht die Gründe sind, ob derer sich ein Junggeselle in immerwährende Bande begeben sollte:
'Aus drei Gründen aber nimmt man sich eine Ehefrau: Der erste Grund ist die Nachkommenschaft, wovon im Buch Genesis zu lesen ist (1,28): Und er segnete sie und sprach: Wachset und mehret euch. - Der zweite Grund ist der der Hilfe (adiutorium), von welcher dort im Buch Genesis gesagt wird (2,18): Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm ähnlich ist. - Der dritte Grund ist die mangelnde Enthaltsamkeit (incontinentiae), weshalb der Apostel sagt (1.Kor 7,9): Wer sich nicht enthalten kann, möge heiraten.'
Wer sich nicht enthalten kann, der möge heiraten ... welch weises Wort! Und es macht uns klar, was wir längst schon ahnten, dass nämlich ein Gutteil aller Ehemänner nur deshalb zu solchen geworden sind, weil sie im tiefsten Inneren eigentlich schamlose Lüstlinge sind. Ob ihre trauten Gemahlinnen das nun gutheißen oder nicht, wird wohl nicht zuletzt davon abhängen, wie es um die eheliche Treue bestellt ist ...
Weiter zum dritten Teil der Artikelserie.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Kunstgeschichte

Woher stammt er - der Begriff Gotik ...
Wann immer die Rede auf das Mittelalter kommt, und darauf, was denn nun das Charakteristische an dieser Epoche sei, dann kann man mit großer Sicherheit darauf vertrauen, dass bestimmte Begriffe stets wiederkehren. Da wird die Rede sein vom 'finsteren' Zeitalter, von den Kreuzzügen, von Kirche, Glaube und Hexenverbrennungen, von stinkenden Städten, von edlen Rittern oder auch von solchen, die sich als Strauchdiebe betätigten, vielleicht von den Minnesängern, und von mehr noch.
Ungeachtet dessen, dass manches davon sich bei genauerer Betrachtung als sorgsam gehegtes Klischee entpuppt, werden darunter aber stets auch solche Stichworte zu finden sein, die unser aller ungeteilte Zustimmung erheischen. Die Kathedrale gehört zweifelsohne zu diesen; wer würde bezweifeln, dass diese großartigen Kunstwerke mit ihren Spitzbögen und Kreuzrippengewölben, diese 'Architektur des Lichts', in der die Frömmigkeit des mittelalterlichen Menschen ihren sinnfälligsten Ausdruck gewonnen hat, mindestens so zum Mittelalter gehört wie der säulengesäumte Tempel zu den antiken Griechen.

Wo aber die Kathedrale erwähnt wird, kommt zwangsläufig die Sprache auf die Gotik; zumindest der Begriff wird fallen, von jenem Stil, in dem die großen Kirchenbauten seit dem Hochmittelalter errichtet wurden. Übrigens ist der Begriff nicht auf Architektur beschränkt, nein, er wird auch auf Malerei und Plastik angewandt.
Soso, Gotik heißt das also, ja klar, hab ich auch schon gehört ... ... aber halt, ehe wir fortsetzten; ist es nicht sonderbar?
Sonderbar? Was? ...
Nun, das ausgerechnet die Goten dafür herhalten durften, für die Bezeichnung eines hoch- und spätmittelalterlichen Kunststils ...
Hmm, jetzt wo du das sagst; genau dassselbe habe ich mir auch gerade gedacht.
Tatsächlich, wie kamen die mittelalterlichen Zeitgenossen dazu, ihren Kathedralenstil als gotischen zu bezeichnen? Vielleicht gar, weil die alten Goten, die übrigens ein ziemlich streitlustiges Völkchen gewesen sein sollen, wovon uns der Asterix-Band Nr.6 glaubhaft Auskunft gibt, weil diese Goten nun, die ja eine Zeitlang ziemlich Schlagzeilen schrieben in Europa, schon damals in dieser Form zu bauen begonnen hatten? Oder zumindest erste Aspekte dafür initiierten?

Weder noch! Doppelter Irrtum. Erstens war der Begriff Gotik, zum Zeitpunkt als die Kathedralen errichtet wurden, noch gar nicht bekannt. Wie bei vielen Bezeichnungen, kam auch diese erst im Nachhinein, in späterer Zeit, in Gebrauch (vergleichbar mit dem 'Kreuzzug', der als Bezeichnung ebenfalls eine spätere, moderne Erfindung darstellt - im Mittelalter pflegte man nämlich auf Wallfahrt zu gehen, im angesprochenen Fall auf eine 'bewaffnete'. Klingt doch gleich viel besser!). Zurück zur Gotik: Damals wurde der neue Stil einfach der'französische' ( 'opus francigenum' ) oder auch 'Spitzbogenstil' genannt.
Beides nachvollziehbar - beim Spitzbogen ganz offensichtlich, beim französischen Stil auch, wenn man bedenkt, dass die ersten derartigen Bauwerke in Frankreich, und dort in der näheren Umgebung von Paris, entstanden. Als auslösender Impuls gilt der Neubau der Abteikirche um 1140 von St. Denis unter dem Abt Suger; von dort aus setzte dann die Gotik zu ihrem gut dreienhalb Jahrhundert dauernden Siegeszug zuerst in der Île-de-France, dann durch ganz Europa an.
Und die Goten? Was haben nun die damit zu tun? Nichts. Zumindest lieferten sie keinen baugeschichtlichen Beitrag. Allenfalls könnte man den Standpunkt vertreten, ihre westlichen Vertreter hätten 410, als sie unter ihrem König Alarich Rom plünderten und brandschatzten, Raum für Neues geschaffen indem sie antike Bauwerke auf diese Art 'entsorgten'. Nicht wirklich überzeugend für die Namensgebung, dieses Argument. Und doch, im gewissen Sinne, ursächlich dafür.
Es war nämlich der (mittelitalienische) Architekt und Maler Giorgio Vasari der den Begriff 'Gotik' einführte. Er war im 16. Jahrhundert unter anderem für die Medici tätig und machte sich auch einen Namen als Biograph berühmter italienischer Künstler. Wie es sich für einen gestandenen Renaissancekünstler gehörte, der seine Vorbilder in der antiken Klassik hat und dem das Mittelalter als Zeit des Verfalls galt, blickte er geringschätzig auf den Kunststil der unmittelbaren Vergangenheit herab; primitiv, altertümlich, deutsch - so galt ihm die Kunst der Kathedralen. Dafür musste schon ein deftiges Schimpfwort herhalten - und was Besseres könnte einem Italiener dafür einfallen als der Name dieser Schurken, die einst das heilige Rom brandschatzten?
Gotik! Eigentlich als Schimpfwort gedacht! Als abwertende Bezeichnung. Und tatsächlich setzte sich der Begriff für die Epoche der Kathedralen durch - allerdings nicht in seiner negativen Bedeutung. Ganz im Gegenteil, die Gotik hatte nördlich der Alpen ein langes Nachleben, das bis ins Barock hineinreichte, ja, erstand in der Neugotik im 19. Jahrhundert sogar wieder. Und noch heute erregen die Bauten unsere Bewunderung; kaum weniger als die Tempel der Antike und die Kunstwerke der Renaissance ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Redensarten
und Handwerk

Alte Redensarten - Wenn es wieder einmal darum geht, rechtzeitig zu türmen ...
dann handelt es sich nach unserer modernen Auffassung um einen Vorgang oder eine Tätigkeit, die in der um- kämpften Zeit des Mittelalters, in der die Fehde lange Zeit allseits akkzeptiertes Mittel war um das eigene Recht zu erzwingen und das Verwalten von Gefangenen zum einträglichen Geschäft gehörte, von nicht unerheblicher Bedeutung war. Und zwar für viele der damaligen Zeitgenossen zumindest zeitweilig!
Interessanterweise können wir die Redeweise auf eine von zwei grundsätzlich unterschiedliche Bestrebungen zurückzuführen, die allerdings beide in nicht unerheblicher Weise mit dem Turm zu tun haben. Welche denn nun tatsächlich sprichwortbegründend war? Wer weiß ...

Entsetzt mussten wir erst kürzlich feststellen, dass der Begriff des Türmens der ganz jungen Generation kaum noch geläufig ist - wiewohl der Vorgang selbst, etwa nach der kunstvollen und farbprächtigen nächtlichen Gestaltung öffentlicher Gebäude, durchaus noch gebräuchlich ist.
Im Sinne unserer durch und durch puritanischen Bestrebungen altehrwürdige Begriffe der heutigen Sprache zu bewahren und dafür zu sorgen, dass der aktiv gebräuchliche Wortschatz unserer jungen Leser nicht unter die von Entwicklungspsychologen genannte kritische Grenze von durchschnittlich 288,4 Wörter fällt, sehen wir es als unsere Pflicht an, Folgendes zu erklären: Liebe Jugendliche, Türmen, das bedeutet (besser, das bedeutete bis vor ein paar Jahren noch dasselbe wie) 'sich aus dem Staub zu machen' beziehungsweise 'sich über die Häuser zu hauen' oder 'einen Abflug machen' - und war bedeutend kürzer und - wie wir meinen, dementsprechend ele- ganter. Allenfalls 'fliehen' kann da noch mithalten, klingt aber um einiges weniger aufregend.
Wir Alten, deren Geburtsdaten ja fast schon ins Mittelalter zurückreichen, zumindest für jene Generation, die mit Geschichte nicht mehr allzuviel am Hut hat(hmm 'am Hut haben' - wieder so ein geflügeltes Wort), wir Alten kennen solche antiqierte Begriffe natürlich noch. Schließlich unterhalten wir uns ja täglich in diesen längst überkommenen alten Sprachstufen ...
Türmen meint(e) in unserer modernen Zeit also 'sich verdrücken'. Woher stammt aber der Ausdruck ursprünglich? Die Hobbysprachforscher unter uns erkennen natürlich sofort, dass wir es hier irgendwie mit dem Turm zu tun haben. Tatsächlich können fallen uns dazu zwei Erklärungsmodelle ein. Erstens, da gab es in der Burg einstmals den Bergfried, der einst etwa das war, was heutzutage Papa's Arbeitszimmer ist - also das letzte verbleibende Refugium des Hausherrn zum Rückzug. Das rechtzeitige Betreten dieses Plätzchens, also das Türmen war speziell dann eine interessante Option, wenn wieder einmal der missgünstige Nachbar mit seinen missratenen Söhnen, plündernde Bauernhorden oder ein Häuflein Hussiten die Burg mit ihrer Anwesenheit beehrten.
'Rein in den Turm', so könnte man also als möglichen Bedeutungsursprung annehmen. Andererseits: Viele 'Time-Out Zonen' dieser vergangenen Zeitepochen (damals sprach man noch von Verliesen) waren in oder unter Türmen angelegt, auch deshalb, weil die Türme meist mit der dicksten Wandstärke aufwarten konnten, die weit und breit zu finden war. Somit stellten sie einen relativ sicheren Verwahrungsort für eine der einträglichsten zeitgenöss- ischen Kapitalanlageform dar. Wir sprechen vom Pfeffersack oder anderen begüterten Gefangenen, die sich dann häufig nur gegen Bares auslösen lassen konnten.
Dass der schändlich Eingekerkerte bestrebt war, diesen Ort, der meist nur eine Qualitätsminimalausstattung vor- weisen konnte (von wegen Badezuber und drei hübsche Bademädchen), relativ rasch wieder zu verlassen - auch in einer, vom Gastgeber so nicht vorgesehenen Form - ist nur allzu verständlich. Türmen käme also in dieser Form von 'raus aus dem Turm' und entspräche sehr genau unserer heutigen Bedeutung 'fliehen' oder 'sich aus dem Staub machen.'
Dass man früher den Turm häufiger im Sprichwort fand als heutzutage, (etwa 'Große Türme mißt man nach ihrem Schatten, große Menschen nach ihren Neidern' oder 'Je höher ein Turm, desto näher beim Wetter' ), hat wohl auch mit dem Bedeutungswandel des Turms für das Selbstverständnis zu tun. Der Turm als Machtsymbol für Einzelne hat ausgedient, allenfalls Versicherungen und Banken und dergleichen moderne Raubri .. ähh, wollte sagen dergleichen moderne Institutionen residieren heutzutage wieder in Türmen.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Gesellschaft im Mittelalter

Was die mittelalterlichen Vorfahren über die Ehe dachten - Teil 1
Die Ehe! Welcher Teufel, mag an dieser Stelle eure Frage lauten, hat euch denn da geritten, dass ihr uns zu- mutet, über die Ehe zu lesen, über diese Institution, die dem Mittelalter doch nur als Gütergemeinschaft galt, als Geschäft zwischen Partnern, Partnern zudem, die darin beileibe nicht die gleichen Rechte fanden. Die Lie- be, die fand sich allenfalls dann, werdet ihr sagen, wenn der Recke Urlaub von seiner Gattin nahm und im Wald der zauberischen Fee begegnete, die ihn - heimtückisch, wie es nun einemal Art der Feenweiber ist - mit vielen Reizen und wenig an Gewand betörte. Und, so lasst euch sagen, diese Reize waren von solcher Art, dass der gute Ritter wohl gar nicht anders konnte, als der weißhäutigen Schönen willig zu sein. Nebstbei, wenn gar ein so tugendsamer Recke ihre Fluren streifte, dass er nicht sogleich ebtbrannte, dann stand dem Alten Volk allerley Zauberwerk zur Verfügung um ihn zum Dienst zu zwingen. Also ließ er besser den Wider- stand gleich bleiben - was soll's, schließlich wär's ohnehin zwecklos gewesen ...
Oder aber es ist das bedrängte Vrouwelin, vielleicht die junge, hübsche Witwe auch, die alleingelassen vom Vater, der von Minne- und Aventiurenfahrt nicht widerkehrt, nun vom bösen Vormund oder irgend einem an- deren Schurken in ihrer Burg heimtückische Bedrängung erleben. Die Schufte wollen dabei stets zweierley - die weltlichen Besitztümer der guten Frouwen und nebstbei auch ihre - manchmal gänzlich, manchmal nicht so gänzlich - unschuldigen Leiber in verabscheuungswürdiger Wolllust genießen. Wie gut, dass da der Held ge- rade zur rechten Zeit sich nähert. Sind dann mit den Schurken die lästigen Formalitäten erldigt, dann gebühr- en dem edlen Retter, sofern er noch eines Eheweibs entbehrt, die weißen Glieder der befreiten Dame, ihre freudige Wolllust und nebstan, um den Preis des Ehesakraments, auch ihre Besitztümer. Der verheiratete Aventiurenritter nimmt nur die ersten beiden Geschenke zum Danke dar, muss aber auf Letzteres verzichten. Manchmal tut es ihm der ledige Recke gleich und verbschiedet sich gleichfalls nach einer klug gewählten Spanne Zeit.

Warum das so ist? Leichte Antwort, meinen jetzt die verschworene Junggesellen unter euch, jene nämlich, die bar jeglicher Romantik sind, denn die Ehe ist - so wie oben gesagt - bloß ein Geschäft zwischen Partnern, die sich beleibe nicht auf gleiches Recht berufen können. Oder wagt jemand zu bestreiten, dass der wackere Mann mit dem Übertritt in den Heiligen Stand der Ehe zuhause jeglicher Rechte verlustig geht? Vorbei sind dann die Zeiten, wo man gemütlich Füße und Straßenschuhe auf dem Wohnzimmertisch plazieren durfte, wo es egal war, ob die Heimkehr zur mitternächtlichen Stunde unter dem Schrei des Käuzchens geschah, oder erst beim morgendlichen Grauen. Wo sind dann die Tage, in denen leere Flaschen Bier und gefüllte Aschen- becher ein unnachamliches Ambiente bildeten? Von der Brille am Abtritt und gebrauchter Unterwäsche ganz zu schweigen. Ja ja, die guten alten Zeiten ...
Natürlich habt ihr Unrecht, ihr Zyniker, schmettert euch der Autor dieser Zeilen hiermit entgegen, der selbst im seeligen Zustand der Ehe befangen ist - von wegen alte Zeiten. Gibt's denn nicht den Spruch, der vom aller- schönsten Tag im Leben sagt? Schönster Tag im Leben - welch Unsinn! Die schönsten Tage, Monate, Jahre im Leben sind's ... für den Rest eures Lebens. Denn ihr seid nun auf ewig gebunden. Zumindest wart ihr es, ihr, die Helden des Mittelalters. Und mal ehrlich, das gilt auch heute noch. Denn wer will denn schon durch die Staßen streunern, wann immer es ihm beliebt, wer will sich schon des verführerischen Lächelns der vielen zauberischen Feen erwehren, die da in den Tavernen und Schenken nur darauf warten dass unsereins den Raum mit seinem Erscheinen erhellt? Wer will erwachen und nicht wissen wo er ist und neben wem er liegt?
Gut, sagt ihr jetzt, ihr habt uns überzeugt, wenn es nur die neue Zeit betrifft. Auf eure guten Worte hin, su- chen wir uns, sobald dies möglich, ein gutes Eheweib oder einen braven Mann. Aber! Aber im Mittelalter, da war zwar die Ehe, nicht aber das Weib hochgeachtet. Die Frau, war sie erst einmal im Schacher unter die Haube gebracht, war nun behütet, war im Eigentum des Gatten, der Behüter und Vormund zugleich wurde, der mit ihr auch ihre Besitztümer und manchmal auch Herrschaftsrechte miterwarb. Oder eine billige Arbeits- kraft. Und mehr gibt's schon nicht mehr zu sagen über dieses Thema!
Da aber widersprechen wir. Denn über die Ehe, was sie ist und was sie zu sein hat, darüber gibt es eine Viel- zahl von Stellungnahmen und Meinungen die uns mittelalterlicher Autoren, Kleriker und Philosophen hinter- lassen haben. Und nicht alle entsprechen dem Bild, das wir oben gezeichnet haben, dem Bild, das wir uns landläufig über jene Zeit machen. Schließlich, wir sagten es bereits, reicht die Spannweite der Betrachtungs- weisen der Ehe von der angegebenen Gütergemeinschaft, vom Geschäft und dem Geschäftsobjekt Frau bis zu jenen Ansichten, die das Ehesakrament zum nobelsten von allen Sakramenten erklären; schließlich ist es das einzige, das von Gott höchstpersönlich im Paradies gestiftet wurde. Und darum wollen wir euch in näch- ster Zeit einiges über diese unterschiedlichen Meinungen erzählen, sofern euch eure Ehegatten die Zeit dazu zugestehen mögen und nicht stattdessen eure Hilfe im Haushalt einfordern ...
Weiter zum zweiten Teil der Artikelserie.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Redensarten
und Handwerk

Alte Redensarten - Freut euch, heute lassen wir etwas springen ...
Horcht auf und lasst uns heute von des Weibes und des Mannes Liebstem sprechen, von des Edlen und des Armen, von des Krämers und des frommen Ordensmannes. Nein, nicht davon, lautet unsere Antwort, wenn ihr denn die Liebe meint und das leibliche Vergnügen; Liebe, ein schönes Thema, fürwahr - aber was die Welten- scheibe wirklich am Rotieren hält, ist nicht sie. Wie denn auch; schaut in des Volkes Augen, dann werdet ihr ein Leuchten ohnegleichen sehen, wenn ihr ihm vom schweren Taler und vom Pfennig, vom Schilling und vom Heller sprecht.
Also wollen wir uns heute dem lieben Gelde widmen, unserem Kalb, das uns golden, vom Podest herab, sein verführerisches Lächeln schenkt. Nein, werdet ihr euch entrüsten, ihr paar wenigen Romantiker, die ihr die rote Rose und ein Lächeln höher schätzt, die zarte Hand in der euren, den ersten Kuss - nein, der schnöde Mammon ist's nicht wert, an erster Stelle genannt zu sein. Doch, doch - zumindest wenn man dem Mund des Volkes lauscht, und die Anzahl der vielen Redensarten, die um den Gebrauch der begehrten Münzen sich ranken, als Beleg dafür heranziehen mag.

Einigen von diesen Redensarten wollen wir uns heute widmen, ihren Sinn begreifen, um dann unser - oder lieber noch fremdes - Geld frohen und leichten Herzens auf den Kopf zu stellen. Die Träumer, die sollen derweil ins Rosengärtlein gehen, mit ihrer Liebsten und sich darein vergnügen wie es ihnen gefällt. Denn für sie ist heute kein Platz bei uns, da wir uns dem kühlen Glanz der edlen Metalle widmen. Die Liebespaare mögen ein andermal hierher wiederkehren ...
Welch schlimme Zeiten haben wir - Finanzenkrise, Inflation, die dem gierigen Fafnir gleich an unserem so schwer Ersparten und Erpressten frisst, mehr aber noch die Schuldeneintreiber des Königs, wollte sagen die Beamten des Finanzamtes, die darüber nachsinnen, wie sie uns armen Reichen, noch das letzte Hemd vom Leibe fressen können. Ja, ja, wer ein reicher Pfeffersack ist, der hat's nicht leicht. Manchmal möchte man mei- nen, in Tagen wie diesen, 's wär besser ein armer Schlucker zu sein um ohne Sorgen zu leben, wie die Vög- lein am Felde, die da nicht säen. Und schließlich, welch Gipfel der Ungerechtigkeit, geht der, der schön schlank geblieben, weil er sein Lebtag lang nichts zu beißen hatte, noch leichter durch das Nadelöhr ins Himmelreich als der, der sich mit ungesundem Cholesterin herumschlagen musste ...
Wir können euch helfen, das ist die gute Nachricht, ihr lieben Reichen, diesen gesegneten Zustand himmli- scher Armut zu erreichen. Sucht uns auf, dann wollen wir mit euch in die Schenke gehen, wo ihr ordentlich etwas springen lasst, für uns, für den Wirten und all die anderen Gäste. Wenn ihr denn all euer Geld in dieser Weise auf den Kopf stellt , dann wird euch hernach die Seele leicht sein, ebenso der Beutel, und allenfalls der Schädel etwas brummen.
Und schon haben sie sich eingeschlichen, die ersten Redensarten. Etwas springen lassen meint, anderen einen - oder mehrere - auszugeben. Früher nun, als man nur mit Münzen zahlte und nicht mit seelenlosen Scheinen, kam's auf den Gehalt an Gold oder Silber in der Münze an. Und da auch damals manch Schurke die Tavernen durchstreifte, der seine Fälschungen etwa mit Blei versetzte statt mit dem rechten Gehalt an Silber, warf man die Münzen auf, um am charakteristischen Klang ihre Echtheit zu überprüfen.
Sein ganzes Geld auf den Kopf stellen , da wissen wir, was damit gemeint ist - kein schlechter Rat in Zeiten rasender Geldentwertung. Aber was stellte man auf den Kopf, damit diese Wendung entstehen konnte? Richtig! Mittelalterliche Münzen waren vielfältig; doch zeigten sie zumeist auf einer Seite den Wert an, auf der anderen das mehr oder weniger ansehnliche Konterfei des mehr oder weniger geliebten Landesfürsten. Und beim Bezahlen legte man die Münzen so, dass ihr Wert ersichtlich war - man legte oder stellte sie auf den Kopf und des Fürsten Lächeln verschwand.
Solltet ihr die Absicht haben, nach dem Lesen dieses Artikels, etwas Schlechtes darüber zu verlautbaren, dann werden wir es euch mit gleicher Münze heimzahlen , das heißt, wir werden uns nach Kräften bemühen, Schlechtes mit Schlechtem zu vergelten. Früher meinte das übrigens in gleicher Währung herauszugeben; nicht selbstverständlich in Zeiten, in denen viele unterschiedliche Münzen kursierten.
Und wenn ihr eure Schulden bei uns mit Heller und Pfennig begleichen wollt, sind wir euch darob nicht gram; schließlich heißt das,wirklich nichts schuldig zu bleiben. Der Heller war eine relativ wertlose Kupfermünze und der Pfennig geht auf Karl den Großen zurück, der ihn als kleinste Münze einführte. Gut, wenn man seine Verbindlichkeiten sogar bis auf den letzten Cent begleicht. Weniger gut, wenn man zu hören bekommt keinen Heller wert zu sein.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Redensarten
und Handwerk

Alte Redensarten - Wenn der Sündenbock zum Prügelknaben wird
Wer kennt sie nicht - die Schießfiguren, die über 36 Runden hinweg Niederlage um Niederlage einstecken müssen und die sich schlussendlich bei insgesamt 4 erkämpften Punkten ein Torverhältnis von 13 : 159 erkämpfen? Sie, die Schlag um Schlag einstecken müssen, sind gern gesehene Gäste. Punktelieferanten! Die Prügelknaben der Liga!
Und die leidgeprüften Anhänger dieser Ansammlung von Versagern - soferne es solche überhaupt nach einem derartigen Seuchenjahr noch gibt? Die haben natürlich längst einen Sündenbock für das beschämende Abschnei- den gefunden. Klar doch, dass der Trainer der Schuldige war. Sagen die einen. Nein, meinen die anderen, der Vorstand ist schuld, schließlich hätte man nur etwas mehr Moos in die Hände nehmen müssen (- aber woher das mit dem Moos kommt, damit beschäftigen wir uns ein andermal) und viel früher den Übungsleiter austauschen müssen. Und mit einer solchen Flasche im Tor und den Versagern im Sturm ...

Ja, wenn dann solche Schmeicheleien laut werden im heimischen Stadion, dann merken wir von Sælde und êre natürlich auf, denn wenn's auch manchmal schlimm ist, was da abläuft, geprügelt wird dann doch niemand dafür. Woher kommt also die Redensart, dass man für etwas oder jemanden zum Prügelknaben herhalten muss?
Nun, ganz einfach von dem Umstand, dass es in früheren Zeiten - hört gut auf liebe Kindlein und Scholaren - tat- sächlich noch den nachgerade paradiesischen Zustande gab, dass man selbst einiges ausfressen durfte, andere aber dafür die Konsequenzen in Form der (schmerzhaften) Pädagokik ertragen mussten. Oder durften? Schließlich soll es Personen mit gar seltsamen Neigungen und Vorlieben geben ...
Schön - nicht wahr? Aber, nicht zu früh gefreut und nach der Wiederkehr der guten alten Zeiten gerufen, ihr Schurken, die ihr andere leiden lassen wollt, für eure Missetaten. Denn selbstverständlich wurde dieses Privileg nur wenigen Auserwählten zuteil, den Sprösslingen hoher Adeliger nämlich oder gar nur Königssöhnen. Schließlich durfte der hochwohlgeborene Prinz, wenn er denn eine Missetat begangen, nicht von einer Person gezüchtigt werden, die unter seinem Stande war. Schließlich galt das Amt des Königs als von Gott gestiftet; wer hätte sich da schon anmaßen dürfen Hand anzulegen?
Aber - das wird wohl jeder Verfechter mittelalterlicher Bildungsmethoden eifrigst nickend bejahen - da Strafe nun einmal sein muss, gilt es einen Ersatzempfänger zu suchen. Und das war - genau, der Prügelknabe. Vom Hofe der Tudors und der Stuarts weiß man solches zu berichten.
Aber - das wird wohl jeder Verfechter mittelalterlicher Bildungsmethoden eifrigst nickend bejahen - da Strafe nun einmal sein muss, gilt es einen Ersatzempfänger zu suchen. Und das war - genau, der Prügelknabe. Vom Hofe der Tudors und der Stuarts weiß man solches zu berichten.
Aber nun war es keinesfalls so, dass der königliche Taugenichts ganz von der Buße für seine Tat entlastet werden sollte. Er musste der Vollziehung der (Prügel-)Strafe beiwohnen und da man als Prügelknaben meist Abkömmlinge aus gutem Hause wählte, die mit vielen Privilegien am königlichen Hof aufwuchsen und mit dem Prinzen gemein- sam erzogen wurden, gab es dann - wenn schon keine körperliche - so zumindest eine gewisse psychologische Wirkung. Schließlich war der Prügelknabe unter solchen Umständen nicht selten ein enger Freund - und einen solchen sieht man nur ungerne leiden.
Beispielweise war William Murray nicht nur Freund sondern auch der 'whipping boy' von Charles I. Später wurde er von diesem dann zum Earl of Dysart gemacht. Ob da schlechtes Gewissen mit im Spiel war? Und von Konrad von Hohenstaufen wurde berichtet, dass er sich nach einer solchen 'Bestrafung' in weiterer Folge große Mühe gab, nicht rückfällig zu werden. Es wäre unerträglich für ihn gewesen, einen Unschuldigen für ihn leiden zu sehen, hieß es.
Der Prügelknabe als Sündenbock, der für etwas herhalten muss, das er gar nicht begangen hat ... und woher kommt der Sündenbock? Aus der Bibel (Leviticus XVI). Denn wenn das Volk Israel gesündigt hatte, dann wurden zwei Böcke ausgesucht und einem davon, - immerhin gab's per Losentscheid eine 50:50 Chance für jeden der beiden - per Handauflegung alle Sünden aufgeladen. Dem Sündenbock blieb dann nur noch der weite Weg in die Wüste und das Exil ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Künste und Wissen im Mittelalter

Septem artes liberales - die Schulwissenschften des Mittelalters
Unter den sogenannten Artes , den 'Künsten' verstand man im Mittelalter jenes Wissen, das wir einerseits den klassischen Schulfächern zuordnen würden (und das in den Septem artes liberales zusammengefasst wurde). Andererseits wurden aber auch handwerkliche Fertigkeiten (die Artes mechanicae ) als Künste be- zeichnet, wenn auch insgesamt etwas weniger hoch geachtet.
Scheint uns modernen Menschen diese Unterteilung von grundlegenden Kenntnissen noch plausibel, über- rascht uns vielleicht der dritte Teilbereich, den das Mittelalter kannte: Die Artes magicae beschäftigten sich mit Magie und Mantik, also der Zukunftsdeutung, - Themengebiete, die allerdings bei klugem Einsatz für viele An- wendungsfälle (Stichwort Aktienkurse, Sportwetten, etc. - und der Liebeszauber hat ja sowieso immer Sai- son) interessant sein könnte - aber das müssen wir dem getreuen Leser unserer Seite ja nicht extra mitteilen ...
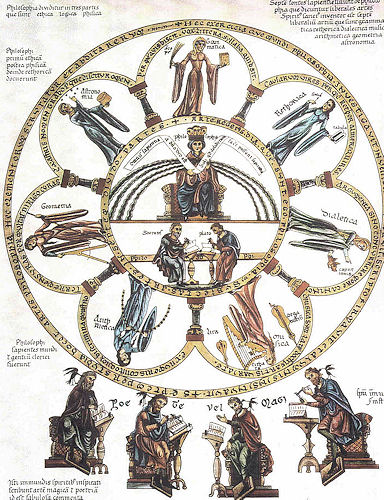
Doch zurück zu den Septem artes liberales . Die sieben freien Künste, ursprünglich 'die eines freien Mannes würdigen Künste', wie sie von (spät-)antikem Vorbild übernommen wurden, waren die Schulwissenschaften des Mittelalters und galten in jener Epoche als Vorbereitung auf die klassischen Studienfächer Theologie, Jurisprudenz und Medizin. Ausgangspunkt war die enkyklios paideia der griechischen Sophisten, jener Bildung, die sich ein frei geborener Jüngling anzueignen hatte. Der Begriff führt etwa auf die Zeit um 400 v.Chr. zurück und meint die Bereiche Grammatik, Musik, Geometrie und Astronomie.
Dieser Bildungskanon, von den Römern als orbis doctrinae bezeichnet, erfuhr in der Disciplinae (etwa 30 v.Chr) eine Erweiterung um die Fächer Medizin und Architektur. Dem Mittelalter wurden sie durch die Enzyklopädie De nuptiis Philologiae et Mercurii ('Von der Hochzeit der Philologie und des Merkurs') des Heiden Martianus Capella aus dem 5. nachchristlichen Jahrhundert ein Begriff. Neben Cassiodorus, Boethius und Alkuin trug vor allem auch Isidor von Sevilla durch die Aufnahme in seine Etymologien dazu bei, das die Septem artes liberales als unabdingbares Bildungsgut für eine wissenschftliche Ausbildung betrachtet wurden.
Im Laufe der Zeiten gewissen Änderungen unterworfen, umfassten sie einerseits die drei Künste der Rede ( Dreiweg oder Trivium ), nämlich Grammatik, Rhetorik und Dialektik. Daneben gab es die rechnenden Künste ( Vierweg oder Quadrivium ) Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie.
Eine wissenschaftliche Ausbildung im Mittelalter kann man sich somit so vorstellen, dass die Septem artes liberales (an den Elementarunterricht anschließend, der so grundlegende Kenntnisse wie Lesen, Schreiben, Rechnen und - in der damaligen Zeit unabsingbar - zumindest rudimentäres Lateinverständnis vermitteln sollte, aber auch Singen beinhaltete) der Vorbereitung für die eigentlichen wissenschaftlichen Studien dienten.
Unterrichtet wurden sie vorerst in kirchlichen Institutionen (Dom-, Kathedral, Klosterschulen), später auch auch durch Bildungseinrichtungen der Städte oder durch freie Magister. In den Universitäten formierten sie sich schließlich nach dem Pariser Vorbild zur Artistenfakultät, die in der Regel durchlaufen werden musste, bevor man mit dem Studium einer der weiterführende Fakultäten beginnen konnte.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Redensarten
und Handwerk

Alte Redensarten? Nicht um die Bohne ...
Vermutlich kennt der geneigte Leser dieses Problem: Da sitzt man nun, geschruppt und gebürstet, hat vor sich das leere Blatt Papier und der gespitzten Bleistifte zwei oder drei. Das jungfräuliche Blatt, es scheint zu locken und zu rufen - 'Komm und raub mir mein unschuldiges Weiß!' -, die Stifte sind stramm bis zur Mine, zur Schandtat bereit. Und dann will einem um die Bohne nicht einfallen, worüber man schreiben könnte. Schreiben nämlich, um den wöchentlichen Artikel für unsere Sælde und êre-Seite fertigzustellen, auf den stets die vielen Hunderttausende in aller Herren Länder schon harren, und ohne den der Sonntag wäre, wie ... wie, - ja genau! - wie das Spiegelei ohne die Schale oder die Milch ohne ihre Haut.
Nun, zweifellos wird der erfahrene Leser bei der Lektüre der obenstehenden Zeilen zumindest zweierlei be- merkt haben:
Erstens nämlich, dass wir uns darin einiger literatischer Freiheiten befleissigen. Denn selbstverständlich sitzen wir nicht mehr vor dem jungfräulichen Papier (wiewohl wir Jungfräuliches - einige Zeit zumindest - durchaus zu schätzen wissen). Nein, selbst wir, die wir so altertümlich anmuten (manche beschimpften uns dessenthal- ben sogar schon als 'mittelalterlich'), nennen ein tragbares Rechengerät unser Eigen. Und auf dem schaffen wir diese unverzichtbaren Werke deutschsprachiger Poetik, die ihr hier zuhauf bestaunen dürft. Und dies bar aller Abgaben und Steuern. Aber nehmt darum bloß nicht an, die Arikel seien keine kalte Bohne wert .
Zweitens dieses, dass wir verzweifelt versuchen die Zeilen anzufüllen mit allerley Geschwafel und sinnlosem Geschwätz, die mehr dem Hofnarren des Königs frommen würden, denn unseren Meistern der Feder.
Also Schluss mit dem Geschwafel und nachgedacht. Was gibt's, das so weltbewegend wäre, von so uner- messlicher Bedeutung für unser ehrenwertes Publikum, dass es einen Artikel nicht nur rechtfertigen, sondern geradezu danach schreien würde? Also gesagt und nachgedacht - und siehe da, bald war es uns sonnenklar. Die Bohne ist's! Wem oder was sonst würde diese Ehre gebühren? Kein Denkmal von Goethe, keins von Schiller und - unseres Wissens nach - auch keines von Alois Hinteramskogler. Unvorstellbar! Also auf, lasst uns junfräuliches Papier schänden, damit endlich Schluss werde mit dieser Schande ...
Die Bohne. Von altersher war die Meinung über sie eine geringe; keine Speise für Götter, keine für Könige - und für den Feinschmecker schon gar nicht. Was sollte da eine einzelne Bohne wert sein, wenn schon das gesamte Geschlecht derart gering geachtet wird? Öfters als Ersatz für Spielgeld verwendet, bezeichnen sie somit schon im 13. Jahrhundert das Unbedeutende und Nichtige, etwa wenn Walther von der Vogelweide im Hinblick auf die Freizügigkeit von Kaiser Friedrich II sagt:
'...
mîn vorderunge ist ûf in
kleiner danne ein bône
...'
Oder wenn Gottfried von Straßburg seinem Tristan, der vom Riesen Urgan bedroht wird, die folgenden geringschätzigen Worte in den Mund legt:
'...
weistuz nu wol, nu vürhte ich
dine stange unde dich
niht eine halbe bone.
...'
Starker Tobak, zumal für einen Riesen, dessen Profession es nun einmal ist Leute zu erschrecken, wenn der Horror, den er erregen kann, auf einmal nicht eine halbe Bohne mehr wert soll. Diese Helden ... Ja, so haben schon manche um eine Sache gekämpft, die keine Bohne wert war. Nicht einmal eine hohle oder wurmige Bohne. Umgekehrt meint dann die Redensart aus einer Bohne einen Berg machen , eine unbedeutende Sache aufzubauschen.
Noch nie gehört? Dann mein Guter hast du wohl Bohnen in den Ohren , was meint, dass deine Gehörfähigkeit beeinträchtigt ist; schließlich meint der Volksmund körperliche Gebrechen und Unpässlichleiten ( 'jedes Böhnchen ein Tönchen' ) auf allzu häufigen Bohnenverzehrs zurückführen zu können. Vorsicht rufen wir also dem Bohnenfreund zu, damit er nicht als tumber Bohnensimbel ende.
Arme Bohne. Da tut es der geschmähten Hülsenfrucht gar wohl, wenn sie merkt dass sich das manch einer freut die Bohne (im Kuchen) gefunden zu haben . Dass nämlich meint, man habe es gut getroffen oder einen guten Fund gemacht. Der Ausspruch geht auf einen alten Scherz zurück, der ursprünglich am Vorabend des Dreikönigstages gepflegt wurde, als man nämlich eine Bohne in den Kuchen buk. Wer die fand, der wurde zum Bohnenkönig, dem man einen Tag lang fiktive Ehren erwies. Hört sich schön an, allerdings hatte dieser Bohnenkönig auch für die Kosten von Schmaus und Trank aufzukommen. Und danach konnte es passieren, dass er weniger als eine Bohne noch im Hosensack vorfand und darum fürderhin nichts mehr von Bohnen wissen mochte ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Wirtschaftsorganisation im Mittelalter
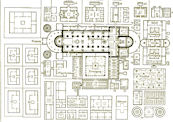
Aufbau und Organisation eines Idealklosters - Teil 2
Zum ersten Teil der Artikelserie.
Der St. Galler Klosterplan gibt uns Auskunft darüber, wie das ideale Kloster in karolingischer Zeit - und da- rüber hinaus - auszusehen hatte. Bezeichnend in diesem wohldurchdachten Konzept sind das Nebeneinander von spirituellen und sehr weltlichen Belangen; Letzteres ist verständlich, wenn wir uns die Gegebenheiten der damaligen Zeit vor Augen führen, die Selbstversorgung und wirtschaftliche Unabhängigkeit bedingten. Zumindest war dies in den Gründerjahren vieler Klöster der Fall, später mögen diese Gemeinschaften durch Zuwendungen und Landschenkugen vermögender Gönner einen Grad von Reichtum erlangt haben, der nicht umsonst immer wieder Kritiker auf den Plan gerufen hat und zu Reformbestrebungen Anlass gab.
Wenn wir nun vom Zusammenspiel geistlicher und weltlicher Belange sprechen, dann belehrt uns ein Blick auf den besagten Klosterplan, welchem dieser beiden Bereiche der Vorzug eingeräumt wurde. Wie nicht anders zu erwarten stellt die Kirche - sie ist auf dem Plan doppelchörig ausgeführt - das Herzstück der gesamten An- lage dar. Um sie, die im Zentrum aufragt, herum gruppieren sich die anderen Einheiten, wobei jene Bereiche, die den weltlichen Belangen, wie der Versorgung mit Nahrungsmitteln und Gerätschäften dienen, außen an- gesiedelt sind.
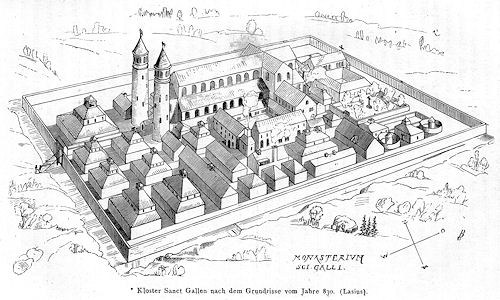
Doch beginnen wir unseren Rundgang im Zentrum; südlich der Kirche, in unmittelbarer Nachbarschaft, befin- det sich der Wohnbereich der Mönche. Er ist um einen quadratischen Hof herum organisiert, dessen vier Sei- ten von Arkaden gesäumt sind. Dieser Kreuzgang , der später so selbstverständlich werden wird, begegnet uns hier, auf dem St. Galler Klosterplan, erstmalig in seiner 'klassischen' Form. Über ihn konnten die umge- benden Konventsgebäude erreicht werden; Hof und Gang stellten - speziell in der wärmeren Jahreszeit - einen wichtigen Aufenthaltsbereich für die Mönche dar, der der Kontemplation ebenso dienen konnte wie dem Unterricht. War das Kloster in der Nachbarschaft einer Bischofskirche angesiedelt, fanden hier vielfach auch die Domkapitulare ihre Grablege.
An der Ostseite des Kreuzganges finden wir ein zweigeschossiges Gebäude. Das Erdgeschoss umfasst einen Raum, der über eine Fußbodenheizung beheizt werden konnte; dieser Wärmeraum, üblicherwese der einzige des gesamten Klosterbereichs, der im Winter beheizt wurde, dient den Mönchen als Arbeits- und Aufenthalts- raum. Hier können sie sich trocknen und aufwärmen, hier werden Haar und Bart geschnitten, hier werden häufig auch die Schreibarbeiten erledigt, Bücher und Handschriften kopiert - schließlich duldet die anspruchs- volle Arbeit der Skriptoren, Rubrikatoren und Illustratoren keine klammen Finger.
Im oberen Geschoss befindet sich das sogenannte Dormitorium , der Schlafraum der Mönche, der, wie die meisten anderen Räume und Gebäude des Klosters, im Winter ebenfalls nicht beheizt wird - keine schönen Aussichten also und so verwundert es auch nicht, dass die Wissenschaft die durchschnittliche Lebenserwart- ung eines Mönchs in jenen Zeiten auf unter dreißig Jahre ansetzt. Aus dem Aufenthaltsraum führen schließlich Gänge zu zwei kleineren Gebäuden, die das Bad und die Latrinen beherbergen.
Den Südflügel des Kreuzganges nimmt das Refektorium ein, der Speisesaal der Mönche, über dem die Kleider- kammer untergebracht ist. Dass die Klosterplaner über all den geistlichen Belangen durchaus die praktisch weltlichen nicht aus den Augen verloren, zeigt sich an der Anordnung der Klosterküche: Die entdecken wir nämlich gleich nebenan, in der südwestlichen Ecke des Kreuzganges. Und weil wir schon einmal von den praktischen Belangen sprechen, sei's hier auch gleich erwähnt: Neben der direkten Verbindung zum Refek- torium gibt's auch eine von der Küche zum Backhaus und zur Brauerei, die auf dem Plan die Anlage nach Süden fortsetzen.
Aber halt, bevor wir uns in die weitere Umgebung der Kirche begeben, wollen wir den Kreuzgang zuvor noch im Westen beschließen. Und zwar mit einem Vorratsgebäude, dessen Untergeschoss als Wein und Bierkeller dient. Der hat, um dem Grundgedanken der Planer, zu folgen, nämlich Wesentliches ins Zentrum zu stellen, offensichtlich einige Bedeutung im mönchischen Leben. Zischen diesem Vorratsgebäude und der Kirche finden wir uns schließlich im Parlatorium (auch Locutorium ) wieder. Wie der Name, der uns nicht von ungefähr ans Parlament erinnert, schon anklingen lässt, wird hier vor allem viel gesprochen, emfangen doch hier die Mönche ihre Besuche von außerhalb.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Gesellschaft im Mittelalter

Ständegesellschaft des Frühmittelalters - Teil 1
Die (früh-)mittelalterliche Gesellschaft Europas stellte im wesentlichen eine Ständegesellschaft dar, in der es große Unterschiede bezüglich Rechtsstand, Besitztum und persönlichen Freiheiten und Pflichten gab. Da nun diese mittelalterliche Gesellschaft eine christliche ist, stellen sich gleich mehrere Fragen. Einerseits natürlich die nach den Unterschieden zwischen den einzelnen Ständen. Woraus resultierten diese? Wie sahen sie aus? Was waren ihre Auswirkungen? War es möglich solche Standesgrenzen zu überwinden und wenn ja, wie konnte das geschehen? Welche Veränderungen brachten Hoch- und Spätmittelalter? Das Aufkommen der Städte?
Andererseits muss in diesem Zusammenhang natürlich auch der Standpunkt der Kirche interessieren. Wie arrangiert sich eine religiöse Institution, deren Lehre sagt, der Arme sei vor Gott keinesfalls schlechter als der Reiche, der Unterdrückte nicht geringer als der Mächtige (- im Gegenteil, eher wird ein Kamel durch ein Nadel- öhr gehen als der Reiche in den Himmel kommen! -) mit den realen und oftmals sehr brutalen Zuständen der Zeit? Wenn wir uns dabei zurückerinnern, an jene vergangenen Jahrhunderte, in denen das Christentum von der verfolgten und unterdrückten Sekte zur Staatsreligin des römischen Reichs wurde, dann erkennen wir schnell, wie sehr eine Anpassung an realpolitische Interessen vonnöten war. Denn plötzlich war der Kaiser der oberste Verteidiger der Christenheit - gegen die Barbaren aus dem Norden, gegen die zoroastrischen Sassaniden im Osten ... und gleichzeitig baute die Wirtschaft dieses mächtigen Reiches auf die Ausnutzung der Arbeitskraft unzähliger Sklaven und Rechtloser auf.

Wie also rechtfertigte man etwas, das sich in der gegebenen weltpolitischen Situation ohnehin nicht ändern ließ, das man aber vielleicht auch gar nicht ändern wollte. Was sagten die Kirchenväter zu den herrschenden Zuständen? Nun, vielleicht könnte man das am Besten mit einem Gleichnis (der werte Leser merkt, wie wir von theologischen Denkweisen beeinflusst werden ...) erläutern. Da steht der kleine Peter am Fussballplatz und möchte endlich selbst Tore schießen. Bejubelt werden! Gefeiert! Die Mädels aus der 2. Klasse sollen Augen machen. Und was ist? Sein Trainer stellt ihn einmal mehr auf den verhassten Platz des Außenverteidi- gers. Peter schnieft - und sein Trainer (soferne es ein einfühlsamer Trainer ist) erklärt ihm, dass es beim Spiel nicht darauf ankommt, dass der Einzelne glänzt und sein ronaldinisches Ego pflegt, sondern dass sich jeder Einzelne in den Dienst der Mannschaft stellt, an den Platz, den er am besten ausfüllen kann - dann wird die Mannschaft gewinnen und das ist gut so. Darum schießt Karli die Tore, wird von den Mädels gefeiert, und Peter verteidigt. Und punktum! ... Außerdem, wohin kämen wir, wenn die Spieler die Aufstellung des Trainer hinterfragen dürften?
So ähnlich die Erklärungsversuche der Kirchenväter. Auch bei ihnen spielt der Begriff der Ordnung ( ordo ) eine vorrangige Rolle. In der bestehenden Gesellschaftsordnung spiegelt sich die göttliche Ordnung wieder und bestehende Ungleichheiten entsprechen bewusst Gottes Plan. Gott als Trainer, der eine Aufstellung gemacht hat, in der ein jeder den Platz einnimmt, den er am besten ausfüllen kann, damit das Gesamtziel einer christ- lichen Gesellschft möglichst optimal verwirklicht werden kann.
Bonifatius drückt dies natürlich ungleich besser aus. Er meint mit der Kirche (die ecclesia ) - anders als heut- zutage - nicht die religiöse Institution oder das physische Gebäude der Zusammenkunft, sondern vielmehr die Gemeinschaft aller Gläubigen und somit zugleich die Gesamtheit der mittelalterlichen Gesellschaft. Diese Kirche nun vergleicht er mit einen Körper ( corpus ), der sich aus einer großen Anzahl unterschiedlicher Glieder zusammensetzt. Diese Ansicht, die auf antike gesellschaftstheorien zurückgeht, erklärt somit die bestehnden Unterschiede im Sinne eines funktionierenden, übergeordneten Ganzen, das die Funktionsaufteilung und somit die bestehende Ungleichheit erklärt.
Natürlich erlaubt diese Sichtweise auch eine Erklärung, warum ein Stand höher geachtet ist als der andere, gibt es doch auch bei den 'Organen' des Körpers solche, die sich einer höheren Wertschätzung erfreuen als andere (Das gibt's ja auch heute noch, wenn wir etwa mit dem Ausdruck vom 'hirnlosen Muskelprotz' das schlechte Gewissen über unser Wohlstandsbäuchlein zu besänftigen suchen). Dennoch benötigt der Körper alle Teile um 'richtig' zu funktionieren. Augustinus nennt die 'Ordnung', die einem jeden seinen Platz zuweisende Verteilung gleicher und ungleicher Dinge und ein Kapitular Ludwig des Frommen verfügte, jeder einzelne solle beim Königsdienst einen seinem Stand angemessenen Platz haben.
Zum Glück, rufen wir aus, sind diese Zeiten überwunden! Unsere Gesellschaft ist weiter, wir sind aufgeklärt. Ja! .... Aber trotzdem finden wir, denken wir nur angestrengt genug nach, genügend Beispiele, wo wir im Sinne übergeordneter (Staats-)Interessen funktionieren müssen. Dabei brauchen uns nicht einmal die Mobil- machungsaufrufe des letzten Jahrhunderts einfallen - viele kleine Entscheidungen sind es, die wir in Abwäg- ung von Gemeinschaftsinteressen zu berücksichtigen haben (und es im letzern Fällen zum Glück auch tun - grenzenloser Egoismus, ohne irgendwechle Rücksichtnahme ist vor allem dann lästig, wenn dies des lieben Nachbarn Lebensweise ist!). Aber das ist schon wieder ein ganz anderes Thema.
Ach ja, die Fortsetzung zu diesem hier, wird sich demnächst mit den Ständen und Unterscheidungen befas- sen, mit Rechten, aber auch Pflichten. Ihr möget euch also wieder rechtzeitig hier einfinden ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Wirtschaftsorganisation im Mittelalter
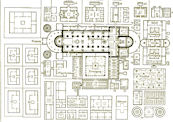
Aufbau und Organisation eines Idealklosters - Teil 1
Im (früh-)mittelalterlichen Denken ist die Gesellschaft im Wesentlichen in drei Stände unterteilt: Der Bauer (und Handwerker) hat mit seiner Hände Arbeit für die Produktion der benötigten Nahrungsmittel und Lebens- grundlagen allgemein zu sorgen, der geistliche Stand ist für Mission und Seelsorge, also für das Seelenheil zuständig und die Waffen des adeligen Kriegers haben den Schutz der Christenheit zu gewährleisten. Dass dabei der Priesterstand in einer Zeit, in der der Glaube an Gott und Teufel und somit an ein himmlisches und höllisches Jenseits ein unbedingter war, ein sehr hohes Ansehen genoss, ist nur allzu verständlich. Eine mög- liche Lebensform, ja die vorherrschende für die Kleriker der damaligen Zeit, stellte die mönchische dar. Hier, in der Umgebung des Klosters findet er seinen weltlichen und geistlichen Lebensmittelpunkt, hier reglementier- en - oder führen - die klösterlichen Regeln seinen Tagesablauf.
Christliches Mönchstum reicht bis in die Zeit des römischen Kaisertums zurück und basierten nicht zuletzt auf Über- legungen, dass man die erwartete Wiederkehr des Messias und das bald darauf folgende Weltende durch ein vorbildliches Leben in vollkommener Keuschheit beschleunigen könne. Eine radikale Form der in den Wirren der Spätantike viellfach geübten 'Abkehr vom gegenwärtigen Zeitalter' und der verdorbenen Welt, gewiss, doch entstanden speziell im Osten des Reiches schon bald solche Eremitenkolonien, die sich dieser Lebensführung verschrieben hatten. Kriege, Germaneneinfälle, die daraus resultierende Unsicherheit, hohe Steuerbelastungen und Repressalien des Staates unterstützten diesen Wunsch nach Weltabkehr zusätzlich - auch im Westen des Reichs. So sind bereits in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts Gruppen bezeugt - deren Mitglieder vorwiegend aus gebildeten Kreisen stammten -, die sich in privatem Rahmen in Italien zu einem asketischen Leben zusammenschlossen. Charakteristisch an diesen Mönchsgemeinschften war das Fehlen bzw. die Nichtbeachtung verbindlicher Regeln.
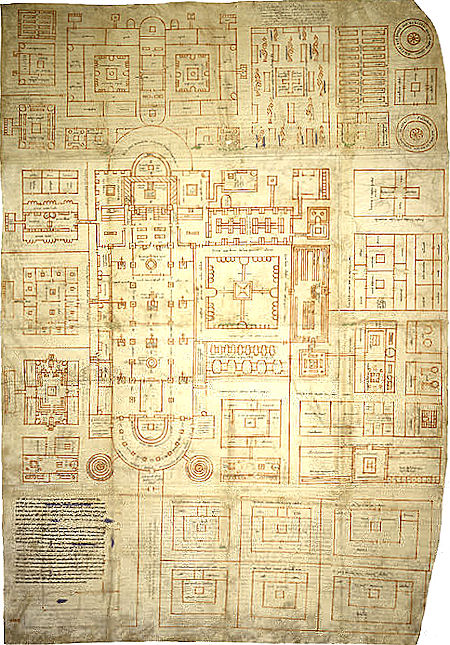
In weiterer Folge gab es immer wieder Versuche im Westen solchen Gemeinschaften Regeln des Zusammen- lebens zu geben; in diesen Zusammenhang gehören etwa die Namen Eusebius von Vercelli, Ambrosius von Mailand oder auch Gregor von Tours - allesamt Bischöfe der frühen Kirche im Westen des Reichs. Andere Geistliche begründeten die Verhaltensregeln für die von ihnen gegründeten Mönchsgemeinschaften auf ihre Erfahrungen mit den Wüstenvätern Ägyptens. Das erste lateinische Regelwerk, die anonyme Regula magistri entstand vermutlich im frühen sechsten Jahrhundert und schildert in 95 Kapiteln den Tagesablauf von zwölf Mönchen unter der Leitung eines Abtes in einem 'Modellkloster'. Allerdings erlangte dieses Werk keine blei- bende Bedeutung.
Wesentlich nachhaltiger sollten sich die 73 Kapitel des Benedikt von Nursia auf das klösterliche Leben des Mittelalters auswirken, auch wenn es vorerst nicht diesen Anschein hatte. Diese Benediktsregel(n), für seine Mönchsgemeinschft auf dem Monte Cassino geschaffen, die man später auf die suggestive Kurzformel ora et labora brachte, also 'Bete und arbeite', beschreibt alle wesentlichen Belange des Klosterlebens - auch solche, die für die praktische Umsetzung des gemeinschftlichen Lebens von Bedeutung waren und stellten die Grund- lage für viele spätere Ordensgründungen dar.
Aber nicht nur für Lebensführung und Gebet sah man Richtlinien vor. Auch dafür, wie die Lebensraum der Mönche aussehen sollte, wie also ein ideales Kloster aufgebaut sein sollte, gab es immer wieder Vorschläge. Ein sehr prominenter Entwurf für den Aufbau einer solchen Anlage findet sich in der Stiftsbibliothek von St. Gallen, der sogenannte St. Gallener Klosterplan , eine Grundrisszeichnung einer Klosteranlage auf Pergament. Man nimmt an, dass dieser Plan um 820 - 830 auf der Insel Reichenau entstanden ist; ein Widmungstext nennt einen Abt Gozbert von St. Gallen als Adressaten.
Dieser umfassende Plan stellt ein gut durchdachtes Konzept einer klösterlichen Gemeinschaft dar, die sich um ihren Mittelpunkt, die Klosterkirche und den Hof mit dem Kreuzgang, gruppiert. Da Beischriften zu den ein- zelnen Gebäuden die Darstellung ergänzen und zudem auch Mobiliar und Inneneinrichtungen sowie Angaben zu Installationen unter dem Fußbodenniveau verzeichnet sind, bietet diese Fülle an Informationen ein an- schauliches Bild von der (idealen) Einrichtung eines Klosters und lässt damit auch Rückschlüsse auf die prak- tische Lebensführung der Bewohner zu.
Zusammenfassend könnte man aus diesem Plan die Wunschvorstellung nach einer möglichst autarken Le- bensführung der Gemeinschaft herauslesen, finden sich doch neben Kirche, Wohnräumen, Schule und Krank- enhaus auch solche Gebäude, die für das Aufkommen an Dingen des täglichen Bedarfs unabdingbar waren: das Handwerkerhaus genauso wie die Bäckerei, Stallungen für vielerlei Getier, aber - und nicht gänzlich un- wichtig, wie uns scheint - auch die Brauerei. Eine genauere Beschreibung der einzelnen Teile dieser Anlage soll in den nächsten Folgen dieser Reihe über das Kloster erfolgen - eine wahre Freude für den Lateiner, wie wir schon vorwegnehmen wollen. Für alle anderen hingegen möge der Hinweis motivierend wirken, dass sich solcherlei Kenntnissen spätestens bei der Lektüre des nächsten Mittelalterklosterkrimis nutzbringend ver- wenden ließen ...
Weiter zum zweiten Teil der Artikelserie.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Mittelalterliche
Bauten

Mittelalterliche Bauten - Die Burg, Teil 2: Etymologisches zum Begriff
Zum ersten Teil der Artikelserie.
Nachdem im ersten Teil unserer Artikelserie über die mittelalterliche Burg bereits ein Ausblick auf gewisse Aspekte gegeben wurde, die in weiterer Folge bzw. in weiteren Folgen zur Sprache kommen sollen, stellt sich zu Beginn des zweiten Teils erst einmal die Frage, womit man denn anfangen sollte, wenn man über die Burg sprechen möchte. Da aber galt es nicht lange sich den Kopf zu zerbrechen, denn die Antwort schien uns son- nenklar: Eine Artikelserie über die Ritterburg darf nicht mit der Ritterburg beginnen! Am Besten, man fängt bei etwas ganz anderem an.
Nun so gänzlich anders wird dies nicht sein, denn wir wollen diesmal (und das nächste Mal) über die Herkunft der Burg sprechen, über ihre Wurzeln sozusagen. Diese Wurzeln wollen wir einerseits im historischen Kontext suchen, wenn wir uns denn fragen, auf welche Vorläufer sich die Burg des Ritters berufen kann. Andererseits können auch Wör- ter, genauer gesagt ihre Herkunft, einiges an Wissenswertem verraten, wodurch wir einen kurzen Abstecher in die Etymologie für angemessen erachten. Diesem letzteren Abstecher soll die heutige Folge gewidmet sein. Doch halten wir uns nicht unnötig lange am Vorwerk sinnloser Geschwätzigkeit auf, son- dern beginnen wir gleich mit dem Sturm auf die Kernburg.
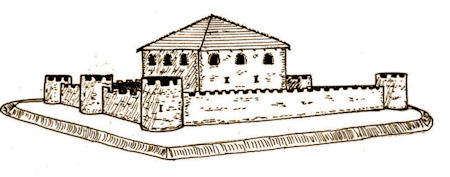
Der Begrif Burg nämlich, so könnte meinen, stamme klarerweise vom römischen burgus , das eine kleinere Be- festigung aus der späteren Kaiserzeit meint, einen gemauerten Turm, größer als die ursprünglichen Limes- türme, der häufig auch durch ein Außenwerk und umlaufende Gräben verstärkt wurde. Die Burgi bildeten in einer langen Kette - neben den größeren Verteidigungsanlagen und Kastellen den Grenzschutz des Reiches, waren aber auch im Hinterland als Überwachungsstationen und Sperren vorgesehen und konnten mit verhält- nismäßig kleiner Besatzung belegt werden.
Tatsächlich dürfte aber die Bezeichnung unserer Burg nicht von burgus herrühren, sondern, im Gegenteil, burgus eine Entlehnung aus dem Germanischen darstellen, zumindest zu einem Teil. Denn auf der anderen Seite führt man burgus auf das griechische pýrgos zurück, was wiederum soviel wie 'Turm, Mauerturm, Bela- gerungsturm' aber auch 'Wirtschaftsgebäude' bedeuten kann. Offensichtlich sind im spätlateineischen burgus also zwei Entlehnungen zusammengeflossen, die ursprüngliche griechische mit der (am Limes) lokalen germanischen.
Woher rührt dann der Begriff 'Burg', wenn nicht von burgus ? Von Berg beziehungsweise von seinem indo- europäischen Ahnen berghos , sagen die Etymologen. Damit meinte der Begriff ursprünglich wohl die 'befes- tigte Höhe,' kommt doch auch 'bergen' (im Sinne von schützen) vom Wort Berg. Gemeint ist damit aber eigent- lich dauerhaftes Bergen. Also bedeutet Burg in unserem Sprachgebrauch eigentlich eine Stätte des Wohnens und keine militärische Festung, auch kein befestigtes, vorübergehend belegtes Lager. Diese Bedeutung findet sich schon im griechischen 'Pergamos', der Burg des Priamos - reicht also bis zum Urvater des europäischen Heldenepos, bis zu Homer zurück. Burg und Pergamos bedeuteten somit Stätten und Orte des 'Bergens' von Menschen, aber auch Vieh und Schätzen.
Sinngemäß findet sich der Begriff Burg vorerst in vielen Ortsnamen, als Bezeichnung eben für Wohnstätten von Menschen. Bezeugt sind diese Namen ab dem 8. Jahrhundert im gesamten deutschsprachigen Gebiet. Derartige Namen mit dem Grundbegriff -burg können Ortschaften bezeichnen, die im Schutz einer alten Fluchtburg entstanden (etwa Würzburg . Oder aber im Schatten eines Römerkastells ( Augsburg, Flensburg ) oder eines befestigten Herrensitzes.
Burg meint also eigentlich die menschliche Siedlung im Nahbereich einer befestigten Verteidigungsanlage. Die Burg kann also jener Teil der Ansiedlung sein, die vor den Mauern liegt. Später dann, als die größeren Siedlungen zunehmend mit Mauern - Stadtmauern - ummantelt werden, beziwehungsweise die Mauern auch die äußeren Stadtteile umfassen, bis ins 12. Jahrhundert hinein, ist die Bezeichnung mit -burg für die Stadt beziehungsweise stadtähnliche Siedlungen gebräuchlich.
Erst dann beginnen für Ansiedlungen, die unter geänderten Bedingungen geschaffen und angelegt wurden, andere Namensbildungen gebräuchlich zu werden - etwa jene auf -stat . Ab diesem Zeitpunkt beginnt der Begriff der Burg dann für jene Wehr- und Wohnbauten der adeligen Herren freizuwerden, die wir heutzutage als Burgen zu bezeichnen pflegen. Diese ursprüngliche Vieldeutigkeit des Begriffes finden wir noch im Mittelhochdeutschen burc , das je nach Situation, aber auch Intention des Schreibers, sowohl 'Burg' als auch 'Schloss' oder 'Stadt' bedeuten kann - was wiederum die These bestätigt, dass die grösste Schwierigkeit beim Lesen mittelhochdeutscher Texte in möglichen Missverständnissen liegt, die aus Bedeutungswandel oder -einengungen weiterhin gebräuchlicher Begriffe resultieren. Nicht das, was wir nicht mehr verstehen, ist das Problem, sondern das, was wir missverstehen.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Mittelalterliche
Bauten

Mittelalterliche Bauten - Die Burg, das feste Haus des Ritters, Teil 1 zur Einführung
Viel zu lange schon wieder ist es her, da wir in dieser Rubrik Wissenswertes vermelden konnten. Hoch an der Zeit also, an dieser Stelle eine neue Serie beginnen zu lassen. Und was wäre besser geeignet dafür - auf einer Seite, die sich überwiegend mit Mittelalterlichem befasst -, als ein Thema zu wählen, das in Vielen von uns eine Assoziation mit dieser Zeit erweckt.
Nun, da gäbe es einiges an Charakteristischem zu benennen, denn das Mittelalter, war das nicht Mönch und Kloster? Stadtmauer und Luft, die frei macht? Kathedralen, die gen Himmel streben, auf der Suche nach Gott und der Ewigkeit, nach Licht und Musik? Ketzer, Pest und Frömmigkeit? Oder Frömmelei? Vor allem anderen aber waren es die Burgen, mit ihren Rittern - oder waren es die Ritter auf ihren Burgen? - die schon in frühen Kindheitstagen unsere Augen leuchten machten und unsere Herzen höher schlagen ließen.

Die Burg also ist es, der wir diese Serie widmen möchten. Die Burg - weithin sichtbares und nicht selten landschaftsdominierendes Bauwerk, offensichtliches Zeichen von Herrschaftswillen und und Distanz zum Volk, mächtiger Trutzbau -, was, so mag sich manch einer an dieser Stelle fragen, was sollte uns noch jemand erzählen, was wir noch nicht wissen? Nun, kleinlaut vermelden wir dies, nicht viel, wenn wir an die vielen Bücher denken, die sich mit großem Sachwissen bereits dieses Themas angenommen haben. Das soll aber auch nicht der Sinn unserer Seite sein, in Konkurrenz mit soviel Wissen zu treten. Allenfalls einige Gedanken wollen wir zum Besten geben - und wenn euch die gefallen, so wird uns des ebenfalls gefallen ...
Denn einiges gibt es schon zu sagen, über die steineren Häuser der Alten, die uns an romantische Zeiten gemahnen, in denen es noch Berufe gab, da man des Morgens, statt nach Aktentasche und Krawatte zu langen, das îsengewant anlegte und den Speer sich griff, und, anstatt stundenlang vor flimmerndem Bildschirm und Tastatur zu hocken, das eine oder andere Linwürmlein erlegte und manch hübsche Maid dabei befreite ... ach, die hübschen Maiden!
Ja da gibt es einiges zu sagen - nämlich, dass die Zeiten so romantisch gar nicht waren. Dass das steinerne Haus des Herrn Ritters kaum ein heimeliger Ort war, schon gar nicht während des eisigen Winters, da der Frost nächtens die Luft zum Klirren brachte und statt der kleinen vogellîn in den Zweigen höchstens der hungrige Meiser Isegrimm unter den Mauern sang.
Auch, dass das steinerne Haus über lange Zeiten aus Stein nicht war, sondern dass es zuerst hölzerne Bauten waren, Motten auf künstlichem Hügel, von Palisaden umzäunt, die dem Schutz und der Unterkunft der Herren dienten. Und von denen die Jahrhunderte kaum kaum Spuren zurückließen. Was aber zurückblieb, ist wiederum von verwirrender Vielfalt. Sieht man sich die vielen Bauformen an, - Höhenburg, Wasserburg, Tal- sperre, Stadtburg, Hafenfestung, Höhlenburg, riesenhafte Kreuzfahrerfestung mit mehrfachem Mauerbering, steinerner Turm und winziger Hof ... - so mag man sich schon fragen, was denn das Gemeinsame nun ist, das uns in all diesen Fällen von 'der Burg' sprechen lässt.
Leicht, werden nun die Vorzugsschüler unter uns rufen, die Burg, das ist eine Wehr-, Wirtschafts- und Wohn- form, die vielleicht vom 10. bis ins 16. Jahrhundert gebaut und benutzt wurde - als Herrschaftssitz und Mit- telpunkt, Zentrum eines politischen Machtbereiches, und die nicht zuletzt auch wirtschaftlich-administrativen Zwecken diente. Gut, nicht wahr?
Aber ...
Was aber?
Könnte diese Definition, in der einen oder anderen Gewichtung der genannten Aufgaben, nicht auch für die mittelalterliche Stadt herangezogen werden? Für den (befestigten) Wirtschaftshof? Das Dorf?
Hmm ... egal, sehen wir einfach nach, was uns die mittelalterlichen Quellen zu sagen haben. Nämlich dazu, was eine Burg denn nun ist.
Wer denn nun glaubt, dass damit eine eindeutige Bestimmung möglich wäre, den müssen wir enttäuschen. Denn die Terminologie dieser Quellen ... sie unterscheidet die Burg nicht eindutig von anderen Bauformen der Zeit. Da finden sich in den Texten (für unsere Lateiner) die Ausdrücke munitio, castellum, castrum aber auch domus lapidea und sedes. Auch gut, sagen wir, die spinnen eben, die Römer. Nehmen wir stattdessen einfach die mittelhochdeutschen Texte, die verstehen wir ohnehin besser. Burg - klar. Feste und Schloss - geht auch noch. Aber was ist das steinerne Haus? Das feste Haus? Eine Burg in unserem Sinn? Oder ein festgemauertes Gebäude? Und wenn vom Sitz die Rede ist?
Wie du vielleicht erkennst, geneigter Leser - es gibt doch Einiges zu sagen über die Burg. Und wenn du dich dann noch fragst, was denn den Mietskasernen und Gemeindebauten heutiger Tage mit der Ganerbenburg verbindet, ja was denn diese Ganerbenburg überhaupt sei, dann magst du ja wieder vorbeikommen. Denn irgendwann werden wir es dir verraten - soviel sei schon versprochen ...
Weiter zum zweiten Teil der Artikelserie: Etymologisches zum Begriff der Burg
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Redensarten
und Handwerk

Alte Redensarten - Was mag wohl der Herr dort im Schilde führen?
Weil denn zuletzt in dieser Rubrik über alte Redensarten das Wort ging, wollen wir euch verraten, dass wir auch heute wieder solches gegen euch im Schilde führen. Nämlich das, eine zwar alte, aber immer noch ge- bräuchliche Redewendung heranzuziehen und auf ihre ursprüngliche Bedeutung hin zu untersuchen. Welches geflügelte Wort, werdet ihr nun möglicherweise fragen, ist's denn diesmal, das wir über uns ergehen lassen müssen?
Nun, die besonders Scharfsinnigen unter euch, die Magistri und Doktoren, ob nun echte oder verhinderte, werden dies bereits erraten haben, den anderen sei es hiermit enthüllt: Wir wollen diesmal herausfinden, was sich hinter dem Spruch verbirgt, dass einer etwas im Schilde führt. Halt, werden die ersten unter euch rufen, halt, das ist zu einfach. Das wissen wir doch glatt, was damit gemeint ist! Denn wenn einer etwas gegen mich im Schilde führt, dann ist er erstens ein Schurke und meint es zweitens nicht gut mit mir! Denn er hat Böses im Sinn!

Und zu guter Letzt ist er noch ein Widerling sondergleichen, denn die Redensart impliziert, dass er, was er denn an Schlimmen plant, dies voller Heimtücke im Verborgenen tut. Punktum! Ja, antworten wir darauf, das stimmt ... aber nur zum Teil! Dann nämlich, wenn wir das Sprichwörtlein auf den gegenwärtigen Gebrauch beziehen. Früher aber, als es tatsächlich noch Zeitgenossen gab, die mit wirklichem Schilde durch die Lande zogen und schuppige Tiere erlegten oder in Ermangelung derselben reiche Pfeffersäcke schröpften, meinten die Worte wohl ursprünglich etwas anderes. etwas, was nicht von vorneherein mit negativem Sinn besetzt war.
Denn im hohen Zeitalter der ritterlichen Kultur, der Minnelieder und Turniere, der unzähligen Fehden und Auseinandersetzungen, galt es zwischen Freund und Feind zu unterscheiden, zwischen Verbündeten oder Gegnern. Möglichst schon, bevor die Gruppe der schwer bewaffneten Neuankömmlinge durch das geöffnete Tor ritt. Um nun den vollgerüsteten Herrn tatsächlich erkennen zu können, auf größere Entfernung bereits, dazu dienten mehr und mehr die persönlichen Erkennungszeichen, die sich später auch innerhalb der Familie vererbten. Das Wappenwesen war geboren und erlebte im Laufe des dahineilenden späteren Mittelalters seinen glanzvollen Aufstieg.
Dabei wurde es üblich, seine Zeichen und Farben nicht nur am Banner zu führen, sondern auch auf dem Rüstzeug, und selbst das Streitross derart zu schmücken, also Waffenrock und Schabracke (Pferdedecke) und - dort besonders hervorstechend - auch den Reiterschild. Man führte also tatsächlich etwas auf dem Schilde vor sich her, wenn man etwas im Schilde führte, nämlich sein Wappen, und damit seine persöhnliche Kennung, Eintrittskarte in die Burg befreundeter Familien oder Garantie für versperrte Eichenbohlen und Armbrustbol- zen.
Wie kann man sich den Bedeutungswandel erklären, durch den der Begriff heutzutage eindeutig negativ besetzt scheint? Nun, das lässt sich wohl nicht mehr mit Sicherheit sagen. Möglich erscheint uns, dass dies mit Turnier zusammehängt. Man führte dann im Ansprengen tatsächlich etwas gegen seinen Kontrahenten im Schilde - nämlich sein eigenes Wappen als Zeichen seiner Ehre und der seiner Familie. Und natürlich die Absicht, den Gegner unsanft aus dem Sattel zu werfen. Womit wir schon mit der Übertragung von einem optischen Zeichen auf eine Absicht angelangt wären. Und vielleicht lässt sich auf die Tatsache, dass sich hinter einem Schild auch trefflich mancherley Bösartigkeit verbergen lässt, wie ein gezückter Dolch oder ein kleines, handliches Beil, der Wandel in Richtung Heimtücke zurückführen.
Natürlich gäbe es im Zusammenhang mit dem Schild in Redewendungen noch eine Menge mehr zu sagen, etwa darüber, was mir meinen, wenn wir jemanden auf den Schild heben und was im Gegensatz dazu ur- sprünglich war - worauf wir aber angesichts reichlich vorhandener Asterix-Literatur wohl verzichten können. Und sollte euch einmal ein Herr Ritter begegnen, der seinen Schild verkehrt herum trägt, nämlich mit der Spitze nach oben, so ist dies vermutlich keinem Streitkolbenhieb und der darausfolgenden Verwirrung an- zurechnen, sondern eher der Tatsache, dass er damit seine Trauer über einen Todesfall auszudrücken pflegt, wie wir dies aus Wolframs Parzival erfahren. Man kommunizierte damals eben noch sehr viel über Zeichen, aber in gewissem Sinne ist das ja heute auch noch so. Auch wenn sich die Zeichen selbst oftmals geändert haben ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Redensarten
und Handwerk

Alte Redensarten - Allzu Übermütige wollen wir denn in die Schranken weisen ...
Mancherlei Begriff findet sich in mehr als nur einer einzigen Redensart, und es können gänzlich unterschied- liche Ursprünge sein, auf welche diese sprichwörtlichen Wendungen zurückgehen. Als Beispiel zur Veran- schaulichung dafür möge die Schranke genannt sein, die häufig anzutreffen ist - und deren genauere Be- trachtung, wie so häufig auf mittelalterliche Gebahrungen und Gebräuche zurückführt.
Da ließe sich einmal für jemanden in die Schranken treten, was heutzutage gemeinhein so verstanden wird, dass man sich für besagte Person einsetzt, zur Verteidigung und Rechtfertigung gewisser Taten oder Stand- punkte, sei es nun in Wort oder Schrift. Edel - doch sicherlich nicht mehr mit einem so hohen Risiko verbunden wie in mittelalterlichen Zeiten. Denn damals bedeutete dies, stellvertretend für eine angeklagte Person den Kampf mit dem Ankläger aufzunehmen - etwa um Schuld oder Unschuld in Form eines derartigen Gottesurteils abzuklären - und diese Auseinandersetzung nicht selten bis zum Tod eines der Kontrahenten durchzufechten. Heutige Juristen pflegen da ein etwas anderes Rechtsverständnis, aber wie heißt es so schön: 'Andere Zeiten andere Sitten ...'

So ist es etwa Lohengrin, der Sohn des Gralskönigs Parzival, der ausgesandt wird um die Unschuld der Elsa von Brabant, für die niemand einzutreten wagt, in einem derartigen Gottesurteil gegen ihren Ankläger und Verleumder Graf Telramund zu erweisen. Selbstredend gelingt ihm dies und da er offensichtlich ein schmucker, strammer Junge ist, ganz nach ihrem Geschmack, willigt Elsa ein ihn zu ehelichen. Allerdings schafft sie es nicht, auf Dauer ihre Neugier über seine Herkunft in Zaum zu halten ... aber hallo, da haben wir ja bereits die nächste Redensart - nur soll uns die erst bei anderer Gelegenheit beschäftigen ...
Einen in die Schranken fordern - diese Wendung führt uns ebenfalls zum mittelalterlichen Turnier- beziehungs- weise Kampfeswesen zurück. Einerseits wurde es etwa ab dem 15. Jahrhundert gebräuchlich, die Turniergeg- ner beim Stechen durch eine Mittelschranke voneinander zu Trennen um derart das Risiko etwas zu senken. Andererseits war der Turnierplatz durch Begrenzungen, eben Schranken, von der gaffenden Menge abge- grenzt. Einen in die Schranken zu fordern, meinte damit ihn zum Kampfe herauszufordern ...
Wenn wir heutzutage Schranken überschreiten , dann verletzen wir gewisse Verhaltensnormen, gehen also weiter als recht und billig ist - was uns Kopfschütteln, Tadel, eine gewisse gesellschaftliche Ächtung, im schlimmsten Fall Schimpf und Schande einbringen kann - oder aber Bewunderung, wenn man denn ein ge- wisses jugendliches Alter noch nicht überschritten hat.
Verfolgt man die Redensart zurück, führt sie wohl auf alte Gerichtsgebarungen zurück. Derartige Versamm- lungen (Thing, Ding) wurden ursprünglich unter freiem Himmel, an speziellen Gerichtsstätten, abgehalten. Zur Trennung von Rechtssprechenden und der beiwohnenden Menge wurde der Gerichtsplatz abgegrenzt - vorerst durch Haselstäbe, die einen kreisförmigen Platz umschlossen und mit Schnüren verbunden waren, später durch feste Holzschranken. Eine Überschreitung dieser Schranken durch Zuseher wurde mit einer Geldstrafe sanktioniert ... im günstigsten Fall. Denn andernorts wiederum hatte wer ins gericht freventlich tritt, greift, fällt, fuß hand oder hals verbrochen (siehe J. Grimm, 'Rechtsaltertümer').
Auch die Wendungen jemanden in die Schranken (zurück)weisen und sich mühsam in den Schranken halten - also gerade noch zurückzuhalten - weisen somit auf das alte Gerichtswesen zurück ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Ikonographie

Ikonographie und Typologie - Teil 2: Attribute
Zum ersten Teil der Artikelserie.
Viel Zeit ist ins Land gezogen, seit wir uns in einem ersten Artikel der Ikonographie, genauer gesagt mit den Schwierigkeiten befasst haben, welche die Bestimmung und Deutung von Motiven und Bildinhalten in der Bil- denden Kunst, speziell des Mittelalters, mit sich bringen. Doch nun wollen wir endlich den zweiten Teil folgen lassen, um damit zu verdeutlichen, dass wir selbstverständlich nicht die Absicht haben, dieses Thema unter den Tisch fallen zu lassen.
Die Schwierigkeiten, denen wir uns bei der Deutung mittelalterlicher Kunstdarstellungen sehr häufig gegen- übersehen, beruhen zu einem Großteil auf der gänzlich anderen Denkweise und Vorstellungswelt des damal- igen Zeitgenossen, der - soferne religiös (und wer war das damals nicht?) - das Leben allenfalls als Zwisch- enstation auf seinem Weg ins ewige Heil betrachtete. Doch die Schwierigkeiten beginnen bereits auf einer sehr viel trivialeren Ebene: Im Mittelalter konnte der Künstler ein gewisses Grundlagenwissen bei den Be- trachtern seiner Werke voraussetzen; man kannte die handelnden Figuren der Bibel, man kannte Heiligen- legenden, ähnliche Motive, etc. All das fehlt uns Heutigen, wenn wir vor einem derartigen Bildnis stehen.

Ein wichtiges Merkmal bei der Darstellung von 'Prominenten' stellen die sogenannten Attribute dar, mit denen sie abgebildet sind und die für die jeweiligen Personen kennzeichnend sind. Allgemein verstanden sind solche Attribute also bildliche Merkmale, die zur Charakterisierung von göttlichen, heiligen und historischen Personen dienen, aber auch zur Kennzeichnung von allegorischen Figuren und Personifikationen - wie etwa das Rad der Frouwe Sælde oder die Waage der Justitia.
Was kann nun in einer solchen Darstellung als Attribut dienen? Nahezu alles, wenn es nur mit der dargestell- ten Person in einem gewissen ursächlichen oder übertragenen Zusammenhang steht. So stellt in der obigen Abbildung der Kelch des Johannes jenes Gefäß dar, aus dem er der Legenda Aurea gemäß den Gifttrunk tun sollte, nachdem er sich geweigert hatte, der Artemis im berühmten Tempel zu Ephesus zu opfern. Selbstred- end konnte Johannes mit dem Kreuzzeichen das Gift entschärfen und nebenan auch noch zwei zuvor schon Verschiedene wieder vom Tode erwecken - was schließlich den dortigen Oberpriester zum Christentum be- kehrte. Wie man sieht, benörtigt man zur richtigen Entschlüsselung des dargestellten Apostels als Johannes ein gewisses Vorwissen. Petrus dagegen würden die meisten von uns wohl noch am Schlüssel als Pförtner der Himmelspforte erkennen. Überhaupt besitzt jeder der Apostel eigene, ihn charakterisierende Attribute.
Attribute können nun Tiere sein (etwa der Hahn bei Petrus), aber auch alle Gegenstände, Pflanzen - und da- bei besonders Blumen, man denke nur an die Lilie als Zeichen der Reinheit und Unschuld - und sogar mensch- liche Figuren sein (etwa bei den sogenannten Schutzmantelmadonnen). Je nachdem, in welchem Zusammen- hang sie zu ihrem Träger stehen, können sie dabei in realer oder in symbolischer Bedeutung aufzufassen sein. Dabei beginnt die Entwicklung der christlichen Attribute vom 3. nachchristichen Jahrhundert an. Bis ins 5. Jahrhundert hinein werden nun unter Verwendung der spätantiken Formensprache Figgurentypen zur Dar- stellung Gottes, Christi und der Heiligen entwickelt, die fortan stilbildend sein werden.
Vorerst erfolgt dabei die Kennzeichnung Letzterer als Heilige und Lehrer durch typische Gewandung - etwa das Pallium der Philosophen - und durch die antiken Berufsattribute Schriftrolle oder Buch (siehe die obige Abbildung des Petrus). Weiters erscheinen vorerst in Christusdarstellungen der kaiserliche Nimbus ('Heiligen- schein') oder der Siegeskranz bei den Märtyrern.
Neben diesen allgemeinen und Gattungsattributen beginnen sich seit dem 5. Jahrhundert dann zunehmend individuelle Attribute für bestimmte Heilige und Personen zu entwickeln - so etwa der bereits erwähnte Kelch des Johannes oder Petris Schlüssel. Mit dem 12. Jahrhundert bilden sich diese personenbezogenen Kenn- zeichen immer mehr aus, wobei der Kathedralenbau mit seinen plastischen Darstellungen einen großen Beitrag zu ihrer Verbreitung beifügt. Ein einzelner volkstümlicher Heiliger kann dabei im Laufe des Mittelalters mit vielen unterschiedlichen Attributen ausgestattet werden, die im zeitlichen Ablauf auch gewissen Darstel- lungs-'moden' unterliegen können.
Über einige dieser personenbezogenen Attribute wollen wir uns noch unterhalten Dies sei aber einer weiteren Folge vorbehalten ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Höfisches Leben
Das Turnier

Das ritterliche Turnier, Teil 7 - Das Turnier auf dem Wege in die Stadt
Zum ersten, zum zweiten Teil, zum dritten Teil, zum vierten Teil, zum fünften Teil und zum sechsten Teil der Artikelserie.
Mit den voranschreitenden Jahrhunderten änderte sich das Erscheinungsbild des mitterlichen Turniers: Was als Nachbildung einer Feldschlacht zwischen zwei Gruppen berittener Kämpfer begonnen hatte, die in ihren Feldharnischen, ausgestattet mit scharfen Waffen, aufeinanderprallten, als Übung für den Ernstfall, wandelte sich nach und nach zu einer Schauveranstaltung, auf der das ritteliches Selbstverständnis gepflegt und ritterliches Verhalten gezeigt werden konnte. Die Feldrüstungen wurde durch spezielle Turnierharnische ersetzt, anstatt scharfen Stahls zierten (häufig, aber nicht immer) ungefährlichere Krönlein die Spitzen der Lanzen, der Tjost, das Stechen Mann gegen Mann, lief der Buhurt den Rang ab. Schaulaufen statt Ernst - wenn auch immer noch gefährlich genug und oft genug mit Unfällen einhergehend.
Aber nicht nur in der Ausrüstung der ritterlichen Teilnehmer manifestierten sich die Änderungen. Das Turnier fand seinen Weg zunehmend in die Städte hinein, dorthin, wo Präsentationsexhibitionismus der Teilnehmer und die Schaugelüste eines adeligen (und nichtadeligen) Publikum zusammenkommen konnten, weil sich hier neben den Manschen auch die geeignete Infrastruktur und die notwendigen Mittel fanden, um die immer aufwendigeren Veranstaltungen zu finanzieren. Schließlich galt es, rund um die Schaukämpfe ein geeignetes Programm zu bieten, Preise zur Verfügung zu stellen, standesgerecht zu bewirten und dergleichen mehr.
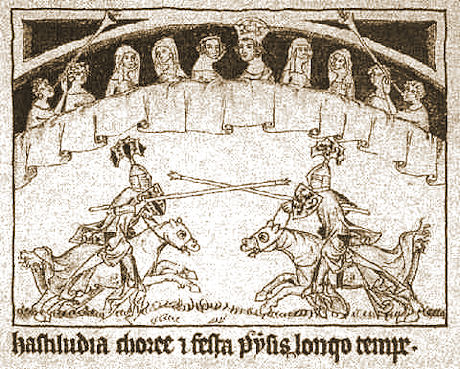
Ergibt sich dieses Rendevouz von Turnier und Kommunen im Falle einer landesherrschaftlichen Stadt fast von selbst, etwa wenn bei bedeutenden Ereignissen, die da Hochzeiten, Friedensschlüsse oder auch der Empfang bedeutender Persönlichkeiten sein können, Könige, Herzöge und andere hohe Herren den Reichtum ihres Hofes und ihren hohen Stand standesgemäß präsentieren. Überraschender kommt da schon die Erschein- ung, dass sich im späteren Mittelalter auch vermehrt unabhängige Städte unter den Ausrichtungsorten von derartigen Veranstaltungen finden.
Warum seltsam? Nun, wohl deshalb, weil die Konstellation zwischen landsässigen Adeligen und städtischem Patriziat, das Aufstreben der Städte, der zunehmenden Macht des Reichtums, der sich hinter den Mauern der Kommunen ansammelte auf der einen Seite und zunehmender Verelendung vieler ritterbürtiger Familien auf der anderen, eine natürliche Konkurrenzsituation entstehen lassen musste, die zu steten Auseinandersetz- ungen Anlass bot - man denke nur an des Stichwort Raubrittertum.
Dennoch galten das Rittertum und seine Ideale dem reichen Patrizier häufig als Vorbild, denen man nachzu- ahmen trachtete, etwa in Lebensführung, Repräsentation und Mäzenatentum. So verwundert es nicht, wenn reiche städtische Oberschichten den Aufstieg in den Adel anstrebten und diese Bemühungen zunehmend auch von Erfolg gekrönt waren - etwa dann, wenn König oder Kaiser einen Kreditgeber wieder einmal der- artig mit sozialem Aufstieg entlohnte. Von anderer, 'alt'-adeliger Seite, geringschätzig als minderwertiger Geldadel betrachtet, gab es in diesen Kreisen Versuche, sich gegen diese 'neureichen' Aufsteiger abzugren- zen und die eigene Identität damit zu wahren. So fanden sich sogenannte Rittergesellschaften zusammen, die neben den großen Herren als Turnierveranstalter in Erscheinung traten.
Um bei derartigen Veranstaltungen zugelassen zu werden, forderten diese Gesellschaften beispielsweise den Nachweis der Ritterbürtigkeit über mehrere Generationen hinweg, den Nachweis der regelmäßigen Teilnahme an Turnieren auch der Vorfahren. Neueinsteiger in das Turniergeschehen hatten Zeugen beizubringen, die zu bestätigen hatten, dass die Voraussetzungen erfüllt waren. Was blieb den reichen Neuadeligen, die in den Räten der Städte saßen, dann auch anderes übrig, als eigene Turniere für die Söhne auszurichten, Turniere, an denen Handwerksburschen und Kaufmannssöhne teilnahmen.
Interessanterweise suchten aber auch die Rittergesellschaften, die sich so streng abzugrenzen suchten, die Stadt als Veranstaltungsort für ihre Turniere - wegen deren angesprochener Attraktivität. Dass damit Pro- bleme einhergingen, Probleme, die aus der erwähnten Konkurrenzsituation resulterten, versteht sich da von selbst. So galt es, mit den Gremien der Städte für die Dauer des Turniers freies Geleit auszuhandeln - immer- hin mochten einige der ritterlichen Herren gerade in einer Fehde mit der Kommune liegen, mochte sich auch der eine oder andere Pfeffersack noch gut daran erinnern, kürzlich von den Knechten eines der Turnierteil- nehmers um einige Wagenladungen seiner Waren gebracht worden zu sein oder gar daran, einige Wochen lang unreiwillig das weiche heimische Bett mit dem harten Lager im feuchten Verließ einer Höhenburg ver- tauscht zu haben. Romantikurlaub pur, möchte man da fast sagen, nur dass die guten Krämer das gar nicht so empfanden ...
Auf der anderen Seite mussten der städtische Rat auch Sorge dafür tragen, Übergriffe, etwa infolge zu hef- tigen Alkoholkonsums im Verlaufe der Festaktivitäten, die stets ein solches Turnier begleiteten, möglichst im Keim zu ersticken - was nicht immer gelang. Was die Städte denoch dazu bewog, Turniere innerhalb ihrer Mauern zuzulassen, und wie sie damit umgingen, dass soll im nächsten Teil der Artikelserie abgehandelt wer- den ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Technologie des MA
Bauwesen

Planung von Bauten: Fassadenpläne und Modelle
Zum Artikel über den mittelalterlichen Werkmeister.
Der Kölner Dom gilt vielen Kunstexperten als Vollendung des Kathedralenbaus im gotischen Stil. Allerdings erfolgte die Fertigstellung des beeindruckenden Kirchenbaus erst im 19. Jahrhunderts, das somit in manchen Teilen ein Werk der sogenannten Neugotik darstellt. Begeht man somit einen Etikettenschwindel, wenn man im Bauwerk die Absichten der mittelalterlichen Dombaumeister verwirklicht sieht? Denn, so stellt sich die Frage, wie hätte man dem Verstreichen mehrerer Jahrhunderte, in denen der unfertige Dom das Stadtbild Kölns prägte, den mittelalterlichen Baukran immer noch auf dem unfertigen Turm, überhaupt noch dazu in der Lage sein können?
Weil, so lautet die Antwort, die mittelalterlichen Baumeister, teils in Anlehnung an Praktiken aus der Spätan- tike, Praktiken entwickelten um ihre Vorabplanungen für aufwendige Projekte festzuhalten. Dass derartige Planungsarbeiten speziell für Großbauten, wie etwa die Errichtung einer Kathedrale, notwendig waren, ist bei der Komplexität der Aufgaben und den daraus erwachsenden organisatorischen, finanziellen, technisch-statischen etc. Aufgaben unmittelbar einsichtig.
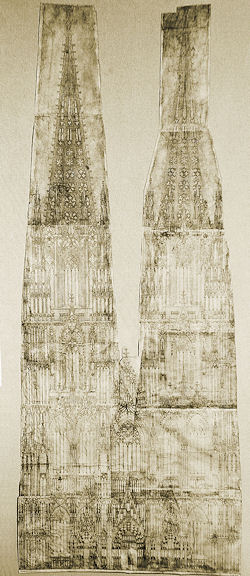
Bedenkt man dazu noch, dass sich die Ausführung derartiger Mammutbauvorhaben in der Regel über lange Zeiträume hinzog - manchmal verstrichen von der Bausteinlegung bis zur Fertigstellung sogar mehrere Jahr- zehnte, ja Jahrhunderte -, der Bau somit in die Wirkungsphase mehrerer Baumeistern fiel, dann wird noch klarer ersichtlich, wie wichtig die Festlegung der ursprünglichen Intentionen war, um das Projekt auch in seiner gewünschten Form vollenden zu können. (Dass es dennoch im Zuge der Fertigstellung an Anpassun- gen an jeweils geänderte Stilvorstellungen kommen konnte, ist wieder eine eigene Angelegenheit ...)

Ein solches Hilfsmittel für die Festlegung waren Baupläne. Denn seit dem 13. Jahrhundert gibt es Planungen für Bauten, die sorgfältig konstruiert auf Pergament aufgezeichnet wurden. Es handelt sich dabei um maß- stäbliche, zweidimensionale Projektionen, im Grund- und Aufriss, die - etwa für Turmprojekte - durchaus mehrere Meter Höhe aufweisen konnten. Solche Zeichnungen wurden studiert, kopiert und zur Ausbildung und zur Erweiterung des eigenen Erfahrungsschatzes verwendet. So fanden sich auf Bauhütten auch der- artige Pläne älterer Projekte oder von Bauten aus anderen Regionen, die als wohl Vorlagen für gewisse Teilaspekte des eigenen Bauvorhabens dienten.
Und damit wären wir wieder beim Kölner Dom angelangt. Denn 1814 wurde in Darmstadt eine Hälfte eines derartigen Fassadenplans für den Dom wiederentdeckt (datiert auf 1280), der mit seinen 4 Metern Höhe den mittelalterlichen Dombaumeistern als Arbeitsgrundlage diente. Etwas später - 1816 - fand sich in Paris die zweite Hälfte des Originalpergaments. Als es dann in den deutschen Ländern im Zuge der Romantik auf eine schwärmerische Rückbesinnung auf das 'glorreiche' Mittelalter kam, verbunden mit einem erwachenden Nationalbewusstsein, standen die originalen Pläne für den Fertigbau des Doms (mit damals modernster Technologie) zur Verfügung, der ein Symbol für dieses 'Wiedererwachen' dienen sollte.. Nur die Fassaden des Querhauses waren eine reine Schöpfung des 19. Jahrhunderts und somit der Neugotik, da von ihnen keine mittelalterlichen Pläne existierten.
Dass die Umsetzung derartiger zweidimensionale Pläne in das reale Bauwerk keine einfache Angelegenheit dartellte, versteht sich von selbst. Schließlich lässt sich das Aussehen dreidimensionaler Strukturen daraus nur mit großer Erfahrung herauslesen. Und die Lösung komplizierter technischer Probleme erfordert neben der nötigen Abstraktionsfähigkeit natürlich ein gerütteltes Maß an technischen und handwerklichen Fähig- keiten. Hier sei nur die Schwierigkeit erwähnt, dass etwa gleichseitige Rauten, die als Gewölbemuster die- nen sollten, bei der realen Umsetzung in alle Richtungen zu verzerren waren, um für den Betrachter zu eb- ener Erde den Eindruck der Gleichseitigkeit zu bewahren ...

Neben diesen Plänen und und den Skizzenbüchern der Baumeister (etwa eines Villard de Honnecourt), kannte das Mittelalter auch das vollständige Architekturmodell, das vermutlich in die Antike zurückreicht. Als maßstäbliche dreidimensionale Darstellung erleichterte es speziell dem Laien, sich eine bessere Vorstellung vom Aussehen des späteren Bauwerks zu machen als es dies ein Plan ermöglicht hätte - eine nicht uner- heblich Möglichkeit, um etwa einem Gönner ein eigenes Projekt schmackhaft und somit dessen Geldtruhen den Fortschritten der Architektur zugänglich zu machen. Umsomehr, als dieser bei großen Vorhaben die Fertigstellung unter Umständen ohnehin nicht zu erleben hoffen durfte, sehr wohl aber den auch heute noch zu beobachtenden Effekt, dass sich die geschätzten Kosten während der Bauzeit als etwas zu optimistisch entpuppten.
Derartige Modelle fanden sich in italienischen Bauhütten, aber auch das erhaltene hölzerne Entwurfsmodell (1520) des Werkmeisters Hans Hieber für die geplante Wallfahrstkirche in Regensburg (die dann allerdings in anderer Form errichtet wurde) gehört in diese Tradition. Vielfach sieht man derartige Architekturmodelle aber auch in den Händen der Stifter, die diese in den sogenannten Stifterdarstellungen als Sinnbild des gestifteten Bauwerks an den Hauptheiligen der Kirche übergeben ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Höfisches Leben
Das Turnier

Das ritterliche Turnier, Teil 6 - Hochadeliges Mäzenatentum
Zum ersten, zum zweiten Teil, zum dritten Teil, zum vierten Teil, und zum fünften Teil der Artikelserie.
Das ritterliche Turnier erfuhr im Laufe der Zeiten einige bedeutende Änderungen: Ursprünglich ein Massen- kampf mit stark kriegsähnlichem Charakter, wandelte es sich zu einem gesellschaftlichen Ereignis ersten Ranges, zu einem Ereignis mit hohem Unterhaltungswert - nicht zuletzt auch für die weiblichen Zuseherinnen. Während das Turnier seinen Siegeszug, von Nordfrankreich ausgehend, quer über Europa antrat, entwickel- ten und wandelten sich Regeln, Turnierordnungen wurden erstellt und Herolde oder Kampfrichtern über Aus- rüstung und korrektes Verhalten der Teilnehmer.
Das Turnier, der Massenkampf, aber auch der Zweikampf, das Lanzenstechen, fanden Eingang in die zeitge- nössischen Literaturen und wirkten von dort wiederum auf die adelige Realität zurück. Die Geschichten um König Artus und seine Ritter strotzen nur so von Episoden, in denen Feste geschildert werden, bei denen es zu Waffengängen kam, vor Herausforderern, die ihre Lanzen an all den glänzenden Helden zerbrechen und deren Helme mit dem Schwerter zerbleuen wollen. Schöne Frauen finden sich da zuhauf - und, den Dichtern sei Dank, kaum eine hässliche darunter, wie ja auch dei Ritter allesamt nur Schönlinge sind -, die dem Sieger ihre Bewunderung und manchmal auch mehr schenken.

Was nimmt es da Wunder, dass hohe Herren versuchen, diesem von der Literatur vorgegeben Idealbild nach- zueifern, dass es bald zur Gründung von sogenannten Tafelrunden kommt. Das Turnier entwickelt sich zu ein- em gesellschaftlichen Ereignis ersten Ranges und findet den Weg vom freien Feld, in dem die Gruppenschlacht stattfand, hin zum Burgvorplatz oder in die Stadt. Von hohen Tribünen herab, zum Bersten gefüllt, fliegen be- wundernde Blicke zu den gewappneten und bunt geschmückten Reiter hinab und wohl auch manch sehnsüch- tiger Seufzer. So voll sind die Logenplätze, dass die mittelalterlichen Chronisten über Unglücke zu berichten wissen, über verletzte Damen, wenn denn wieder einmal eines dieser Holzgerüste einstürzt. Turnieren blieb eben ein gefährliches Unterfangen - nicht nur für die stechenden Ritter.
Es sind vor allem die Höfe der Großen, Kaiser, Könige, Landesherren wie die Babenberger in Österreich, die sich bei der Ausrichtung solch glanzvoller Ereignisse hervortun. Klar, denn die steigenden Kosten, mit denen die Ausrichtung solcher Turniere verbunden war, erlaubte nur noch Wenigen derartige finanzielle Kraftakte. Das Fest, in dessen Rahmen in der Regel nun auch das Turnier stattfand, sei es nun ob der Schwertleite der Söhne, oder einer Hochzeit, eines Friedensschlusses oder ähnlichem, legte dem Veranstalter zahlreiche auf- wendige Pflichten auf, wollte er als mustergültiger Herrscher und Ritter gepriesen werden: Preise und Ge- schenke für die Turnierteilnehmer waren zu vergeben, wertvolle Tücher, Edelsteine, Waffen, Entschädigung für jene, die durch die Niederlage Ausrüstung und Pferd verloren. Und natürliche wollten auch die Musiker, Gaukler und Sänger reichlich entlohnt werden, um den Lob des Herrn in die weite Welt zu singen. Der auch als deftige Schelte ausfallen konnte, wenn denn der gute Fürst sich allzu sparsam beim Austeilen gezeigt hatte. Geiz galt dem Ritter als verachtenswerte Sünde , klar ...
Ein wenig helfen konnte sich der Veranstalter solcher Aufwendigkeiten natürlich schon, um nicht fürderhin in Armut darben zu müssen. So haben wir zuletzt von Richard Löwenherzens Turnierordnung gehört, davon, wie er Startgeld einforden ließ von jedem Teilnehmer und hohe Strafen abverlangte bei einem Bruch der Regeln. Neben dem Turnierplatz fanden nicht selten Märkte statt und die Marktgebühren mögen auch eine Hilfe bei der Finanzierung gewesen sein. Teilnehmer brachten wertvolle Stoffe mit, die dann als Geschenke verteilt wurden, etc... Und wozu hatte man denn nicht seine getreuen Untertanen, wenn nicht zur Finanzierung be- sonderer Belastungen, wie es eben Hochzeiten und dergleichen waren ...
Die Fürsten und die reichsten Herren wurden damit zu Mäzenen des Turnierrittertums - heute würden wir vielleicht sagen zu Sponsoren. Allerdings war es nicht selten der Fall, dass der Veranstalter des Ereignisses auch selbst daran teilnahm (Gottseidank haben sich diese Zeiten geändert viele Geldgeber würden heut- zutage am Fussballfeld kaum gute Figur abgeben) - ja, man erwartete das sogar von ihm. Dass dies unter Umständen zu gewissen Gewissenskonflikten beim jeweiligen Gegner führen konnte - das ist wohl nach- vollziehbar. So erzählt uns Salimbene von Parma eine Episode, nach der Karl von Anjou einen campanischen Ritter anonym zum Einzelkampf herausforderte, von dem man behauptete, er hätte alle gallischen und lom- bardischen Ritter besiegt. Zum abgemachten Termin sprengten die beiden Gerüsteten aufeinander los und zerbrachen ihre Lanzen aneinander.
Allerdings konnte sich beide Reiter im Sattel halten und so musste die Auseinandersetzung mit anderen Mitteln fortgesetzt werden. Man griff also zur Keule und der campanische Ritter - offensichtlich kam sein Ruf nicht von ungefähr - fegte den König von Sizilien mit zwei gebrochenen Rippen vom Pferd. Von seinen Ge- treuen ins Zelt gebracht, erlangte Karl erst das Bewusstsein zurück, nachdem man ihn bereits von der Rüs- tung befreit hatte. Andere Zeiten, andere Sitten - der Angeknackste dachte gar nicht daran klein beizugeben und das Feldbett zu hüten. Der Kampf sei fortzusetzen, bestand er. Allerdings hatte sich sein Gegner - wie es scheint nicht nur ein begnadeter Kämpfer sondern durchaus ein heller Kopf - zwischenzeitlich entschlossen das Weite zu suchen, nachdem er herausgefunden hatte, wer denn sein Gegner gewesen war, den er so- eben in den Staub geschickt hatte.
Und so konnte es manchem hohen Herren schon passieren, dass er mit dem Allerwerterste ebenso im Rasen landete, wie andere Turnierer auch. Andererseits wissen uns die Nachrichten auch von Fürsten und Königen zu berichten, die siegreich aus Turnieren hervorgingen. Attestieren wir, dass es stets nur ihre Geschicklichkeit und Kraft waren, die sie dazu befähigten. Und nicht etwa Dienstmannen, die ob des hohen Namens des Geg- ners zur rechten Zeit dienstbeflissen aus dem Sattel fielen ...
Weiter zum siebten Teil der Artikelserie
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Höfisches Leben
Das Turnier

Das ritterliche Turnier, Teil 5 - Reglementieren statt verbieten: Turnierordnungen
Zum ersten, zum zweiten Teil, zum dritten Teil und zum vierten Teil der Artikelserie.
Im Laufe des 12. Jahrhunderts begann das Turnier von Nordfrankreich aus seinen Siegeszug über Europa anzutreten. Doch wohl zu jeder Zeit betrieb die Ritterschaft Reiterspiele, bei denen es auf Geschicklichkeit in der Handhabung von Pferd und Waffen ankam. So erfahren wir aus deutschen Quellen, die noch vor 1150 datieren, von solchen Betätigungen des Adels - bevor sich noch der Begriff des Turnieres eingebürgert hat.
Derartige Spiele verliefen wohl noch nach anderern Regeln, vielleicht dem Buhurt ähnlich, bei dem häufig mit Schild und Stöcken, aber ohne Rüstung und scharfe Waffen geritten wurde. Die Übernahme französischer Turniergewohnheiten hat vielleicht die Gefährlichkeit des Kampfspiels erhöht und mit der Zunahme des Risikos wohl auch Attraktivität und Reiz beim Adel.

Unabhängig vom genauen Ablauf solcher Spiele dürfen wir sie uns wohl in ihrer Mehrzahl so vorstellen, dass sie eher kleinerer Art waren. Ein Ritter lud wohl einige Nachbarn zu sich auf seine Burg, wo man sich dann in diesem begrenzten Rahmen maß, so einen willkommene Abwechslung vom Alltag mit der sinnvollen Übung für den militärischen Beruf verbindend. Dass es die Möglichkeiten dieser Herren überstieg, riesige Feste auszu- richten, die später an den großen Höfen mit den Turnieren einhergingen, versteht sich von selbst.
Im Laufe der Zeit erkannten auch die bedeutenden Fürsten die Möglichkeiten, die ihnen die Ausrichtung der- artiger Spektakel boten - für die Zurschaustellung der eigenen Macht, der Demonstration von solch ritterlichen Idealeigenschaften wie Freigiebigkeit und Tapferkeit. Zumal mit dem höfischen Roman eine Literaturart ent- stand, die im Wechselspiel zwischen literarischer Fiktion und Realität gerade diese fürstliche Hofhaltung ein- forderte und feierte.
Doch eine solche Ansammlung von bedeutenden Herren, wie sie sich zum Turnier zusammenfanden, barg mehr als einen Grund für mögliche Konflikte. Bereits erwähnt haben wir jene Gelegenheiten, bei denen ein Turnier infolge unglücklicher Zustände - seien die nun durch die Hitze des ritterlichen Gefechtes bedingt oder durch das Zusammentreffen verfehdeter Gruppen am Turniergrund - 'heiß' wurde, zu einer regelrechten Schlacht ausartete. Wobei das Moment der Gefahr ohnehin niemals ganz ausgeschlossen werden konnte, wie auch die Beispiele für die zahlreichen Unfälle und Todesfälle zeigen, die wir in der letzten Folge anführten.
Abgesehen von diesen Unleidlichkeiten war es aber noch ein anderer Grund, der die Landesherren, die etwa in Frankreich und England, Ländern mit starkem Königtum, zuerst gar nicht so sehr als Veranstalter von Turnieren in Erscheinung getreten waren, stets ein misstrauisches Auge auf derartige Veranstaltungen werfen ließ. Das Zusammentreffen bedeutender Herren und Barone bot stets auch die potentielle Gefahr von Absprachen und Konspirationen, die der königlichen Macht zuwiderliefen. (So nützten etwa 1215 englische Barone ein solches Turnier um ihre Rebellion gegen König Johann 'Ohneland' wieder aufzunehmen.) Daher wurde dort immer wieder versucht, dieser Gefahr zu begegnen - mit wechselnden Taktiken. Phasen, in denen man Turniere möglichst zu unterdrücken suchte, wechselten sich ab mit Herrschaften, während der Turniere erlaubt waren - aber unter starken Einschränkungen, was Austragungsorte und Reglement bzw. die Turnier- ordnung betraf.
Als Beispiele sei hier die Turnierverordnungen von Richard I. von England ('Löwenherz') genannt, der ähnlich dem späteren Edward I. selbst ein eifriger Teilnehmer an Turnieren war. Dennoch versuchte er ebenso wie Edward mit seinen Verordnungen eine starke Reglementierung zu erzwingen, während etwa die 'turnier- feindlichen' Könige Edward II. und Henry III. das ritterliche Kampfspiel möglichst zu unterdrücken suchten. Bei all diesen Verordnungen und Reglementierungen galt als gegeben, dass den Teilnehmern einer derartigen Veranstaltung vor und nach dem Turnier Frieden zu geben war, das heißt, das Fehden nicht ins 'Spiel' hineingetragen werden sollten und das die ritteliche Auseinandersetzung mit Turnierende wieder beendet zu sein hatte.
Die Verordnungen Richards, die er 1194 erließ, sahen vor, dass in England lizensierte Turniere nur noch an fünf Orten stattfinden sollten, von denen vier in der Nähe Londons lagen und damit eng unter königlicher Kontrolle standen. Drei Grafen waren namentlich erwähnt, um für die einhaltung der Turnierregeln zu sorgen. Außerdem musste, wer an einem der königlich gestatteten Turniere teilnehmen wollte, ein Startgeld aufbrin- gen. Dies reichte von 2 Mark für den dahergelaufenen, landlosen Ritter bis zu 20 Mark für einen Grafen - und dies alles zum Wohle der königlichen Kassen, die ja nach Richards ungeplant teurem Mitteleuropaaufenthalt ohnehin der Auffrischung bedurften. Die Geldeintreiber sollte der Erzbischof von Canterbury in Form von zwei Bediensteten und zwei Rittern bereitstellen. Außerdem wurde all jenen, die zum Turnier anreisten, ein Eid abgenommen, dass sie während der An- und Abreise der Bevölkerung keinerlei Lebensmittel ohne Bezahlung abpressen und den königlichen Frieden einhalten würden.
Insgesamt war ein solches Turnier dem begeisterten Turnierkämpfer Löwenherz somit jedenfalls auch ein gutes Geschäft, das dem finanzmaroden König auch in mittlerer Größe schon mal 200 oder mehr Mark ein- bringen mochte. Selten, dass sich die Großen so bereitwillig und begeistert schröpfen liesßen, wie die turnier- verrückten Adeligen dieser Epochen. Die Startgelder waren selbstverständlich im Voraus zu bezahelen und zudem versprachen die Strafen, die jene ereilten, welche den Turnierverordnungen zuwiderliefen und den Eid brachen, einen weiteren Happen an Silber.
Weiter zum sechsten Teil der Artikelserie
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Höfisches Leben
Das Turnier

Das ritterliche Turnier, Teil 4 - Tragisches, Skuriles und Kurioses beim Turnei
Zum ersten, zum zweiten Teil und zum dritten Teil der Artikelserie.
Nach längerer Pause wollen wir uns diesmal wieder des ritterlichen Turniers entsinnen, dem wir bereits mehr- ere Artikel gewidmet haben. Wer sich mit mittelalterlicher Literatur beschäftigt oder mit (adeliger) Mentalitäts- geschichte, der wird nicht um diese zentrale Erscheinung des herrschaftlichen (Fest-)Alltags umhinkommen. Beschäftigten wir uns in den ersten Folgen mit dem Aufkommen und den Frühformen, mit den Bewerben und den Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten, die sich adeligen jungen Heißspornen bei solchen Veranstaltun- gen boten, so wollen diesmal mit einigen - teils kuriosen, teils tragischen - Aspekten des Turniers befassen.
Ursprünglich als Training, Vorbereitung vielleicht auch Ersatz für die kriegerische Tätigkeit des adeligen, be- rittenen Kriegers gedacht, erlangte das 'Turnieren', vom Norden Frankreichs ausgehend, bald schon eine un- gemeine Popolarität unter den abendländischen Herren. So groß war die Begeisterung jener, dass sich Papst Innozenz 1130 auf dem Konzil von Clermont veranlasst sah, ein Turnierverbot auszusprechen - meinte er doch die Energien der Herren Ritter im Heiligen Land besser eingesetzt. Doch die Kirche tat sich ebenso schwer, derartige Verbote durchzusetzen - selbst die Drohung, den im Turnier Gefallenen, das Begräbnis in geweihter Erde zu verwehren, konnte da nicht helfen - wie manchen Ortes weltliche Fürsten. Allenfalls konnte man von einem Dämpfen, nicht jedoch vom gänzlichen Unterdrücken dieses sportlich-kriegerischen Flächen- brandes sprechen.

Wahrscheinlich spielten nicht nur militärische Gesichtspunkte beim Aufkommen dieser 'Mode' eine Rolle, einer Mode, die bis weit ins 16. Jahrhundert hinein Bestand haben sollte, sondern auch eine gegenseitige Beein- flussung der adeligen Lebenswelt mit der zeitgenössischen Literatur, deren Helden sich vielfach bei prunk- vollen Turnieren bewähren müssen, sei dies nun im Einzelkampf, wie Erec, oder in der Gruppenschlacht wie Parzivals Vater Gachmuret.
Doch wie immer wird über das, was große Popularität erlang hat, nicht nur berichtet - wir kennen hier etwa die Biographie des Guillaume de Marechal, des 'Besten aller Ritter' - sondern es unterliegt auch der Parodie und karikierenden Verzerrung. So verwundert es nicht, dass literarische Turnierparodien bereits gegen Ende des 12. Jahrhunderts auftauchen. Als besonders augenfällig wollen wir dabei auf jene 'Erzählungen' hinwei- sen, die sogenannte Damenturniere zum Inhalt haben (Explicit le tornoiement aus dames bzw. Explicit le tornoiement as dames de Pari).
Beiden Schilderungen gemein ist, dass sie von fiktiven Turnieren berichten, die in der unmittelbaren Umgeb- ung von Paris stattfinden und deren Teilnehmer Frauen sind. Natürlich handelt es sich dabei um literarische Erfindungen. Indem sie aber hervorheben, dass die streitbaren Damen die Turniere deshalb veranstalten, weil die Herren Könige, Fürsten und Ritter für derartige Betätigungen nicht mehr zu gebrachen sind, da sie ihr Lebensstil verweichlicht hat, verraten sie doch eine ganze Menge. Insbesondere dann, wenn man einigen Meinungen folgt, die da sagen, hinter den Erzählungen verberge sich eine satirische Spitze gegen das ermü- dende Kreuzzugsinteresse ...
So lustig dies klingt, so lustig verliefen Turniere nicht immer. Zwar gab es (speziell in späterer Zeit) Turnierordnungen, die genaue Regeln vorgaben, was bei einer derartigen Veranstaltung erlaubt war und was der Ächtung und der Buße unterlag. Insbesondere war es verboten den Gegner zu töten, bei An- und Abreise hatte ein Turnierfrieden eingehalten zu werden, etc. Doch wer schon einmal die Gruppendynamiken erlebt hat, die sich zwischen rivalisierenden Fangruppen von Sportvereinen ergeben können, der mag sich vorstellen, was passieren kann, wenn die Hitzköpfe an der Stelle von Bierbechern über Schwert und Streitkolben verfügen. So mag es auch nicht verwundern, dass das eine oder andere Turniertreffen schon einmal in einen blutigen Kampf ausartete - wie etwa 1273 in Chalon, wo der englische König Edward I. nach seiner Rückkehr vom Kreuzzug mit seinen Männer bei einem Turnier antrat, das in eine Schlacht gegen den Herzog von Burgund ausartete. Grenzenlose Begeisterung eben ...
Tatsächlich kam es öfter vor, dass das Kampfspiel in Kampf ausartete. Besonders dann, wenn sich Fehde- gegner auf dem Turnierfeld begegneten, oder wenn Mitglieder verfeindeter Parteien während eines Waffen- stillstandes miteinander turnierten. Doch solche Animositäten waren nicht die Hauptursachen für die vielen Todesfälle, die es bei solchen Veranstaltungen zu beklagen gab. (Zum Glück machte die Kirche ihre Drohun- gen nur selten wahr, was die Verweigerung der Beisetzung in geweihter Erde betraf - ein höchst tröstlicher Umstand). Vielmehr handelte es sich um unvermeidliche Unfälle und bedauernswerte Umstände, die für die Mehrzahl von adeligen Witwen verantwortlich zeichneten. Die vielen Knochenbrüchen und Verrenkungen wollen wir hier als bedauernswerte aber vernachlässigbare Raderscheinungen an dieser Stelle gar nicht erst erwähnen.
So gibt es bereits beim ersten historisch bezeugten Turnier in Flandern mit dem Graf von Löwen, der einem allzugenauen Lanzenstoß mitten ins Herz Tribut zollen musste, ein prominentes Todesopfer zu beklagen. Am Ende der Epoche wiederum, 1559, fiel der französische König Heinrich II. bei einem Turnier in Paris einem Lanzensplitter zum Opfer, der durch den schmalen Sehschlitz des Helms ins darob nicht amüsierte königliche Auge und von dort weiter ins Gehirn vordrang. Zehn Tage später verstarb der König, trotz aller Bemühungen seiner Ärzte, die in ihrem lobenswertem Drang zu helfen, angeblich sogar einige Gefangene hinrichten ließen um einen Eindruck über das Innere eines Kopfes zu erlangen. Und wenn's schon dem Herrn König nicht mehr half, dann wenigstens der Wissenschaft ...
In den dazwischenliegenden Jahrhunderten gab es bei Turnieren oder als Folge davon eine ganze Menge weiterer prominenter und viele unbekannter Opfer zu vermelden - man denke nur an den bedauernswerten Babenberger Leopold V., dem, aus dem Sattel gestürzt, das Bein zerquetscht wird und der dem Wundbrand erliegt - trotz gerüchteweiser selbst durchgeführter Amputation. Wem dies nicht alles noch nicht skuril genug erscheint, der lese in alten Berichten darüber, dass viele Ritter nicht den Lanzen der Gegner oder Unfällen erlagen, sondern ... der sommerlichen Hitze und dem Staub am Turnierplatz, der, staubtrocken, häufig mit Stroh und Heu ausgelegt war. Also meine Herren, mehrere Liter Flüssigkeit am Tage sollten es schon sein ... was aber vor der Erfindung des Trinkhalms im Eisengewand zugegebenermaßen nicht einfach zu bewerk- stelligen war. Und dass Erschöpfung schon mal zu Kreislaufproblemen führen kann, nimmt uns nicht weiter Wunder, wenn wir denn erfahren, dass der Ministeriale Otto von Haslau 1278/1280 noch mit stolzen Achtzig ins Turnier ritt. Darüber, ob er es auch siegreich beendete, ist uns leider keine Kunde zugegangen ...
Weiter zum fünften Teil der Artikelserie
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Wirtschaftsorganisation
im Mittelalter
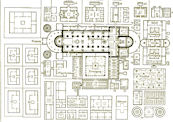
Münzsystem im Karolingerreich - Wirtschaftssystem, Teil 3
Zum zweiten Teil der Artikelserie.
Nachdem die ersten beiden Folgen über den Wandel der Wirtschaftssysteme von der ausgehenden Antike bis hin ins hohe und späte Mittelalter einer Betrachtung globaler Gesichtspunkte gewidmet waren, wollen wir heute auf ein spezifischeres Thema anschneiden. Dabei wird eine Erscheinung fortgeschrittener Gesellschafts- systeme ins Blickfeld rücken, deren seltsame Natur bereits seit langem schon erörtert wird - nämlich das Geld selbst, das als Tauschmittel und Aufbewahrungsmöglichkeit für Werte einen so hohen Stellenwert ein- nimmt, sodass manche meinen, ihm alles andere unterordnen zu müssen ...
Hier ist es an der Zeit, zuzugestehen, dass auch wir von der Sælde und êre gerne über Geld sprechen und schreiben und dabei in unsererm Kopfe Bilder voll wonnig lockendem, güldenem Glitzern erstehen und das Wohlklingen von edelmetallenen Scheiben, und dass wir uns - bis vor Kurzem - auch des umfassenden Be- sitzes desselben nicht abgeneigt gezeigt hätten. Seit Neuem aber, da die Krise hereingebrochen und Berater nur über den bestmöglichen Weg nachzusinnen scheinen, wie unserer Geldreserven zu vernichten seien, da meinen wir, wir hätten es ganz gut damit getroffen arme Schlucker zu sein. Mögen doch die schlimmen Kapi- talisten in Entenhausen bleiben und sich um Aktienkurse sorgen ...

Und ein seltsames Ding ist es allemal, dieses 'Geld', das an sich selbst doch keinen speziellen Wert besitzt (speziell, wenn wir von 'großen' Scheinen sprechen, die wir am Liebsten im Säckel tragen. Denn, was ist der eigentliche Wert eines solchen Stück Papiers denn wirklich? Können wir davon essen, trinken oder uns damit wärmen? Bestenfalls beim Entfachen eines Feuerchens kann es uns dienlich sein ... aber wir warnen von ei- ner allzu raschen derartigen Verwendung) und doch zum Tausche und als Recheneinheit dient - solange Ver- trauen in seinem 'Wert' besteht. Seltsam, fürwahr ... doch lasst uns nun zum eigentlichen Kern des Artikels begeben.
Das Römische Reich besaß ein ein hoch entwickeltes Geldwesen, das auf Münzen aus Gold, Silber und Kupfer basierte. Mit seinem Niedergang uns speziell mit den arabischen Eroberungen und dem Einfall nordischer Plünderer brach dieses System zusammen - die beiden ersten Artikel der Serie beschäftigten sich mit diesen Vorgängen. Zwar gab es zwischenzeitliche Versuche die Münzprägung wiederzubeleben, doch es blieb den Münzreformen der karolingischen Herrscher Pippin und Karl (der Große) vorbehalten eine neue Grundlage für das mittelalterliche Geldwesen zu legen.
Bis um 750 fungierten die prägenden Münzmeister als Privatunternehmer. Pippin der Jünger, bis 751 frän- kischer Hausmeier, danach König des Frankenreiches, stellte das Münzwesen unter staatliche Aufsicht. Sein Sohn, Karl (der Große), beanspruchte schließlich die ausschließliche Münzhoheit für die fränkischen Könige. Darunter fielen die Zuständigkeiten für die Münzprägung, die Errichtung von Münzstätten sowie den Münzfuß. Letzterer legt fest, wieviele Münzen aus einer festgelegten Gewichtseinheit eines gewissen Edelmetalls geschlagen werden dürfen, und somit auch, wieviel Korn (Edelmetall) und Schrot (unedle Beimengungen) in einer Münze enthalten sind - womit der 'Verschlechterung' des Geldes durch 'Strecken' entgegengewirkt werden soll. Dies war eine Versuchung, der im Laufe des Mittelalters immer wieder Landesherren ausgesetzt waren, wenn denn wieder einmal eine finanzielle Knappheit infolge eines Krieges oder anderer prestige- trächtiger Aktivitäten anstand.
Mit der Reform 793/94, mit der Karl ein einheitliches Münz- und Maßsystem zu schaffen versuchte, wurde das römische Pfund durch das pondus caroli, das Karlspfund, ersetzt. Als Grundgewicht (Pfund) galten nun 408 Gramm Silber, aus dem 240 Denare oder Pfennige zu jeweils 1,7 Gramm geprägt wurden. 12 dieser kleinsten Einheiten ergaben eine Solidus (Schillung), während 20 Schillinge wiederum ein ganzes Pfund ergaben. Im Gegensatz zum Denar blieben aber Schilling und Pfund vorerst reine Recheneinheiten, die dazu dienten Wa- renpreise und den Wert größerer Geldsummen zu kennzeichnen. Als Münze im Umlauf war einzig der Denar.
Mit dieser Reform wurde in Westeuropa endgültig die Silberwährung eingeführt, die als solche nun für ca. 5 Jahrhunderte unangefochten bestehen blieb. Das System von Pfennig - Schilling - Pfund blieb in vielen Staa- ten sogar noch länger bestehen (in Großbritannien sogar bis 1971). Allerdings musste sich diese Währung wegen fehlender Anreize zum Handel, wegen des fehlenden Angebotes längere Zeit vielfach noch mit dem Status als Hort- und Protzgeld zufriedengeben bzw. als Recheneinheit zur Kennzeichnung eines Warenwert- es. Erst im Zuge des Wiederauflebens der Fernhandelsbeziehungen und des Neuaufkommens eines Händler- und Kaufmannsstandes kam der Münze wieder eine höher Bedeutung zu.
Weiter zum vierten Teil der Artikelserie.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Wirtschaftsorganisation
im Mittelalter
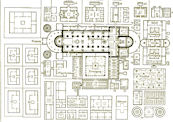
Der Wandel des Wirtschaftssystems im Frühmittelalter - Teil 2
Zum ersten Teil der Artikelserie.
Seit der Mitte des 10. Jahrhunderts bleiben die großen Raubzüge und Einfälle ins westliche und zentrale Eu- ropa aus. Sei es nun, da die Eingesessenen die Gefahr mit Waffengewalt bannen konnten - wie etwa Otto I. in der Schlacht am Lechfeld oder die italienischen Städte, die nach und nach der sarzenischen Plünderer Herr werden konnten - oder aber die Eindringlinge mit Land belehnt und selbst sesshaft wurden - wie die skan- dinavischen Plünderer in der Normandie. Seit dieser Zeit macht sich auch ein zunehmendes Bevölkerungs- wachstum bemerkbar, das wiederum gewisse Probleme mit sich bringt, die zusammen mit weiteren Ursachen Umwälzungen im mittelalterlichen Wirtschaftssystem mit sich bringen, aber auch für gewisse poltisch-histor- ische Veränderungen verantwortlich zeichnen wird.
Dieser Bevölkerungsüberschuss macht es den nachgeborenen Söhnen schwer, ihren Platz in der traditionel- len Wirtschaftsordnung zu finden, egal ob es sich um die Nachkommen adeliger Herren handelt, deren Besitz- tümer an die erstgeborenen Söhne übergehen oder um solche leibeigener Bauern, deren zugewiesene Hufe nicht mehr ausreicht um alle Mäuler zu stopfen. Erstere, die adeligen Zweitgeborenen, werden, soferne nicht als angehende Kleriker in der Kirche untergebracht, vielfach jene Abenteurertrupps bilden, die die zahlreichen normannischen Eroberungen bis hin zur süditalienischen Reichsgründung initiieren. Sie sind es auch, die die große Masse der teilnehmenden Ritter der ersten Kreuzzüge stellen - in der Hoffnung auf Gewinn und Erwerb eigener Herrschaften.

Jene wiederum, welche die väterlichen Höfe verlassen müssen, sind gezwungen, sich, landstreichend durchs Land ziehend, neue Erwerbsquellen zu suchen, die Strände nach Überresten von Schiffbruch abzusuchen, in den Dienst reicher Herren oder Klöster zu stellen oder aber ein Auskommen in den neugegründeten Städten zu finden.
Diese Möglichkeiten mehren sich. Denn während in den hergebrachten Kulturgebieten vorerst kaum Änder- ungen im traditionellen grundherrschaftlichen Wirtschaftssystem ersichtlich sind - die dortigen Herren, adelige Grundbesitzer, Benediktinerabteien, sehen wohl auch kaum Gründe um das 'Bewährte' zu ändern, man legt keinerlei Wert auf 'Gewinnmaximierung', es gibt jahrhundertelang kaum Innovationen, der landwirtschaftliche Ertrag dieser Ländereien bleibt im Verhältnis zu ihrer Ausdehnung lachhaft gering -, liegen große Teile von Europas Zentralräumen immer noch brach, von Urwäldern, Einöden, Sümpfen überzogen. Hier findet sich für Tatkräftige die Möglichkeit, Wald zu roden und sich neuen Lebensraum zu schaffen.
Mit den Zisterziensern betritt Ende des 11. Jahrhunderts ein neuer Orden die europäische Bühne, der, wie die meisten Orden zum Zeitpunkt ihrer Gründung, eine Rückkehr zur streng mönschischen Lebensordnung nach der Ordensregel des Benedikt von Nursia anstrebte. Die Mitglieder der Gemeinschft sollten von ihrer eigenen Hände Arbeit leben und darum war die Ansiedlung des Ordens für viele Landesherren eine hervorragende Möglichkeit, die Gewinnung neuen Siedlungsraumes anzuregen - man denke nur an die Gründung Heiligen- kreuzes durch den Babenberger Leopold III ('dem Heiligen').
Anders als ihre benediktinischen Brüder, die sich immer noch nach den ökonomischen Prinzipien der Karolin- gerzeit ausgerichtet zeigen, initiieren die Zisterzienser eine neue Organisationsform der Verwaltung ihrer Besitztümer. Als Neugründungen, die der feindlichen Umwelt durch Rodungen abgerungen wurden, handelte es sich meist um zusammenhängende Flächen. Für diese Urbanmachung bedienten sich die Klöster der Laien- brüder oder Konversen, die ohne Weihen und mit verminderter Gebetspflicht die hauptsächliche Last der körperlichen Arbeiten neben eigentlichen Lohnarbeitern zu tragen haben. Dabei resultiert aus der zentralen Verwaltung und der Verwendung von zusätzlichen Hilfskräften ein rationellerer Betrieb mit höheren Erträgen. In den Urkunden finden auch zunehmend die sogenannten Gäste oder advenae, Neuankömmlinge, Fremde, Siedler, die sich auf der Suche nach kultivierbarem Neuland befinden und deren Arbeitsleistung gerne heran- gezogen wird - übrigens nicht nur von den Zisterziensern, sondern auch von Landesherren.
Laienbrüder, Neusiedler rekrutieren sich zum Großteil aus jenen, welche die heimatliche Hufe nicht mehr er- nähren kann, aus den Gruppen von besitzlosen Landstreichern, aber auch aus schollenflüchtigen Leibeigen- en, die dem Herrn entwichen sind. Denn die Ansiedlung in den neuen Siedlungsgebieten, die man der Wildnis erst abringen muss, die noch der Kultivierung harren, bietet eine Menge von Vorteilen für die Ankömmlinge. Diese Anreize bietet der Landesherr, der an der Gewinnung möglichst vieler rodender und arbeitender Hände interessiert sein muss. Zuwanderer werden angelockt durch günstige materielle und persönliche Lebensum- stände, größere Freiheiten, durch regelrechte Propaganda, durch die Verlesung der Handfesten der jeweili- gen Neusiedlungen - landauf und landab.
Die Rechtssituation dieser Neusiedler in ihren neugeschaffenen Siedlungen unterscheidet sich somit grundle- gend von jener der Leibeigenen in den alten Siedlungsräumen. Es wird bald Anreize und Möglichkeiten geben, aus dem eigenen Land, das allenfalls noch von einem Zins für den Landesherrn belastet ist aber nicht mehr mit Fronarbeit auf dem grundherrlichen Salland, etc, Gewinne zu ziehen. Gewinne, die man wiederum vermar- kten kann, gegen Waren eintauschen, eventuell mit zunehmendem Wohlstand einer neuen Klasse von Bür- gern sogar gegen Luxusgüter, für die in der Folge ein überregionaler Markt entstehen wird, Absatzmöglich- keiten für den Handel, damit im Gefolge eine zunehmende Geldwirtschaft. Die Wirtschftswelt ist im Wandel begriffen, Neues entsteht ...
Mehr dazu gibt es dazu dann in unseren nächsten Artikeln zu lesen ...
Weiter zum dritten Teil der Artikelserie.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Wirtschaftsorganisation
im Mittelalter
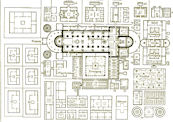
Der Wandel des Wirschaftssystems im Frühmittelalter - Teil 1
Im Spätsommer des Jahres 476 wird der letzte weströmische Kaiser, der jugendliche Romulus Augustulus vom germanischen Heerführe Odoaker abgesetzt, das Weströmische Reich hört als politisches Gebilde auf zu be- stehen (- nicht jedoch als Idee). Gemeinhin datieren wir mit diesem Datum auch das Ende der Antike, obwohl der Prozess der Auflösung der römischen Macht und der Umgestaltung der antiken Welt in die mittelalterliche Gesellschaft ein sehr langwieriger ist, der bereits früher einsetzte und einige Jahrhunderte in Anspruch nimmt.
Die 'finsteren Epoche' die dieser Umbruch mit sich bringt, und die im zentralen und westlichen Europa bis zum wirtschaftlichen Aufschwung im 11. und 12. Jahrhundert dauern wird, bricht jedoch nicht schlagartig mit der Übernahme der Macht durch germanische Nachfolgestaaten über den Okkzident herein. Zudem gilt es auch, den östlichen Mittelmeerraum von dieser Betrachtung auszunehmen, kann doch dort Byzanz noch fast ein Jahrtausend lang seine Machtstellung behalten und für eine gewisse Kontinuität auf wirtschaftlichem Gebiet sorgen.

Die großen Änderungen im Westen hingegen haben nicht hauptsächlich mit der Errichtung der germanischen Nachfolgestaaten zu tun. Zu machtlos war der Kaiser schon lange zuvor. Vielmehr sind es andere Ereignisse, sind es die Entwicklungen die zwei neue Religionen mit sich bringen. Einerseits erfolgt eine gesellschaftliche Durchdringung des Römertums durch den christlichen Glauben (der insbesondere auch dafür verantwortlich ist, dass Byzanz nicht Nachfolger des antiken Roms, sondern eben etwas gänzlich anders ist, nämlich ein christlichen Kaisertum.)
Das Mittelmeer bleibt auch nach dem Untergang Westroms die wesentliche Handelsachse aller mediteranen Völkerschaften, verbindet den Westen, die weiterhin existierenden Städte, in denen nach wie vor Händler tä- tig sind, und deren Organisationsstrukturen die neuen Herrscher weiterbenützen, mit den großen Zentren des Ostens, Byzanz, Antiochia, Antiochia, und darüber hinaus mit den Ländern des Ostens. Absatzmärkte bleiben bestehen, das (Wirtschafts-)Leben geht zumindest südlich der Alpen in eingeschränktem Umfang sei- nen Lauf, haben doch auch die Nachfolger der Kaiser ein Interesse an florierendem Handel und florierender Wirtschaft, um mit Hilfe der erwirtschafteten Erträge einen aufwendigen Lebensstil und den Erwerb von Lux- uswaren zu finanzieren.
Der große wirtschaftliche Einbruch geschieht erst mit den Erobungsfeldzügen der Araber, die vom 7. Jahr- hundert an in rascher Folge die Länder an der Südküste des Mittelmeeres unter ihre Herrschaft bringen und nach der Niederwerfung des spanischen Westgotenreiches sogar in Europa Fuß fassen können. Von nun an stehen sich zwei Religionen unversöhnlich gegenüber. Mit ihren Basen auf Sardinien, Korsika und in Sizilien erringen die Araber die vollständige Seeherrschaft über das westliche Mittelmeerbecken. Jahrhunderte alte Handelsbeziehungen erlöschen, die Absatzmärkte für den internationalen Handel gehen verloren, maurische Piraten treiben ihr Unwesen entlang Italiens und Frankreichs, sogar am St. Bernhard berauben arabische Plünderer die Durchziehenden. Zeigen Quellen aus der Zeit der Merowinger noch das Vorhandensein eines Kaufmannstandes in den Städten (wenn auch bereits in reduziertem Ausmaß), dann verschwindet diese Be- rufsgruppe im Westen für die nächsten Jahrhunderten fast vollständig. Diese Durchtrennung der wirtschaft- lichen Lebensader durch den Sturm des Islam zeigt sich auch darin, dass der römische Goldsolidus, der auch von den germanischen Nachfolgestaaten Roms als Währung weiterverwendet wurde, unter den Karolingern durch den Silberdenarius abgelöst werden musste.
Der (wirtschaftlich schwächere) Norden war vorerst bevorzugt. Noch war der Handel entlang der großen Flußmündungen, über Nord- und Ostsee bis England möglich. Doch bald schon tauchten die ersten skandi- navischen Langboote auf und heerten und brandschatzten weit ins Binnenland hinauf, brachten auch hier den Warenverkehr zum Erliegen. Das fränkische Reich, eine Kontinentalmacht ohne Mittel zur See, war diesen Anstürmen hilflos ausgesetzt. Und den Osten, in welche Richtung die Donau eine natürliche Handelsstraße hätte bilden können, sperrten Avaren, dann die einfallenden Ungarn.
In Ermangelung eines nennewerten Handels, bedingt durch das Fehlen von Absatzmärkten bzw. durch das Fehlen von Geld, wurde Europa auf ein Naturalwirtschaftssystem zurückgeworfen, in dem die Gemeinschaften vordergründig die eigenen Bedürfnisse zu decken hatten, ob diese nun in Nahrung, Kleidung oder notwendi- gen Werkzeuge bestanden. Die Produkte, die man aus der Landwirtschaft erwirtschaften konnte, mussten für das Leben reichen. Landbesitz wurde darum der Schlüssel zur Herrschaft, die Städte fielen mit wenigen Aus- nahmen in die (relative) Bedeutungslosigkeit zurück, als Bischofssitze verwendet, jedoch nicht als Handelsum- schlagsplätze und Zentren des Handwerks, die mehr als den lokalen Bedarf zu decken hatten. Die zahlreichen Märkte besaßen meist nur Lokalcharakter.
Wer kein Land besaß, war ein Leibeigener, der Hintersasse eines Herren, dem er seine Arbeit zur Verfügung stellen musste, der eine eigen Hufe zugeteilt bekam, und dies mit Abgaben und Arbeitsleistungen auf dem herrschaftlichen Land zu entgelten hatte und der der der Rechtsprechung des Herrn unterlag. Noch war man weit entfernt, vom wirtschaftlichen Neuaufschwung der Stadt - Stadtluft machte eben noch nicht frei, da die frühmittelalterlichen Städte Zuwanderern keine wirtschaftliche Basis bieten konnten. All die aufgezählten Gründe - aber noch manch andere, etwa die negative Einstellung der Kirche gegenüber Handel und Gewinn - bewirkten nun die Umwandlung vom Weltreich Rom mit seinen Millionenstädten und den riesigen, von Sklaven bewirtschafteten Latifundien zum mittelalterlichen Feudalwesen.
Wie nun dieses auf Grundbesitz basierende Wirtschaftssytem funktionierte, darüber sollen demnächst wei- tere Artikel Auskunft geben ...
Weiter zum zweiten Teil der Artikelserie.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Stadtentwicklung

Mittelalterliche Städte - Teil 2: Gründungsstädte und gewachsene Städte
Zurück zum ersten Teil der Artikelserie über mittelalterliche Stadtentwicklung.
In der Fortsetzung unserer kleinen Artikelserie über die mittelalterliche Stadt wollen wir uns heute der Frage widmen, wie diese Städte entstanden beziehungsweise wo deren Ursprünge lagen, wobei sich unsere Be- trachtung auf den deutschsprachigen Raum beschränken soll. Dabei werden wir eine Unterscheidung zwi- schen 'natürlich gewachsenen Städten' und sogenannten Gründungsstädten treffen, wohl wissend, dass solche Begriffe weniger über die tatsächliche Gestaltung einer jeweiligen Siedlung auszusagen vermögen als man dies gemeinhin annehmen würde. Schließlich nahmen Neugründungen häufig auf bereits zuvor beste- hende Strukturen Rücksicht. Andererseits unterlagen gewachsene Städte im Laufe ihrer Geschichte öfter als man dies vermuten würde gänzlicher oder teilweiser Neuplanung und systematischer Umgestaltung.
Wie kann man sich die natürlich gewachsene Stadt entstanden denken? Nun, einerseits gab es noch die Überreste der römischen Stadtkultur. Zwar kam es auch in den Städten, die nach dem Untergang der rö- mischen Herrschaft nicht völlig aufgegeben werden mussten, zu einem starken Rückgang der Bevölkerung, der so massiv ausfallen konnte, das zumeist große Areale der römischen Siedlung verwaisten. Allenfalls blieben noch Teile besiedelt und in Betrieb, speziell dort, wo es sich um Bischofssitze handelte, dazwischen lagen Gebiete brach beziehungsweise wurden sie als Weiden und Anbaugebiete betrachtet. Vielfach erfolgte die Fortführung des (eingeschränkten) städtischen Lebens an den Rändern der alten römischen Städte be- ziehungsweise wurden die brachliegenden Gebiete erst nach und nach wieder aufgesiedelt, von den Bevöl- kerungszuwächsen im hohen Mitelalter profitierend.
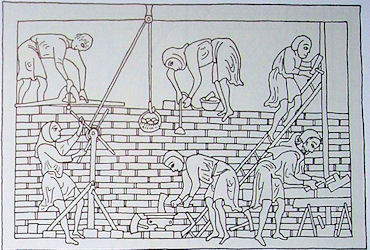
Obwohl in merowingischer Zeit keine neuen Städte entstanden, sondern im Gegenteil viele aufgegeben wer- den mussten oder eben der Bedeutungslosigkeit anheimfielen, hatten die damaligen Herrscher doch ein ge- wisses Interesse daran, einige dieser ehemaligen Zentren am Leben zu erhalten: einerseits um die dortigen Verwaltungsstrukturen für die eigene Herrschaft nutzen zu können, andererseits um durch Märkte und Han- del Einnahmen zu lukrieren (wenn auch die frühmittelalterliche Wirtschaft haupsächlich auf Naturalien beruh- te). Solche Handelszentren bildeten gewisse Sammelpunkte für Handwerker und Handelstreibende, die sich hier ansiedelten.
Ebenso bestand für solche Berufsgruppen eine gewisse Anziehungskraft sich in dörflicher Umgebung nieder- zulassen, in denen Märkte abgehalten wurden. Häufig entstanden solche Siedlungen in geographisch günstig gelegener Position, um einen Kristallisationspunkt herum. Dies konnte ein Kloster sein, eine Burg, ein Wirt- schaftshof. Charakteristisch für solche Siedlungen war es, dass sie ihre späteren Stadtrechte zumeist müh- sam gegen den jeweiligen Stadtherren erkämpfen mussten, dessen Bestrebungen natürlich dahin gingen, Stadt und Bürger unter seiner Botmäßigkeit zu behalten.
Von einer Gründungsstadt spricht man hingegen dann, wenn ein gewollter Gründungsakt, dem ein Gründ- ungsdatum zugeordnet werden kann, vorliegt. Die Initiative für eine derartige Neugründung ging dabei stets vom Stadtherrn aus, eienem weltlichen oder geistlichen Würdenträger, nicht von den späteren Bewohnern. Um ausreichend Anreiz für Zuzügler zu schaffen, die neue Stadt zu beleben, wurden häufig bereits bei der Gründung selbst weitreichende Rechte für die Bürgerschaft vergeben ('Stadtluft macht frei', etc.)
Manchmal lag diesen Städten ein geometrisch konzipierter, regelmäßiger Grundriss zugrunde. Häufiger finden sich aber auch in diesen Gründungen unregelmäßige Straßenverläufe, sodass man nicht ohne weiteres davon sprechen kann, dass eine jede Neugründung als Planungsstadt anzusehen ist. Vermutlich steckte man das Straßenraster meist nach einer nur groben Vermessung ab und passte es den örtlichen Gegebenheiten an. Vielfach erfolgte eine Geländenivellierung um Unebenheiten des Geländes auszugleichen oder Umleitungen von Bächen für die wirtschaftliche Nutzung (Mühlen, Hammerwerke, während etwa die geruchsintensiven Gerbereien zumeist vor die Stadtmauern verbannt wurden) und die Wasserversorgung vorzunehmen. Meist geschah dies allerdngs erst Jahrzehnte nach dem eigentlichen Gründungsakt. Interessant ist auch die Tat- sache, dass selbst jene Städte, die mit rechteckigem Straßensystem erbaut wurden, meist von einer runden Stadtmauer umgeben waren.
Unter einer Planstadt versteht man die tatsächlich durchgeplante Stadt, die nach bestimmten Gesichtspunk- ten errichtet wurde. Eine solche Planstadt konnte auch durch die Umgestaltung bereits bestehender Siedlun- gen entstehen, wenn etwa ganze Stadtbezirke durch Abbruch oder nach Brandkatastrophen und anschließ- endem Neubau neu errichtet wurden. Dabei gab es durchaus lokale Unterschiede und Gepflogenheiten. Häufiger als den streng rechteckigen Straßenverlauf findet man dabei etwa in süddeutschen Städten die Ausrichtung an einer Hauptachse in Form der langgestreckten, breiten Marktstraße (wie sie auch in älteren Städten römischen Ursprungs nachträglich angelegt wurden), während etwa in vielen norddeutschen Plan- städten ein großer rechteckförmiger Marktplatz das Stadtzentrum inmitten eines rechtwinkeligen Straßen- netzes bildet.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Stadtentwicklung

Mittelalterliche Städte - Teil 1: Frühe Entwicklungen
Nennt man das Stichwort Mittelalter, dann fällt neben solchen Begriffen wie Burg und Ritterschaft, Kloster und Geistlichkeit, Kaiser und Papst schnell auch jenes der mittelalterlichen Stadt mit seinen Bürgern, Händlern, Zünften, Ratsherren und Bettlern. Insbesondere das Hochmittelalter ist geprägt vom Aufblühen der Städte, von der Emanzipierung vieler Kommunen von ihren ehemaligen geistlichen oder weltlichen Herren und von einer großen Gründungswelle, die erst im Spätmittelalter mit dem Einpruch der Pest und dem damit verbun- denen Bevölkerungsrückgang endete. Der Ausspruch 'Stadtluft macht frei' ist wohlbekannt und geht auf die damalige Zeit zurück, in der städtegründende Landesfürsten ihre Neugründungen vornehmlich aus wirt- schaftlichen Gründen beleben mochten.
Jedenfalls kam mit der Stadt und dem immer selbstbewusster auftretenden Bürgertum ein weiterer Macht- faktor neben den klassischen Gewalten Kaiser bzw. König, Adel und Geistlichkeit ins Spiel der Politik aber auch als Ort kultureller Entwicklung zum Tragen. Grund genug, sich hier einmal mit einigen Aspekten mittel- alterlicher Stadtentwicklung zu befassen - immer eingedenk der Tatsache, dass sich die wissenschftliche Forschung derzeit in einem steten Wandel und in anhaltenden Kontroversen darüber befindet, wenn es um Fragen geht wie etwa jene, ob Neugründungen nach einem einheitlichen Grundplan und gewissen geome- trischen Regeln entworfen wurden.

Es waren vor allem die ummauerten, von steinernen Bauten dominierten ehemals römischen Städte, in denen zu Beginn des Frühmittelalters eine gewisse Siedlungskontinuität fortbestand, wenn auch mit verringerter Be- völkerungsanzahl. Doch änderte sich in den deutschsprachigen Gebieten die Struktur der Stadt sehr schnell: Neben den alten Zentren entstanden neue - kirchliche und auch weltliche, Adelspaläste, königliche Pfalzen, oft an neuen Orten, sowohl im ehemals römischen Reichsgebiet als auch in den weiten Regionen jenseits von Donau und Rhein. Diese Siedlungen waren durch Ansammlungen von Adelshöfen, Niederlassungen von Kauf- leuten und große Marktareale gekennzeichnet. Anders als im Hochmittelalter, in dem, neben anderen Charak- teristica die möglichst eng geführte Ummauerung 'modern' wurde, war der frühmittelalterliche Siedlungsort oft durch einen größeren Siedlungsraum mit aufgelockerten Strukturen gekennzeichnet. Zwischen den Behaus- ungen war oftmals Platz für Wiesen, Weiden und Weingärten. Tatsächlich kam vielerorts der Bedarf nach einer Schutzbewehrung erst wieder in den Wirren der Normannen- und Ungarneinfälle während des 9. und 10. Jahrhundert zum Tragen.
Bereits während des 10. und 11 Jahrhunderts erhielten zahlreiche Orte königliche Markt-, Münz- und Zoll- rechte, die im späteren Hochmittelalter dann zu Städten erwuchsen. Von den frühmittelalterlichen städtischen Siedlungsformen ist auch aus dem Grund kaum etwas erhalten, da sich ab dem 12. Jahrhundert neue Vorstell- ungen darüber durchsetzten, wie eine Stadt zu gestalten sei und im Zuge dieses Wandels auch viele beste- hende Siedlungen umgestaltet wurden. Manchmal wurden allerdings auch einfach neue Städte in geringem Abstand zu bestehenden Siedlungen neugegründet, um Platz für modernere Strukturen zu schaffen.
Für die Entwicklung, die eine Stadt nehmen sollte, waren sowohl ihre Größe aber auch ihr Status von Bedeu- tung: Kleinstädte unterschieden sich von Dörfern durch das Vorhandensein von Stadtmauer und Infrastruk- tureinrichtungen, der Anzahl der vorhandenen Handwerks- und Gewerbebetriebe, gelangten aber kaum zu eigenständiger Bedeutung. Meist gehörten sie zu einer Burg oder zu einem Kloster, nicht immer besaßen sie eigenes Stadtrecht. Oftmals wuchsen im Laufe der Geschichte mehrere solche kleineren Siedlungen nach und nach zu einer einzigen Stadt zusammen (ein augenfälliges Beispiel dafür ist etwa Prag), was sich augenfällig immer noch im Vorhandensein von verschiedenen hauptplatzähnlichen Zentren zeigt.
Wie rasch und in welchem Ausmaß sich eine Stadt von ihrem Stadtherren, der in der Frühzeit stets dem welt- lichen Adel oder der hohen Geistlichkeit angehörte - wobei sich Lebensführung und Hofhaltung dieser hohen geistlichen Würdenträger kaum von jener der weltlichen Herren unterschied -, emanzipieren konnte, hing nicht zuletzt auch davon ab, wo dieser Herr residierte - in der Stadt selbst oder davon entfernt. Meist hatten sich die Städte ihre Rechte hart zu erkämpfen, nicht immer geschah dies gewaltlos (man denke an Köln oder Mainz), andererseits profitierte der Stadtherr von florierender Wirschaft und erfolgreichem Handel in Form hoher Abgaben - ein Umstand der über kurz oder lang zu Konflikten führen mussten. So sind die zahlreichen Italienfeldzüge von Friedrich Barbarossa nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass das Ausscheren der aufständischen oberitalischen Städte des Lombardischen Bundes ein großes Loch in die kaiserlichen Einnah- men riss.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Ikonographie

Ikonographie und Typologie - Teil 1
Dem Mittelalter verdanken wir eine Reihe von bemerkenswerten Kunstwerken, Plastiken, Fresken oder Buch- malereien, Kleinodien. Vielen dieser Darstellungen und Kunstschätzen gemeinsam ist, dass wir ihren Sinnge- halt nicht mehr oder nur schwer erfassen können. Zu verschieden sind die Denkwelten von einst und heute, zu unterschiedlich der Wissensstand von mittelalterlichem und modernen Menschen.
In unseren Artikeln, die sich mit der Bedeutung von Gesten und Gebärden in mittelalterlichen Abbildungen befassen, versuchten wir bereits diese angesprochenen Schwierigkeiten zu thematisieren. Wer kennt sie denn noch, die Bedeutung all jener Symbole die wir in der bildnerischen Kunst jener Zeit entdecken können? Deren Deutung durch den Umstand erschwert wird, dass der jeweilige Sinngehalt nicht ausschließlich durch das verwendete Symbol selbst bestimmt wird, sondern im bedeutenden Ausmaß auch vom Kontext, in dem es sich finden. Keine einfache Aufgabe also für jemanden, der Jahrhunderte später vor diesen Zeitzeugnis steht.

Von den Schwierigkeiten einer solchen Deutung, oder sollten wir besser sagen, von den Schwierigkeiten nur einer von mehreren möglichen Deutungen, will auch dieser Artikel handeln, zu dem wir als Anschauungsob- jekt das sogenannte 'Runenkästchen von Auzon', so benannt nach seinem Fundort an der Loire, heranziehen wollen. Diese bemerkenswerte Arbeit, auch als 'Franks Casket' bekannt, ein Schächtelchen, aus Walbein ge- fertigt und am Deckel und den vier Seitenteilen mit kunstvollen Schnitzereien versehen, wird (zum Großteil) im British Museum aufbewahrt und sorgt nach wie vor für intensive wissenschaftliche Diskussionen.
Ausgeführt sind auf dem Kästchen, dass im angelsächsischen Northumbria des 7. Jahrhunderts entstanden sein dürfte, nämlich Darstellungen, die Stoffe aus biblischer, römischer, germanischer und keltischer Tradition verbinden - eine bemerkenswerte Tatsache an und für sich, wenn man an eine Entstehung im klösterlichen Umfeld denkt. Noch verworrener wird die Angelegenheit durch die zusätzlichen, die Darstellungen umrahmen- den Runentexte, die zu den Abbildungen jedoch keinen direkten Zusammenhang zu haben scheinen.
Besonders interessant ist hierbei die Frontplatte (siehe die obige Abbildung), zeigt sie doch im Nebeneinan- der eine Szene biblischen Ursprungs - rechts, die drei Magier vor der Jungfrau Maria und dem Kind - und eine solche germanischer Herkunft - nämlich den am Hofe König Niduds gefangengehaltenen Schmied Wieland, wie er, unter seinen eingeknickten Füßen, Folge der grausam durchtrennten Sehnen, einen der enthaupteten Königssöhne, mit der Rechten der Königstochte den betäubenden Trank reicht, um ihr anschließend Gewalt anzutun und sie, als letzten - fast wörtlich zu nehmenden - Akt seiner furchtbaren Rache zu schwängern.
Nun sind es nicht nur die Details in beiden Darstellungen, welche die wissenschftlichen Diskussionen bis heute aufrecht erhalten - was hat es mit der zweiten Frau auf sich, was mit der Vogeldarstellung auf beiden Seiten, soll sie links auf die Fähigkeit des Schmiedes hinweisen, fliegend zu entwischen? Aber was hätte der Vogel zu Füßen der Jungfrau und des Kindes zu bedeuten? - sondern auch der umrahmende Runentext in älterem Futhark, erwähnt er doch die Darstellungen nicht, sondern spricht von dem Tier, aus dessen Bein das Kunstwerk gefertigt ist.
So sagt der Text: 'Walbein. Die Flut hob den Fisch auf den Berg. Das Ungeheuer wurde traurig, als es auf den Strand trieb.' Abgesehen davon, dass wir die Traurigkeit des Ungeheuers in der geschilderten Situation bes- tens nachvollziehen können, bleibt dieser Text, zumal im Zusammenspiel mit den umrahmten Szenen, ziemlich rätselhaft für uns. Was denn nun die Absichten des Künstlers waren, darüber gibt es viele Meinungen, ob diese nun eine christliche Deutung bevorzugen, typologisch oder über den Zusammenhang von Kunstfertig- keit und Glauben, als gottgeschenkte Gaben, oder ob die Abbildungen den Lebenslauf eines Kriegers von der Geburt bis zum Tode darstellen. Viel Spielraum für Interpretationen also und darum wird uns das Kästchen in nächster Zeit weiter beschäftigen ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Sitten und Gebräuche

Das mittelalterliches Bad - Teil 1
'...
Ains tages hett das selbig weib
den herren nach irs herzen gir
haim ze haus geladet zuo ir.
das geschach in dem maien
ain pad ward da den zwaien
beraitt in ainem zuber gros.
darein sas der herre plos
und mit im die frawe zart.
der zuber schon bedecket wart
mit ainem golter seidein,
das niemant sehen mocht hinein.
...'
(Auszug aus dem neunten Gedicht Heinrich Kaufringers, 'Chorherr und Schusterin')
Wer kennt sie nicht? Jene freizügigen mittelalterlichen Abbildungen in denen sich Mann und Frau scheinbar ungezwungen und bar aller Schamesgrenzen im Bade tummeln. Wenn überhaupt, dann nur spärlich beklei- det, geben sie sich dort bei Musikbegleitung diversen Freuden kulinarischer und vor allem erotischer Art hin, ergötzen sich nach dem Bade im Jungbrunnen, wenn nicht gerade im Minnegarten flaniert wird, an der rück- gewonnenen Vitalität der Jugend, welche an sehr eindeutigen Gesten und Taten demonstriert wird.
Gerade solche Abbildungen sind es unter anderen auch gewesen, an denen gewisse wissenschaftliche Krei- se, hier ist vordergründig an den Soziologen Norbert Elias und seine Schule zu denken, ihre Theorien vom zu- nehmenden Zivilisationsprozess unserer Gesellschaft zu untermauern suchten - nämlich dahingehend, dass jene mittelalterliche Gesellschaft als 'primitive' noch wesentlich geringere Schamesschranken kannte als der moderne Mensch und darum auch mit Themen wie Nacktheit und Erotik in der Öffentlichkeit bedeutend unge- zwungener umging. Ein Zustand, der später mit 'zunehmendem Zivilisationsgrad' durch die 'Weiterentwick- lung' des sittlichen Zusammenlebens beendet worden sein soll, wodurch wir nun an der Spitze aller Sittlich- keit stehen. Hmm ...

Klar, dass solche Ansichten auch Widersprüche hervorrufen mussten, die von einer oberflächlichen Interpre- tation bzw. von einer Fehlinterpretation der herangezogenen Bild- und Textquellen sprachen, wie etwa die einwände des Ethnologen Hans Peter Duerr un seinem vierbändigen Werk Der Mythos vom Zivilisationspro- zess. Nun sind wir sicherlich nicht mit einer solchen Kompetenz ausgestattet, um eine derartigen Streitfrage schlüssig aufzuklären, aber alleine diese Auseinandersetzung zeigt, dass sich der voyeristische Blick ins mittelalterliche Bad durchaus lohnen kann. Selbstverständlich nur im wissenschftlichen Interesse, warum denn auch sonst ... ?
Die diesem Artikel beigestellte und sehr bekannte burgundische Darstellung einer im wahrsten Sinn feucht- fröhlichen Badeszene mag vielleicht gleich dazu dienen, um ein kurzes Schlaglicht auf den Interpretations- spielraum zu werfen, denn derartige Abbildungen bieten: Während Elias hieraus ein Indiz für den äußerst freizügigen Umgang mit Nacktheit und den Umgang mit Sexualität in der Öffentlichkeit herzuleiten suchte - man beachte nur den gewagten Griff des weißbärtigen Alten an der hinteren Wand des Raumes oder das engumschlungene Paar im Nebenraum zur Linken - spricht Duerr davon, dass man im Bild nicht etwa die Vor- gänge in einem öffentlichen Bad vor sich hätte, sondern vielmehr ein Badebordell dargestellt wird, wie sie damals durchaus gebräuchlich waren, und somit die Darstellung keine Rückschlüsse auf das öffentliche Ver- halten zuließen. Diese Interpretation als Bordell ist wohl nicht gänzlich von der Hand zu weisen, wenn man denn das bereitstehnde Bett in der linken Kammer berücksichtigt ...
Nun, wir werden wohl die Diskussion nicht entscheiden können, schließlich lassen sich für jede Richtung ent- sprechend ausgesuchte Belege aus alten Aufzeichnungen und Schriften heranziehen. Interessant ist das Thema aber allemal und so wollen wir in nächster Zeit eben einige Blicke ins mittelalterliche Bad werfen, in die Badestuben, in die private Kemenate und in die Wildbäder. Dazu lassen wir die Schriftsteller zu Worte kom- men, wie oben den Heinrich Kaufringer, der in seinem Gedicht schildert wie eine Schusterin den begehrten Chorherren umgarnt, aber auch alte Verordnungen von Städten, in der Hoffnung, dass wir den Badeschaum, oh Verzeihung, damals waren es ehe noch Späne und Rosenblätter, etwas lichten können um einen klareren Blick zu gewinnen.
Ein Geheimnis ist mit dem heutigen Tag jedenfalls schon gelüftet - nämlich jenes, woher wir uns den Lautenspieler für das aktuelle Malprojekt ausgeborgt haben. Ein Ausflug in den Wald, weg vom schwülen Bade, wird ihm guttun ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Redensarten
und Handwerk

Alte Redensarten - Es schadet nicht, mehrere heiße Eisen im Feuer zu haben ...
Die alten Redensarten: Bemerkenswert oft ist in ihnen von Händen die Rede, von zwei linken, von jenen, die man ins Schoß legt, aber auch von Arbeiten, die im Handumdrehen erledigt werden, wenn man denn ein Händchen dafür hat. Die Hände sind eben Symbol für Arbeit und Fleiß oder für das Fehlen derselben. Die Arbeit, die man leistete, war ja über die längste Zeit menschlicher Entwicklung hinweg sprichwörtliches 'Hand- werk'.
Eine der ersten dieser Handwerkstechniken führt über 5000 Jahre in die Vergangenheit zurück, nach Ägypten, ins Zweistromland, nach Indien, in jene Zeiten und zu jenen Orten, an denen der Mensch das Formen der Metalle erlernte, Kupfer und Bronze zuerst, auch Gold und Silber, später dann, technologiesch aufwändiger, das Eisen.
Der Schmied, der solches bewältigte, war ob seiner Wichtigkeit bereits im Altertum und bei allen Kulturen hoch angesehen, sein Tun galt als geheimnisvoll und manchmal furchterregend. Nicht umsonst hatten auch die Olympier mit Hephaistos einen Schmied in ihren Reihen, der manches Wunderwerk hämmerte. Und den Germanen schuf Wieland, der Meister, der nicht dem Menschengeschlecht entstammte sondern dem der Riesen, Klingen, die nicht nur Rüstungen schnitten wie Butter, sondern auch durch Fleisch und Tisch zugleich. Verkrüppelt waren sie übrigens beide, der Olympier von Geburt an, Wieland durch König Nidungs Weisung dazu gemacht.
Klar, dass ein Beruf, der für das Leben und Tun der Menschen stets von großer Bedeutung war, von so groß- er, dass sich etwa im Laufe des Mittelalters aus der Tätigkeit des Schmiedes um die zwanzig Spezalberufe mit überwiegend eigenen Zünften herausbildeten, der Messer- und Klingenschmied, die Schwertfeger, Plattner, Panzer- und Helmschmiede, Nagelschmiede, usw., dass ein solcher Beruf, dessen Träger häufig in die Nähe zu magischen Praktiken gerückt wurden, auch eine Reihe von sprichwörtlichen Redensarten hervorgebracht hat.
So sollte man das Eisen schmieden, solange es heiß ist, immer noch, obwohl der Sinn nun ein anderer ist als dazumal. Jemanden das Eisen aus dem Feuer holen lassen, anstatt selbst zuzugreifen, kann immer noch klug sein, während ein heißes Eisen anzufassen damals wie heute nach Mut verlangt(e).
Und wie ist es nun damit, mehrere Eisen im Feuer zu haben? Nun, ein Teil der Kunstfertigkeit des Schmiedes beruht darauf, das Eisen stets bei richtiger Temperatur zu schmieden - viel Erfahrung ist von Nöten, um dies anhand der Farbe des Werrkstückes zu erkennen. Bis das Eisen nun fröhlich hellrot vor sich hinglüht, dauert es eine Weile, während das Material beim Schmieden selbst relativ rasch auskühlt. Dies würde lange Warte- zeiten mit sich bringen. Wenn nicht der umsichtige Schmied, der einiges weiterbringen möchte, stets mehrere Werkstücke im Feuer hat, von denen er jeweils eines bearbeitet, während die anderen gerade auf die erfor- derliche Temperatur erhitzt werden. So kann - erraten - im Handumdrehen von einem Stück auf das andere gewechselt werden.
Dieses vorausschauende Arbeiten erfordert wiederum eine Menge an Umsicht und Planung, damit keines der Werkstücke verkommt, Leerlaufzeiten verringern sich aber und die Produktivität und, wenn's denn gut ge- lingt, der Gewinn, steigen. Ebenso der Stressfaktor bei der Arbeit selbst (wovon ja auch alle Möchtegern- polygamisten ein Liedchen zu zwitschern wissen, die sich stets mehrere 'Eisen' warmhalten, tunlichst aber dafür Sorge zu tragen haben, dass sich diese nicht in die Quere kommen ...). Andererseits: Wozu hat man schon Gesellen, wenn nicht dazu, dass sie selbst das heiße Eisen aus der Esse ziehen - allerdings mit der Zange, die als charakteristisches Werkzeug des Schmiedeberufes nicht von ungefähr in vielen Zunftzeichen erscheint.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Redensarten
und Handwerk

Alte Redensarten - Wenn dir denn die letzten Felle davonschwimmen ...
Wem sind sie nicht auch begegnet, die sprichwörtlichen Redensarten. So häufig, dass man darüber schon mal in Harnisch geraten kann. Außer man hat soviel auf dem Kerbholz, dass man es sich nicht leisten kann, sein Gegenüber ob der sprachlichen Altertümlichkeiten in die Schranken zu weisen. Schließlich kommt niemand gerne unters Rad ...
Mit dem vorliegenden Artikel wollen wir nun eine kleine Serie starten, die sich in loser Folge mit der Herkunft einiger dieser vertrauten Redensarten befasst, Redensarten, von denen sehr viele ins Mittelalter zurückwei- sen. Natürlich - wie immer auf unserer Seite - geschieht dies in bewährter Form mit gehörigem Respekts- abstand zur wissenschaftlichen Faktizität, dafür umso begeisterter. Mögen diese kurzen Beiträge hilfreich sein, uns zu einem tieferen Verständnis - wovon auch immer - zu verhelfen.
Der Einstieg sei einem anrüchigen Gewerbe gewidmet (Aber halt - anrüchig? Handelt es sich dabei nicht auch schon wieder um einen derartigen Begriff? Klar doch, aber um den geht es diesmal nicht ...). Das mehr oder weniger idyllische Gerberhandwerk ist es, dem wir den aktuellen Beitrag zu verdanken haben.
Den Beruf selbst wollen wir allerdings vorerst noch außen vor lassen. Spätere Zeiten werden zeigen, ob die- ser Tätigkeit nicht ein eigener Artikel gewidmet werden soll. Schließlich verwendet die Menschheit seit .. seit ... hmm ... nun seit Menschengedenken eben Felle und Häute der erjagten Tiere für die Anfertigung von Kleidung, Schuhwerk und anderem Nützlichen mehr. Also stand bereits frühzeitig das Haltbarmachen dieser Materialien auf dem Aufgabenzettel unserer steinbewehrten Vorfahren. Man denkt, dass die ersten derarti- gen Techniken, das Einreiben der Häute mit Gerbstoffen, gute 10000 Jahre in die Vergangenheit zurückreich- en.
Im Laufe der Zeiten wurde das überdimensionale Jagdvieh seltener, die Gerbverfahren vielfältiger: Fettger- bung, Weißgerbung mit Alaun oder aber die in Europe sehr gebräuchliche Lohgerbung, bei der vorwiegend die gemahlene Rinde von Eichen und Erlen als Gerbstoff zum Einsatz kam. Allerdings war der Gerbvorgang ein sehr aufwändiger und teilweise arbeitsintensiver, dessen einzelne Arbeitsschritte sich über Monate hinweg- streckten.
Wasser spielte bei diesem Vorgang eine nicht unwesentliche Rolle und damit nähern wir uns auch schon der Artikelüberschrift. Einerseits zum Betreiben der sogenannten Lohmühlen, in denen die Lohe - die Baumrinde - zerkleinert wurde. Andererseits mussten die Häute gewässert und gereinigt werden. Dazu rammten die Ger- ber auch Pfähle in die fließenden Gewässer, an denen die Häute zum Wässern aufgehängt wurden. Die Ge- bühren, die eine Stadt von einem Gerber für die Wassernutzung erhob, richtete sich übrigens nach der Anzahl solcher Pfähle.
Zu diesem Zeitpunkt des Gerbvorganges war in die Häute schon eine Menge an Arbeit investiert worden (Ent- häuten, Entfleischung, Fettentfernung). Umso ärgerlicher, wenn durch Unachtsamkeit beim Waschen oder beim Wässern eine Haut, also ein Fell verlorenging. Man sah es dann buchstäblich davonschwimmen. Und wenn einem dann sogar noch die letzten Felle davonschwimmen, dann sieht's um das Geschäftsergebnis im kommenden Quartal nicht rosig aus. Lokale Wirtschaftskrise und Kurzarbeit wären wohl angesagt.
Nun, haben die meisten von uns ihre Lederjacken über Nacht nicht mehr im lauschig dahinrieselnden Bach hängen. Dennoch schwimmen uns nach wie vor die Felle davon, im übertragenen Sinne natürlich. Sollte dies nächstens wieder einmal der Fall sein, sollte die Angebetete nach unserer letzten Entgleisung mehr und mehr zum besten Freund, zum freundlichen alten Herrn nebenan oder zum Hamster im Käfig tendieren, dann können wir uns neuerdings zumindest damit trösten, die Herkunft jener Redensart, die diesen Vorgang beschreibt, erklären zu können. Und das ist ja auch schon eine ganze Menge ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Glaube und Religion
Engel

Mittelalterliche Engelsdarstellungen 4 - Raphael, Freund und Begleiter auf gefährlicher Reise ...
Zurück zum ersten, zum zweiten bzw. zum dritten Teil der Artikelserie über die Engel.
Mit Michael, dem Drachenkämpfer und Beschützer, mit Gabriel, dem Boten und Heilsbringer, sind uns bereits die beiden großen Erzengel begegnet. Doch neben dieser Zweiheit gibt es noch andere Engelsgruppen, wel- che jeweils die kleinere Gruppe mitenthalten. Die Engeldreiheit, die Vierheit, die den vier Weltenden vorsteht und sie bewacht beziehungsweise an den vier Seiten von Gottes Thron lobpreisen oder die Gruppe der feuer- flammendn Sieben, die allzeit vor Gott stehen und ihn preisen.
Bei den vier Engeln, die an den vier Seiten des Gottesthrons stehen, handelt es sich um die mächtigsten sei- ner Diener. Es sind dies Michael, Gabriel, Raphael und Uriel (letzterer manchmal auch als Phanuel benannt). Einem jeden von ihnen sind spezielle Aufgaben zugewiesen, Vieles aber gibt es auch, das ihnen gemeinsam übertragen ist, Aufgaben von besonderer Wichtigkeit. Gemeinsam bewachen sie die Tore des Lebens, halten also Aufsicht über Anfang und Ende, Geburt und Tod des Menschen. Aber auch das Gericht über Satan und die Seinen ist ihnen aufgetragen, wenn sie die aufrührerischen Engel in den Abgrund stürzen und sie dort bis endzeitlichen Gericht festhalten.

Raphael, dessen Name bedeutet 'Gott heilt', gilt als besonderer Freund der Menschen, der sich mehr als alle anderen Engeln zu den Sterblichen herabgelassen hat. Wie sein Name dies schon aussagt, besitzt er heilen- de Macht über alle Krankheiten und Wunden, die dem Menschen gesetzt sind. Dies umfasst sowohl Erkrank- ungen der Seele als auch solche des Leibes. Zudem preist er sowohl den Messias als auch die Auserwählten, deren Seelen sich bei ihm befinden. Wie die anderern Erzengel kann auch er die Aufgabe eines Seelengelei- ters übernehmen.
Doch nicht nur die Seelen der Verstorbenen geleitet er, nein, er kann auch zum Freund des Menschen direkt werden, wie dies im Buch Tobias der Bibel berichtet wird. Der alte Tobias nämlich, im assyrischen Exil stets gottesfürchtig und getreu des Gesetztes lebend, verliert durch widrige Umstände sein Augenlicht. In seiner Not bittet er Gott um Hilfe und entschließt sich seinen unerfahrenen Sohn, der ebenfalls den Namen Tobias trägt, zu einem Verwandten nach Persien zu schicken, da der ihm noch Silber aufbewahrt.
Zur selben Zeit bittet, weit entfernt, Sara, die Nichte Tobias, Gott um Hilfe vor dem Dämon Asmodi, der ihr nacheinander sieben Ehegatten in der Hochzeitsnacht tötet. Daraufhin wird Raphael von Gott ausgesandt, um den Notleidenden Hilfe zu bringen - Sara vom Dämon zu befreien, den alten Tobias von seiner Blindheit.
Dies geschieht, indem er in menschlicher Gestalt annimmt, unerkannt, den Jungen auf seiner weiten und ge- fährlichen Reise begleitet und ihn dort vor allen Gefahren bewahrt. Insbesondere wird auch ein magischer Fisch erlegt, dessen Innereien später den Bedrückten Rettung bringen werden. Mit Raphaels Hilfe wird der Dämon entmachtet und von ihm in der Wüste gebunden und Tobias heiratet seine Verwandte Sara. Während noch die Hochzeitsfeierlichkeiten andauern, besorgt Raphael auch das Silber.
Nach der glücklichen Rückkehr zu den Eltern, heilt schlussendlich Tobias noch des Vaters Blindheit mit Hilfe der aufbewahrten Galle des Fisches, wie ihm dies Raphael geraten hat. Erst dann gibt sich der Engel zu erkenn- en, als von Gott gesandt wegen der Bitten der Bedrückten und verschwindet anschließend.
Raphael tritt hier in vielfacher Rolle auf: Als Führer, Ratgeber, Freund, Heiler - sowohl des körperlichen Lei- dens der Blindheit als auch der Bedrückung durch den Dämonen. Aber Raphael heilt nicht nur Mensch und Umwelt, nein , er bekämpft auch das, was sich gegen Gott und Mensch wendet, bekämpft und besiegt auch den Dämonen.
In der Kunst findet sich Raphael, dem als Farbe Violett oder Grün zugeordnet sind, häufig in Gesellschaft an- derer Engel - sei dies nun zu Zweien, zur dritt - zu Besuch bei Abraham und seiner Frau - oder in der Engels- vierheit, an der westlichen Seite von Gottes Thron. Auch findet man ihn häufig zusammen mit dem jungen Tobias abgebildet, auf ihrer gemeinsamen Reise, wobei häufig die typischen Pilgerrequisiten Stab und Flasche auftauchen und, charakteristisch, der bemitleidenswerte Fisch, der als Mittel gegen alle Leiden herhalten muss ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Glaube und Religion
Engel

Mittelalterliche Engelsdarstellungen 3 - Gabriel, himmlischer Bote und Lebenserwecker ...
Zurück zum ersten bzw. zum zweiten Teil der Artikelserie über die Engel.
Gilt der Erzengel Michael als Engel des Westens, Kämpfer gegen die Dunkelheit und den Drachen und somit als Engel des Lebensendes, des Todes, der die Seelen geleitet und sie beim Gericht der Wägung unterwirft, so ist Gabriel der Verkünderengel, der Engel des werdenden Lebens, der aus dem Osten stammt, von dort, wo die Morgendämmerung die Sonne des neuen Tages ankündigt. Seinen wohl bekanntesten Auftritt hat er, dessen Namen 'Kraft Gottes bedeutet, als er Maria die Geburt des Heiland ankündigt, doch ist es nicht die einzige Gelegenheit, bei der er weissagend in Erscheinung tritt.
Als Engel der Geburt und allen Anfangs ist ihm in den Kirchen der Ostchor zugeordnet, jene Seite, der das Morgenlicht zuströmt, während Michael im Westen residiert, dem Abend entgegen, als Verteidiger gegen die Finsternis. Die beiden großen Erzengel repräsentieren Anfang und Ende, was auch durch die Ansetzung ihrer Feste im Kirchenjahr seinen Ausdruck findet: Jenes von Gabriel wurde auf den 24. März gesetzt, ein Datum, zu dem die Natur zum Frühling und zu neuem Leben erwacht. Michaels Fest hingegen ist am 29. September, in der Nähe des Herbstbeginnes, dann, wenn das Jahr zu sterben beginnt. Beginn der Fruchtbarkeit und Fruchternte, so sind beide Erzengel Hüter der Schwelle, des Ein- und des Ausganges des Lebens.

Während Michael, dem Herrn der Nacht und des Winters das kühle Blau entspricht, ist Gabriels Symbolfarbe das feurige Rot. Er ist demnach der Engel des Feuers und der Hitze, der Sommerhitze, in der die Früchte rei- fen. Als Hüter des Paradieses, als 'Beherrscher der Kräfte', steht er auch den Feuerengeln vor, den Seraphim, die dort ihren Wachdienst tun, ebenso den Thronengeln der Cherubin. Diese feurige Wesenheit kommt auch in seiner Erscheinung zum Ausdruck, wenn er etwa im Buch Daniel geschildert wird:
'Da stand ein Mann, in Linnen gekleidet und die Lenden mit Gold von Ophir gegürtet. Sein Leib war wie Chry- solith, und sein Antlitz leuchtete wie Blitzesschein; seine Augen brannten wie feurige Fackeln, seine Arme und Beine funkelten wie poliertes Erz, und der Schall seiner Worte war wie das Tosen einer großen Menge Volkes.'
Seit frühester Zeit werden Gabriel und Michael in der christlichen Literatur und in der Kunst gerne zusammen dargestellt, als Engelszweiheit aber auch in größeren Gruppen. Ursprünglich galten sie beide als die obersten Führer der Engelsscharen, ein Amt, das in späterer Zeit aber gänzlich auf Michael, den Drachenkämpfer über- geht. Schließlich sind ihre Aufgaben aufeinander bezogen, ergänzen sich zu einem abgerundeten Ganzen, da sie die Spanne von der Geburt bis zum Tode umfassen.
Gabriel ist nicht nur der Engel der Ankündigung, sondern auch jener der Zeugung und der Geburt, der alles Werdende und Wachsende beschirmt und hegt. Auf geheimnisvolle Weise ist er dem Zeugungsakt zugeord- net. So weiß eine jüdische Überlieferung zu berichten, dass er 'zu Häupten eines jeden zeugenden Paar stehe', wo er dem neugeschaffenen Leben das Bild Gottes einprägt. Er ist somit der Träger und Vermittler der göttlichen Zeugungskräfte, Kraft derer Maria, die Jungfrau, ihr Kind empfängt. Durchaus kein einmaliger Akt, diese unkörperliche Zeugung, denn wenn wir uns der griechischm Mythen entsinnen, konnte für eine Zeugung dort schon mal Goldregen ausreichen ...
Als göttlicher Bote erinnert er uns schließlich auch an den griechischen Hermes, der zwar nicht geflügelt, aber immerhin mit Flügelschuhen versehen, stets getreu seinen Dienst tat und manchesmal, wiederum nicht un- ähnlich den christlichen Engeln, den Menschen zu Hilfe eilte. Man denke nur an den Besuch des Odysseus bei der Kirke. Die Flügel übrigens sind ein Attribut, das die Engel nicht auf allen Darstellungen aufweisen, sondern das sich erst im Laufe des Frühmittelalters herauskristallisierte - wohl ein Mittel, um sie als Wesen des Äthers und der himmlischen Höhen zu kennzeichnen.
Bleiben wir noch bei der Verkündigung. Gabriel ist auch der Mond zugeordnet. In den mediterranen Kulturen des Altertums ist unser Himmelstrabant stets ein Symbol für die weibliche Seite. Logisch, dass Gabriel damit auch der Engel ist, der für die Frauen und ihre Belange - zumindest nach damaligen Verständnis - zuständig ist. Somit ist er es, der die Worte: 'Gegrüßet seist du, Maria!' spricht. Dabei tritt er, in der überwiegenden Mehrzahl der Abbildungen, von links an Maria heran, die in älteren Darstellungen zumeist Wasser holt oder spinnt, später - im Hochmittelalter - betet, noch später dann liest. Symbolisch interessant: Links ist die Seite, die für gewöhnlich dem dem Gefühl und dem Weiblichen, dem Inneren und Verborgenen zugeordnet ist, während die rechte Seite der Außenwelt entspricht. Gabriel erscheint somit aus der verborgenen Welt Gottes in die Welt hinein, zu Maria.
Interessantes haben auch die Attribute in diesen Darstellungen auszusagen. Ursprünglich, in den ältesten Darstellungen, noch ohne diese unterwegs, werden die Erzengel später mit Botenstäben ausgerüstet. Später wird dieser Stab dann zum Lilienstab umgewandelt, mit einem Zwischenschritt über die Lebensrute, den Dreilapp, der ein Symbol für den Baum des Lebens darstellt. Der Lilienstab selbst trägt, zumindest bis zum Hochmittelalter zumeist drei Blüten, von denen die erste vollständig geöffnet, die zweite sich gerade entfaltet und die dritte noch geschlossen ist: ein Symbol für die heilige Dreifaltigkeit, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist.
Später ging diese Symbolik dann damit verloren, dass der Stab von immer mehr Blüten überwuchert wurde und diese Lilienblüten sich schließlich in einer Vase vor Maria wiederfanden - wobei die Vase in der Kunst wie- derum für die Weiblichkeit stand. Manchmal waren es auch Maiglöckchen, die diesen Platz einnahmen. Hier sei noch einmal erwähnt, dass die Lilie nicht immer den späteren Nimbus der Reinheit und Geistigkeit besaßen, sondern dass ihre Aussehen und ihr Duft in älteren Zeiten durchaus auch Assoziationen zu Liebeslust und Zeugung erweckten - durchaus passend zur Ankündigungssequenz. Hier sei auf den Artikel über die Lilie ver- wiesen.) Erst das hohe Mittelalter begann diesen Aspekt mehr und mehr zu verdrängen ...
Weiter zum vierten Teil der Artikelserie über die Engel.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Glaube und Religion
Engel

Mittelalterliche Engelsdarstellungen 2 - Michael, Drachenkämpfer, Heiler und Seelengeleiter ...
Zum ersten Teil der Artikelserie über die Engel.
Nach christlicher und jüdischer Tradition ist der Erzengel Michael der Erste und Oberste aller Engel. Er ist der Vertraute Gottes und sozusagen oberster Schlüsselwalter des Himmelreiches. Niemand kann es betreten, ohne zuvor durch Michael geprüft zu werden. Sein Name bedeutet 'wer ist wie Gott' und er ist der oberste Heerführer der guten Engel im Kampf wider den Satan und seine Heerscharen. Ein ziemlich verantwortungs- voller Posten also, den er da auszufüllen hat. Doch mit den aufgezählten Funktionen ist es lange noch nicht getan, und so darf es nicht verwundern, dass Michael in christlichen Kunstdarstellungen häufig anzutreffen ist.
Als Erster in der Engelshierarchie gehört er selbstverständlich dem innersten Engelskreis an, bildet zusammen mit Gabriel, Raphael und Uriel (der Name des vierten Erzengels differiert manchmal) jenes Engelsquadrat, das Gottes Thron bewacht, zudem aber auch als Hüter der vier Weltecken gilt. Zugleich mit diesen Aufgaben er- füllt er als Gottesbote und Bote des Gotessohnes, so wie seine Kollegen, die Aufträge des Herrn. Erinnerun- gen an den griechischen Götterboten Hermes drängen sich hierbei geradezu auf. Diese oben erwähnten Eigenschaften finden sich in Darstellungen wieder, die Michael mit Botenstab und kreuzbekrönter Weltkugel darstellen. Der Stab deutet auf seine Funktion als Herold, die Weltkugel auf jene als Hüter und Heiler der Welt.

Seine Auftritte in der Bibel sind zahlreich, so ist er es, der Adam und Eva aus dem Paradies vertreibt, und er ist der Engel der Gerechtigkeit, der die Vergehen jener Völkerengel aufzeichnet, die über die 70 Völker der Erde gesetzt sind. Selbst aber steht er dem jüdischen Volk vor, das er in die endzeitliche Erlösung führen soll.
Als Heerführer und Bannerträger der himmlischen Heerscharen hat er einst Luzifers Horden besiegt und aus dem Himmel zur Erde geschleudert, der Kämpfer gegen den teuflischen Drachen. (Ja auch die gibt es in anderen Religionen, wackere Kämpfer gegen den chaotischen Urdrachen!) Klar, dass einem so versierten Kämpfer Vorbildwirkung zukommt und manch christliches Heer unter seinem Banner in die Schlacht zog - so etwa Otto gegen die ungarischen Scharen am Lechfeld - oder sich im Verlaufe hitziger Gefechte plötzlich gar vom Erzengel unterstützt sah. Zumindest dann, wenn es gegen die Heiden ging ...
Interessanterweise sind diesem großen Kriegerfürsten aber noch ganz andere Bereiche zugeordnet. Er gilt, oder galt, denn dieser Aspekt seines Wirkens ist etwas in Vergessenheit geraten, nicht nur als Verteidiger gegen das Böse, sondern auch als jener, der die Wunden heilen kann, welche die Welt durch das Wirken Satans und der Dämonen erlitten hat. So finden sich in älterer Zeit zahlreiche Michaelsheiligtümer, in denen der Erzengel angerufen wurde und in denen Wunderheilungen passiert sein sollen: das berühmte Choane in Kleinasien, als ältestes, das apulische Monte Gargano oder der großartige Mount Saint-Michel in der Norman- die - um nur einige besonders prominente zu nennen.
Um die Entstehung dieser heiligen Orte ranken sich, wie dies für solch bedeutsame Stätten ja geradezu Pflicht ist, allesamt Legenden. Die zeigen, dass der streitbare Erzengel seine Anforderungen auch gegen Heilige Männer sehr nachdrücklich vertreten konnte. So soll Michael im Jahre 708 dem Bischof Aubert von Avranches im Traume erschienen sein, um ihn zum Bau einer Kapelle auf der ehemalig keltischen Grabinsel 'Mons tumba' zu drängen. Nachdem der geistliche Heer nicht sofort willfährig war, musste der Engel seine nächtlichen Traumbesuche noch zweimal wiederholen, ehe der gute Bischof überzeugt war - übrigens soll dabei eine Kopfwunde eindringlich nachgeholfen haben, die er als Andenken von Michaels letztem Besuch davontrug. Selber schuld, kann man da nur sagen. Und seien wir ehrlich, wir sind doch nachträglich alle ganz ganz froh über diese Kopfnuss, die uns den Mont Saint-Michel beschert hat ...
Als Bewahrer gegen Krankheiten und Heiler derselben galt Michael vor allem auch als christlicher Schutzbe- auftragter gegen die Pest. Dies wird auch ersichtlich aus einer weiteren jener zahlreichen Anekdoten, die sich in der Kirchengeschichte finden: Als nämlich wieder einmal die Pest in Rom wütete und nicht erlöschen wollte, zog Papst Gregor der Große mit Klerikern und Volk betend und flehend durch die Straßen. Als die Bußprozes- sion am Grabmal Hadrains vorüberkam, wurde dort oben Michael gesichtet, wie er gerade sein Schwert in die Scheide zurücksteckte - ein sicheres Zeichen für die bevorstehende Erlösung von dem Übel. Seitdem trägt das Mausoleum des römischen Kaisers den Namen Engelsburg.
Seit dem 12. Jahrhundert finden sich auch Darstellungen, die Michael mit einer Waage zeigen, der Seelenwaa- ge, in der beim Jüngsten Gericht die Seele des Menschen gewogen und - hoffentlich - für gut befunden wird. Diese Darstellungen erinnern stark an Abbildungen in altägyptischen Gräbern und Papyri, die jenes Totenge- richt, vor allem die Seelenwaage, in anderer Besetzung zwar ganz ähnlich thematisiert hatten. Die Stelle der krokodilsartigen Ammit nehmen in den christlichen Darstellungen nun Teufel ein, welche die Seele in den Ab- grund ziehen möchten und die dabei mancherlei Tricks anwenden. Glücklicherweise steht Michael dem armen Sünder zur Seite indem er die Dämonen abwehrt und von der Waage vertreibt. Hier zeigt sich die Rolle des Erzengels als Richter aber auch als Geleiter und Beschützer der Seelen, die auch in einem alten liturgischen Text, der sogenannten Totenmesse, ersichtlich wird:
'Herr Jesus Christus, König der Herrlichkeit, befreie die Seelen aller verstorbenen Gläubigen von den Peinen der Unterwelt; bewahre sie vor dem tiefen Wasser und vor dem Rachen des Löwen, danit der Abgrund sie nicht verschlinge und sie nicht in Finsternis hinabstürzen. Vielmehr geleite sie der Bannerträger Michael in das heilige Licht.'
Aus diesem Text wird die Vorstellung ersichtlich, dass die menschliche Seele nach dem Tode Schutzes durch den Engel bedarf, weil sie andernfalls verloren ist. Wiederum erinnert dies an Glaubensvorstellungen anderer Religionen, in denen die Seele des Verstorbenen gleichfalls großen Gefahren ausgesetzt ist.
Die Zugehörigkeit Michaels zum Tode zeigt sich auch in der Positionierung von sogenannten Michaelskapellen in oder zwischen den Türmen von Kathedralen und Kirchen, wie sie bis in die Barockzeit üblich waren. So ist das Westwerk der romanischen Dome üblicherweise Michael geweiht, ist doch der Westen jene Himmelsrich- tung, in die hinein die untergehende Sonne verschwindet. Von dort, von Sonnenuntergang und der Nacht her, suchen auch die dämonischen Scharen hereinzudringen und dort ist somit auch Michaels Platz im Kampfe. Aber auch das mittelalterliche Volk wusste von dem engen Zusammenhang zwischen Michael und dem Tod, wie die Bezeichnung der Totenbahre als 'St. Michaels Ross' zeigt ...
Weiter zum dritten Teil der Artikelserie über die Engel.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Glaube und Religion
Engel

Mittelalterliche Engelsdarstellungen 1 - Im Himmel gibt's manch Unverständliches ...
Besichtige eine romanische Kirche, bewundere die Skulpturen eines gotischen Doms, bestaune uralte Fenster mit ihren bunten Gläsern und du wirst sie dort ebenso finden wie in Gemälden und Fresken. Und auch aus spätantiken und mittelalterlichen Texten werden sie dir entgegentreten, sei es nun aus den Schriften eines Dionysius Areopagita, des Bischofs von Alexandrien, oder im Paradiso der Divina Comedia des Dante Alighieri. Von der Bibel und altjüdischen Überlieferungen ganz zu schweigen ...
Die Rede ist hier von den Erstgeborenen, den aus göttlichem Licht vor der eigentlichen Schöpfung erschaffen- en Wesen - den Engeln. Nun kann man mittelalterliche beziehungsweise Kunstwerke ganz allgemein zweifels- ohne auf sich einwirken lassen, ohne allzuviel über symbolische Hintergründe Bescheid zu wissen, ohne Attri- bute und Gesten deuten zu wollen. Denn die Schönheit dieser Werke vermag uns auch so anzusprechen. Dennoch, oft fragt man sich, wie die Menschen vergangener Zeitalter derartige Darstellungen, wie sie ihnen beim Kirchgang vor Augen kamen, zu deuten wussten. Vieles an Wissen darüber, wenn nicht fast alles, ist dem modernen Menschen verlorengegangen. Schade eigentlich, denn so können wir zwar noch den ästhet- ischen Reiz verspüren, können staunen, doch die tiefere Sinndimension derartiger Werke ist uns verlorenge- gangen.

Man braucht dazu gar nicht erst die Tiefenpsychologie heranzuziehen, mit ihren Schlagworten von den Urbil- dern der menschlichen Seele und dergleichen mehr, wie sie sich in Märchen, Mythen und Kunstwerken immer wieder finden, wie sie sich immer wieder den Weg an die Oberfläche der Bewusstheit bahnen, um Interesse an der Deutung solcher Darstellungen finden. Wer hat sich denn, unter dem Fresko einer Basilika stehend, nicht schon einmal gefragt, was die Augen auf den Flügeln jener vier-, sechs- oder achtfach geflügelten Engel- wesen bedeuten, die den Thron Christi oder Gottes selbst umstehen. Und wozu, so vielleicht die Frage aus unschuldigem Kindermunde, brauchen diese Engel, die doch ohnehin soviele Flügel besitzen, noch Räder un- ter den Füßen?
Was sind eigentlich Erzengel? Was sind 'normale' Engel? Was Thronengel? Und was gar die geheimnisvollen Seraphim und Cherubim? Warum werden die Boten Gottes manchmal mit manchmal ohne Flügel dargestellt? Belche Bedeutungen hat die Weltkugel, der Botenstab in den Händen eines solchen Lichten? Wer sind die beiden Urengel? Engeldreiheit, Vierheit, die Gruppe der 'Sieben' ... alles Darstellungsformen, die sich in Abbil- dungen und Darstellungen finden. Klar, dass da auch eine Portion an Zahlenmystik mitspielt, Wissen von der Bedeutung der Zahlen, von der wir heute ebenfalls nur noch wenig Ahnung hegen ...
Was hat es damit auf sich, dass dem Erzengel Michael, dem Führer der himmlischen Heerscharen der West- chor der Kathedralen zugeordnet ist, während Gabriel, ja genau jener, der Maria den Gottessohn ankündigte, im Ostchor residiert? Dunkel ahnen wir es, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass das neue Licht des Tages im Osten erscheint, die Nacht jedoch nach dem Versinken der Sonne hinter dem westlichen Horizont herein- bricht.
Welche Vorbilder sind es, die auf das Bild des christlich-jüdischen Engels eingewirkt haben? Wie haben all die assyrischen Kerube, die zahlreichen geflügelten griechischen Daimonen Einfluss genommen. Da gibt es den Götterboten Hermes, mit ganz ähnlichem Berufsbild, wie es die Engel der Bibel ausfüllen, da führen etrusk- ische Flügelwesen Seelen in die Unterwelt ...
Solcherlei Zusammenhänge, Bedeutungen und mehr haben wir uns aufgemacht zu erkunden - sei es nun aus den Bänden unserer Bibliothek, die zahlreiches Bildmaterial dazu bietet, sei es auch in eigener Anschauung, wenn uns unsere verfügbare Zeit Besichtigungen erlaubt. Dabei mögen wir, so unser Wunsch, auch manches über Symbolik erfahren, das uns helfen kann, mittelalterliche Darstellungen besser zu verstehen. Manches, leider zu Weniges, über die Bedeutung der Attribute, die sich da zeigen, findet sich schon an anderer Stelle dieser unserer Seite. Doch soll unsere Beschäftigung mit dem Thema der himmlischen Heerscharen in nächs- ter Zeit zu einigen Artikeln an dieser Stelle führen - über die Engelshierarchien selbst, über manch Kunstwerk und deren Deutung und somit über die Deutung mittelalterlicher Symbolik selbst. So es euch genehm ist, mögt ihr die Ergebnisse dieser Erkundigungen hier mitverfolgen ...
Weiter zum zweiten Teil der Artikelserie über die Engel.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Höfisches Leben
Das Hoffest

Das Fest bei Hofe, Teil 3 - Der emsigen Helferlein gar viele ...
Zum ersten und zum zweiten Teil der Artikelserie.
Um ein Fest auszurichten, wurde viele Helfer benötigt. Schließlich galt es im Vorfeld, rechtzeitig alle Besorgun- gen zu erledigen, Fleisch, Wild Fisch, Obst und Gemüse, erlesene Gewürze und standesgemäße Geschenke zu organisieren. Menüpläne und Sitzordnungen zu erstellen, ausreichend und qualifiziertes Personal für die Küche zu besorgen. Kunde vom bevorstehenden Ereignis an die Gäste auszusenden, Spielleute und Gaukler einzuladen. Schauspiele und Aufführungen, mit denen man die Hofgesellschaft beim Mahl zu unterhalten ge- dachte, einzustudieren, die dazu benötigten Kulissen zu erstellen, und, und, und ...
Aber auch beim Fest selbst hatten sich Heerscharen von Dienern und Bediensteten, Knappen und Pagen, wohlgetane Mägde, sowie die Inhaber solch gewichtiger Hofämter wie jenes des Truchsessen um einen rei- bungsloseen Ablauf sowie das leibliche Wohl der Gäste zu kümmern. Diesen emsigen Helferlein, von denen manche im Festsaal selbst ihren Dienst zu verrichten hatten, andere hingegen ihr Scherflein hinter den Kulis- sen beitrugen, soll der vorliegende Beitrag gewidmet sein. Wohl wird es sich nur um eine summarische und somit oberflächliche Aufzählung handeln, aber wir hoffen, dass auch eine solche ein Bild dafür vermitteln kann, welch ungeheurer Aufwand für Festveranstaltungen hoher Herren betrieben wurde.

Anbei sei bemerkt, dass der Gastgeber wohl mehr als nur einige Scherflein (also Münzen geringen Wertes) für die Ausrichtung eines solchen Ereignisses springen lassen musste. Immerhin mag sich unser Mitgefühl ob die- ses Umstandes dennoch in Grenzen halten, konnten doch Landesfürsten gewisse Sonderbelastungen, wie sie etwa die Vermählung einer Tochter mit all den anfallenden Aufwendungen und dem unvermeidlichem Hochzeitsfest darstellte, immerhin mit einer speziellen Steuer abdecken, die allen braven Landesbürgern auf- gebrummt wurde. Und seien wir einmal ehrlich: Eine Hochzeitssteuer ist immer noch besser angelegt als eine Steuer zur Finanzierung des nächsten Kriegszuges ...
Will man sich nun einen Überblick darüber verschaffen, welche Aufgaben am Hofe im Vorfeld und während eines Festes selbst anfielen, dann bleibt uns einerseits der Blick auf zeitgenössische Quellen, sei es nun der höfische Roman oder aber Abbildungen und Bildquellen aus mittelalterlichen Werken. Wie immer, wenn man solche Quellen zu Rate zieht, muss man sich vor Augen halten, dass es sich um künstlerische Äußerungen handelt, die ihren eigenen Wirklichkeitsanspruch haben. Nicht immer entsprach das Dargestellte der Realität, vielfach wurde damit ein Idealbild postuliert.
In der Krone weiß Heinrich von dem Türlin vom feierlichen Einzug der Dienerschaft zu berichten, von zwanzig Kämmerern an der Spitze, alles Edelknappen, die Becken und Hantücher für die Handwaschung brachten. Dahinter folgten zahlreiche Diener mit Kerzen, die damals Luxusartikel darstellten, um damit den Saal gebüh- rend zu erleuchten. Natürlich durften die Musiker und auch Sänger nicht fehlen, denen es oblag, die Festge- sellschaft zu unterhalten.
Danach folgten, sicherlich schon sehnsüchtig erwartet, vorerst die Schenken mit Weinkannen und anschließ- end die Truchsessen, die in langer Reihe das Essen auftrugen. Stets gilt bei Erwähnung der diversen Ämter zu beachten, dass es dabei Abstufungen gab, dass also etwa ein oberster Kämmerer die Aufsicht über alle untergeordneten Kämmerer innehatte. So führte der oberste Truchsess auch die Aufsicht über die korrekte Sitzordnung und die Einhaltung der Speisefolge. Bei besonders wichtigen Ereignissen konnte es schon vor- kommen, dass Angehörige des hohen Adels selbst die Rolle der Hofämter übernahmen und etwa den König bedienten.
Doch zurück zur Krone Heinrichs und zur Literatur: Dort finden sich auch Speisemeister und Vorschneider er- wähnt, deren Aufgabe darin bestand, die aufgetragenen Speisen vor den Gästen am Tisch in essgerechte Stücke zu zerteilen, so dass man ohne Besteck das Auslangen finden konnte. Wolfram lässt im Parzival währ- end des Festmahles vierhundert Knappen die vierhundert Ritter der Gralsburg Munsalvaesche bedienen. Je- dem der Tische, an denen jeweils vier Ritter speisten, waren vier Knappen zugeordnet, von denen zwei kni- end die Speisen vorschnitten, während die beiden anderen Speisen und Getränke auftrugen und die Ritter bedienten.
Neben den literarischen finden sich aber vereinzelt auch historische Quellen, welche einen genaueren Blick auf die Organisation eines fürstlichen Haushaltes und damit auch auf die Aufgabenverteilung im Rahmen der Vorbereitung und eines Festes selbst erlauben. Als Beispiel sei hier das Verzeichnis der Ämter des gräflichen Hofes von Hennegau erwähnt, das im frühen 13. Jahrhundert verfasst wurde und in dem alle hennegauischen Hofämter aufgezählt sind - mitsamt den Namen jener Personen, welche die angeführten Ämter zum Zeitpunkt der Abfassung innehatten.
An der Spitze dieser Hoforganisation findet sich der 'oberste Truchsess', gefolgt vom 'obersten Kämmerer' und vom 'obersten Schenken', sowie dem 'zweithöchsten Truchsess'. Die weiteren angeführten Ämter stehen fast alle mit der Lebensmittelversorgung und der Bedienung der gräflichen Tafel im Zusammenhang.
Aufgezählt werden etwa ein 'Einkäufer und Aufseher der Küchenvorräte', mehrere Köche, eine Schenkin samt zweier Stellvertreter, die ihr zu assistieren hatten, wenn sie eigenhändig den Wein (dessen Beschaffung ebenfalls in ihren Zuständigkeitsbereich fiel) vor den fürstlichen Herrschaften kredenzte. Ein weiterer Amts- inhaber hatte die Aufgabe für die geeignete Aufbewahrung des Weins in Fässern zu sorgen und diesen beim Feste in die Trinkgefäße zu füllen. Zwei Diener waren für dafür abgestellt, Wein und Trinkgefäße der Schenkin in den Saal zuzutragen.
Eine 'Hofmeisterin' musste darauf achten, dass das benötigte Brot an den Hof gebracht wurde; entweder vom 'Hofbäcker' oder von Brothändlern. Aufgabenteilung und Spezialistentum stand schon damals hoch im Kurs, denn für die Aufbewahrung des Brotes und der Tischtücher zeichnete wiederum eine andere Person verant- wortlich, ebenso für das Aufstellen der Tische und Auftragen der Brote.
'Türhüter', 'Pförtner', sowie zwei Unterkämmerer, welche die Aufgabe von Gaderobepersonals innehatten, nämlich die Übernahme von Umhängen und Hüten, finden sich in dieser Aufzeichnung ebenso wie Zuständi- ge für die Kerzenherstellung, Töpfer, zuständig für die Herstellung der benötigten irdenen Gefäßen, ein Ver- antwortlicher für die Schinkenaufbewahrung, ein besonderer Vertrauter, dem die Obhut über den Keller- schlüssel anvertraut war, ein Eintreiber für die Abgaben aus den gräflichen Gütern.
Daneben wird es wohl einer ganze Menge an zusätzlichem Hilfspersonal benötigt haben, Knechten und Mäg- den, um ein solches Fest zu schaukeln. Jedenfalls lässt sich aus der angeführten Aufzählung bereits erken- nen, dass der Aufwand, der betrieben wurde, ein immens großer gewesen sein muss. Schließlich galt es, den eigenen Stand und Reichtum ins rechte Bild zu rücken ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Höfisches Leben
Das Hoffest

Das Fest bei Hofe, Teil 2 - Die Sitzordnung, ein Spiegel der gesellschaftlichen Stellung ...
Zum ersten Teil der Artikelserie.
Die Organisation eines standesgerechten Festes stellte eine große Herausforderung für den Gastgeber und seinen Hofstaat dar. Dies nicht in finanzieller Hinsicht, galt es doch das Feinste vom Feinsten aufzuwarten und freimütig Geschenke zu verteilen, sondern natürlich auch in logistischer-organisatorischer. Zahlreich war- en die Probleme die es zu lösen galt, beginnend von der Beschaffung der benötigten Lebens- und Genussmit- tel und der rechtzeitigen Einstellung einer ausreichenden Anzahl von erfahrenen Köchen, über die Erstellung der Gästeliste und die rechtzeitige Aussendung der Einladungen, die Beschaffung einer ausreichenden Anzahl von geeigneten Geschenken usw.
Eine dieser Herausforderungen - und gewiss nicht die geringste - bestand in der Erstellung einer akkzeptab- len Sitzordnung. Dazu muss man einerseits wissen, wie die Gäste eines solchen Festes in der Festhalle oder, wenn das Wetter es zuließ und die Teilnehmeranzahl es erforderte, im Freien, positioniert werden konnten. Andererseits ist zu betonen, dass das Ansehen und die Bedeutung eines jeden Gastes, beziehungsweise die Wertschätzung, die ihm der Gastgebers zollte, ganz klar in der Position die ihm an der Tafel zugewiesen wur- de, zum Ausdruck kam. Ein Beobachter eines derartigen Festes hätte also allein aus der Sitzposition eines Gastes auf dessen Bedeutung schließen können.

Erst einemal gilt die Frage zu klären, wer denn eigentlich eingeladen wurde. Vereinfacht gesagt, könnte man dies so ausdrücken: Jeder, der für den Gastgeber von Bedeutung war, ob er sich nun auf der Lehenspyramide oberhalb oder unterhalb desselben befand. Vorzugsweise Personen von hohem Ansehen, weil deren Anwe- senheit die eigene Reputation erhöhen konnte - ähnliches gibt es ja auch heutzutage noch zu beobachten, etwa wenn sich betuchte Herrschaften bei diversen Bällen mit Gaststars schmücken. Natürlich konnten sich auch Gäste finden, die aus diesem oder jenem Grund die Wertschätzung des Gastgebers besaßen, etwa der vielgelobte Turnierritter oder der allseits bekannte Minnedichter. Schlimm jedenfalls war es für einen Herrn oder auch Dame, wenn ein derartiges Fest anstand, jedoch keine Einladung in den heimischen Turm flatterte. Weil man gerade in Privatfehde mit dem Ausrichter war oder - schlimmer - offensichtlich für eine Einladung als zu gering empfunden wurde. Manche Herrschaften konnten dies schon einmal als persönliche Beleidigung auffasssen; man denke nur an die Reaktion der 13. Fee, die zu Dornröschens Geburtstagsfeier ausgeladen blieb.
War einmal die Gästeliste erstellt, galt es, das sehr kniffelige Problem der Sitzordnung zu lösen. Allgemein galt: Je näher beim Gastgeber ein Gast saß, desto höher wurde er von diesem geehrt. Leicht zu bewerkstel- ligen, wenn man nur einen Hochgestellten zu ehren hatte, der mit seiner Anwesenheit samt seinem Anhang Fest und Gastgeber ehrte. Was aber tun, wenn mehrere Herren von vergleichbarem gesellschftlichem Stand am Hofe weilten und die Bevorzugung des Einen durch Zuweisung des Ehrenplatzes automatisch die Minder- schätzung des Anderen zum Ausdruck brachte? Oder wenn man unbedingt zwei Adelige einladen musste, die sich gegenseitig nicht ausstehen konnten und verfeindet waren? Wohin mit ihnen, ohne sie nebeneinander zu setzen und ohne des einen Stolz dadurch zu verletzen, dass man ihn nachreihte.
Wie sah denn nun eigentlich die Sitzordnung bei einem höfischen Fest aus? Die kurze Antwort lautet: Die konnte völlig unterschiedlich sein. Meist gab es eine lange Tafel, auf deren einer Seite die Gäste, genauer die ranghöchsten Gäste, mit dem Gastgeber saßen und von deren anderer Seite Pagen oder Ritter bedienten. Die Tafel war dabei so ausgerichtet, dass die Speisenden freien Ausblick auf einen freien Raum vor ihnen oder auf ein Podium hatten, wo Aufführungen von Künstlern, Musikern, Gauklern, ... Kurzweile verbreiteten. Der Gast- geber saß dabei häufig zentral an dieser Tafel. Dann waren die Ehrenplätze rechts und links an seiner Seite zu finden. Je weiter entfernt man sich an dieser Tafel vom Gastgeber befand, umso tiefer stand man in der gesellschaftlichen Rangordnung. Allerdings konnte der Gastgeber auch an einem Kopf dieser Tafel residier- en, dann war eben das gegenüberliegende Kopfende Ehrenplatz. Ebenso finden sich vereinzelt Abbildungen, auf denen sich die Gäste an der Tafel gegenübersitzend dargestellt sind.
Bei Festen mit größerer Teilnehmeranzahl konnten nicht alle Anwesenden an der großen Tafel untergebracht werden. Dann wurden zusätzliche Tische in Front vor dieser Tafel aufgebockt, an denen die überzähligen Gäs- te untergebracht waren. Auch dort gab es wieder Tische, die sich näher beim gastgebenden Fürsten befan- den und solche die weiter entfernt waren. In der Nähe saß, wer höher geachtet war. Man muss sich dies in aller Deutlichkeit vorstellen: In einer Gesellschaft, die sehr stark durch Äußerlichkeiten bestimmt wurde, kam der Stand beziehungsweise das Ansehen jedes Gastes durch seine Sitzposition ganz klar zum Ansehen. Wer aber mit einem Sitz an den hinteren Tischen vorlieb nehmen musste, der hatte nicht nur die Gewissheit einer gewissen Minderschätzung, die jedem Anwesenden ersichtlich war, sondern der musste manches Mal durch- aus auch mit ganz unmittelbar-konkreten Nachteilen beim Fest selbst rechnen. Denn nicht immer wurden alle Gäste mit Speisen der selben Qualität bedacht. Da konnte es durchaus vorkommen, dass an den 'billigsten Plätzen' saurer Wein kredenzt und minderwertiges Fleisch serviert wurde. Wie man sieht, waren die Anreize für einen jungen ritterlichen Adeligen groß, sich möglichst rasch Ruhm und Ansehen zu verschaffen, denn nur dann konnte er vorrücken.
Diese Situation der Positionierung nach gesellschaftlicher Stellung und Bedeutung birgt verständlicherweise Zündstoff für Konflikte. Wahrscheinlich war es ja gerade der Wunsch solche Konflikte zu vermeiden, die Merlin veranlassten, seinem König Artus zu einer runden Tafel zu raten, an der jeder der tapferen Ritter von gleich- em Range wäre, da es ja dort nun keine ausgezeichneten Plätz mehr gäbe.
Allerdings finden sich speziell in der höfischen Literatur auch alternative Sitzordnungen. Etwa die, dass durch- gehend auf kleinen Tischen gespeist wird, dass der König alleine mit seiner Familie an einem solchen Tische speist, dass er mit dem Ehrengast gemeinsam dort speist, dass die Damen in eigenen Räumlichkeiten ihr Mahl einnehmen, dass sie auf eigenen Tischen speisen, dass sie im Gegenteil den Mittelpunkt des Festes darstel- len (Was sonst, wenn nicht die Damen!) und paarweise mit jeweils ihrem Lieblingsritter (und Liebhaber - man ist da nicht immer so streng mit den Sitten ...) tafeln, dass Damen und Herren sich abwechseln, ...
Jedenfalls war es für den Gastgeber wichtig, bereits bei der Erstellung der Gästeliste auch eine Sitzordnung festzulegen, um Streitereien zu vemeiden. Zumindest bei Festbeginn musste diese stehen und die Inhaber des Truchsessenamtes, die für den reibungslosen Festablauf zuständig waren, hatten dann dafür zu sorgen, dass die hohen Herrschaften ihre zugewiesenen Plätze auch tatsächlich einnahmen. Ob das in jedem Fall eine dankbare Aufgab war, bleibe an dieser Stelle dahingestellt.
Nicht immer verlief die Positionierung der Gäste konfliktlos. So finden sich in der zeitgenössischen Romanliter- atur Beschreibungen derartige Rangstreitigkeiten bei Tisch. Und Ottokar von der Gaal weiß in seiner steiri- schen Reimchronik sogar von einer tatsächlichen derartigen Begebenheit zu berichten. Als nämlich die deut- schen Fürsten 1298 nach Nürnberg kamen, um dem neuen König, Albrecht I., zu huldigen, galt es beim an- schließenden Fest viele hohe Herren geeignet zu positionieren. Ausgerechnet zwischen den Erzbischöfen von Köln und Mainz kam es zu einem bitterbösen und gänzlich unchristlichen Streit um den Ehrenplatz zur Rechten des Königs, der darin gipfelte, dass der Kölner dem Mainzer ein Entscheidung im Zweikampf antrug. Wie man sieht, musste man sich damals auch als Adeliger sein Essen manchmal erst hart verdienen ...
Wie nun das Festmahl selbst ablief, wenn erst einmal alle Gäste friedlich auf ihren Pätzen saßen, darüber mögt ihr dann in den nächsten Folgen mehr erfahren ...
Weiter zum dritten Teil der Artikelserie.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Höfisches Leben
Das Hoffest

Das Fest bei Hofe, Teil 1 - Die Bedeutung des Festes für das adelige Selbstverständnis
Wenn man von einer Adeligenkultur des Mittelalters spricht, dann fällt die Sucht - oder vielleicht sollte man besser sagen, der Zwang - der Mitglieder der ritterlichen Oberschicht danach auf, den Stand durch solch Äuß- erlichkeiten wie ausgewählt wertvolle Kleidung, Freigebigkeit und Mäzenatentum zur Schau zu stellen. Die so- ziale Stellung innerhalb des Beziehungsgeflechtes der herrschenden Schicht ergibt sich durch das Ansehen, das man unter Seinesgleichen genießt und, eng damit verbunden, durch den Reichtum, der es ermöglicht, die geforderte Freigebigkeit zur Schau zu stellen. Und sich dadurch des Lobes der Sänger und Liteaten ebenso sicher sein zu dürfen, wie der abhängigen Vasallen.
Das Fest am Hofe stellt zweifelsohne eine weitere Möglichkeit zur Repräsentation der eigenen sozialen Stell- ung dar: Je reicher und aufwändiger ein derartiges Ereignis ausfällt, je höhergestellt die geladenen Gäste sind, umso höher sind Ansehen und somit auch die Stellung des ausrichtenden Herrn. Als auffälligstes Beispiel für ein derartiges prachtvolles Fest im deutschsprachigen Raum mag jenes vielbesungene Pfingstfest gelten, das Kaiser Friedrich Barbarossa anlässlich der Schwertleite seiner Söhne während des Hoftages zu Mainz ausrichten ließ. Noch lange danach wird die Pracht, werden die zahllosen ritterlichen Gäste und die Attrakti- onen, die es während dieses Ereignisses zu bestaunen gab, in der zeitgenössischen Literatur bewundernd und als nachahmenswert geschildert.

Wiewohl dieses Fest nun, ob seiner Größe und Bedeutung, sicherlich ein Ausnahmeereignis darstellte, lassen sich doch gewisse charakteristische Merkmale erkennen, die allen derartigen Ereignissen mehr oder minder gemeinsam waren. Oder die man zumindest in Ansätzen zu realisieren gedachte. Auf Festen feierte der Adel gemeinsam, hier trug man die feine Kleidung zur Schau, demonstrierte die Höfischkeit, hier wurde Identitäts- bildung betrieben. In der mit diesem Beitrag beginnenden Artikelserie über das höfische Fest soll nun ver- sucht werden, einige Aspekte dieser für das adelige Selbstverständnis so wichtigen Ereignisse zu besprech- en.
Das höfische Fest, das sich üblicherweise über mehrere Tage (und Nächte ;-) erstreckte, umfasste eine ganze Reihe von unterschiedlichen, jedoch zusammengehörigen Aspekten. Da wären zu nennen: der religiöse, wurden solche Ereignisse doch häufig an hohen kirchlichen Feiertagen anberaumt (da obgenannte Hoffest Friedrichs I. mag ebenso als Beispiel dafür dienen wie die berühmten Pfingstfeste am Hofe des König Artus, an denen mit schöner Regelmäßigkeit eine Aventiure ihren Ausgang nimmt ...), der politische, schließlich bot ein solches Treffen den anwesenden bedeutenden Herren und Vasallen die Möglichkeit gewisse Angelegen- heiten zu regeln, Verbindungen zu fixieren, Frieden zu stiften, der sportlich kriegerische, gehörte doch das ritterliche Turnier mit zum festen Bestandteil des bedeutenden Festes, der sinn- und identitätsstiftende, bil- dete doch das gemeinsame Mahl, der Turnierkampf, die Rezeption von Minnelyrik und höfischen Erzählungen einen Rahmen, innerhalb dessen man sich der ritterlichen Gemeinschaft zugehörig fühlte, egal ob nun als Kaiser oder als Ministeriale.
Dennoch gab es Unterschiede. Unterschiede, die sich durch die soziale Stellung innerhalb dieser ritterlichen Gemeinschaft ergaben, durch Reichtum und politischen Einfluss. Dies kann sich darin äußern, dass man sich als hochgestellter Herr eine eigene unterstützende Turniertruppe, bestehend aus erfahrenen Kämpfern leis- tet, oder als armer, fahrender Ritter, der nicht mehr als Rüstung, Waffen und Pferd besitzt, versuchen muss, in einer solchen Truppe unterzukommen. Das zeigt sich auch in der Tischordnung beim abendlichen Festmahl, am Platz, den man im Festsaal zugewiesen bekommt, sei dies nun auf einem Ehrensitz in der Nähe des Gast- gebers oder ganz unten an einem der entfernten Tische. Nicht zuletzt zeigt sich das dann auch an der Quali- tät der Geschenke, die zum Ende des Festes hin den Festgeladenen überreicht werden - und die von ihnen auch erwartet werden.
Wie man sieht, war die Ausrichtung eines derartigen Ereignisses eine kostspielige Angelegenheit. Zumindest dann, wenn man als Gastgeber versuchte die Erwartungen der geladenen Gäste aber auch die der zahlreich anwesenden Fahrenden, der Gaukler und Musiker, der Sänger zu befriedigen. Zwangen hingegen knappe Kassen oder angeborener Sparsamkeitssinn des Gastgebers, gemeinhin als tadelnswerte Eigenschaft des Geizes geschimpft, dazu, allzuviele Einschränkungen in Kauf zu nehmen, dann war diesem schlechte Nachre- de sicher. Nachrede, die in Form literarischer Schelte manches Mal sogar die Jahrhunderte überdauerte und das nur, weil man das Geldsäckel allzu sorgsam verschlossen hielt..
In den nächsten Folgen dieser Reihe über das höfische Fest werden nun einige Aspekte dieses Ereignisses zur Sprache kommen. Sollte euch die Thematik interessieren, so seid ihr eingeladen. Zwar nicht zu einem höfischen Fest selbst (dazu sind unsere Schatztruhen leider nicht voll genug), aber immerhin dazu, über solche zu lesen ...
Weiter zum zweiten Teil der Artikelserie.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Höfisches Leben
Das Turnier

Das ritterliche Turnier, Teil 3 - Auf der Jagd nach Ruhm und sozialem Aufstieg
Zum ersten und zum zweiten Teil der Artikelserie.
Im Laufe des 12. Jahrhunderts erfuhr die Turnierpraxis wesentliche Veränderungen. Unter den Teilnehmern der immer mehr an Popularität gewinnenden Turnierveranstaltungen war die Mehrzahl unverheiratet und ver- gleichsweise jungen Alters. Verständlich, wenn man einerseits die Risiken bedenkt, die man mit der Teilnahme an derartig gefährlichen Betätigungen einging. Andererseits bot gerade das Turnier den jungen, nach Aner- kennung und weltlichem Reichtum strebenden Rittern ein ideales Betätigungsfeld.
Aus den Chroniken jener Zeit lassen sich zwei unterschiedliche 'Laufbahnen' herauslesen. Da ist einmal jene des reichen und gutversorgten Erben, der die Zeit zwischen Schwertleite und Antritt des väterlichen Erbes beziehungsweise der standesgemäßen Heirat dazu benützt, um sich Ruhm und Ansehen zu erwerben. Dass er dies mit der besten Ausrüstung und einer erfahrenen Truppe von unterstützenden Kämpen bewerkstelligt, versteht sich von selbst.

So weiß etwa die Chronik, die Giselbert von Mons in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts dem jungen Grafen Balduin von Flandern gewidmet hat, von einem Turnier bei Soissons zu berichten. Balduin begibt sich laut seinem Chronisten mit einer gewaltigen Truppe von angeblich 200 Rittern und 1200 Knechten samt unüberschaubarem Tross zu diesem Ereignis. Ein gewaltiger Aufwand, den sich zu jenen Zeiten wohl nur wenige Auserwählte leisten konnten. Denn es gilt ja nicht nur die eigene Ausrüstung auf bestem Stand zu halten, sondern auch die Gefolgsleute durch gebührende Geschenke bei Laune zu halten. Vor allem dann, wenn es sich um erprobte Turnierkämpfer handelt.
Man hört in zeitgenössischen Berichten immer wieder davon, wie erfolgreiche Turnierkämpfer von den reichen Herren geradezu umworben werden, die mit hohen Summengeboten und ehrenvollen Geschenken versuchen, die Besten der Besten für ihre Turniermannschaft zu gewinnen. Umgekehrt bedeutet die Aufnahme in eine er- folgreiche Mannschaft für jeden Ritter ein erstrebenswertes Ziel, steigen doch dadurch die Chancen auf Ge- winn und Geschenke aus der Hand des zufriedenen obersten Herrn.
Frappierend erinnert die Situation dieser Ritter an jene der erfolgreichsten Fussballspieler der Gegenwart, die von den renommierten Vereinen umworben werden und dort auch horrende Summen lukrieren können. Als Anreiz dürfen heute - wie auch dazumal - vermutlich sowohl die finanziellen Lockungen als auch das Prestige gelten, es in eine solche Mannschaft geschafft zu haben.
Und gerade in dieser Situation liegt auch die Chance für junge, mehr oder weniger mittellose Ritter: Denn durch herausragende Leistung beim Turnier kann man auf sich aufmerksam machen, kann sich in den Blick- punkt eines solchen Herrn bringen. Guillaume le Maréchal, den sein Chronist später als 'den besten aller Ritter' bezeichnen wird, ist in seinen Jugendtagen ein derartiger Abenteurer, der durch Heldentaten im Kampf aber auch bei Turnieren einen unaufhaltsamen Aufstieg erlebt.
Als Begleiter und Berater des königlich englischen Prinzen Heinrich II nimmt er über mehrere Jahre hinweg mit diesem an zahlreichen Turnieren in Frankreich teil. Ein Zerwürfnis zwingt ihn schließlich, sich in die Dienste des flandrischen Grafen zu stellen, doch wird ihm der Stellenwechsel mit einer ahnsehnlichen jährlichen Entlohn- ung versusst. Ganz abgesehen von all dem Reichtum, den er sich durch die bei vielen Turnieren erbeuteten Pferde und Rüstungen und all dem Lösegeld seiner besiegten Gegner gemacht hat.
Umgekehrt konnten dieses Risiko, nämlich Pferd, Waffen und Rüstung beim Turnier einsetzen, und der Zwang, großzügig Geschenke machen zu müssen, zur Verarmung manch eines Herrn führen. Dann nämlich, wenn ihn die Turniersucht gepackt und er sich dabei nur mäßig erfolgreich zeigte. Da konnte es schon vorkommen, dass die laufenden Ausgaben die jährlichen Einkünfte aus dem heimischen Besitztümern bei weitem überstieg.
Denn schließlich zeigte sich die gesamte adelige Oberschicht vom Turniervirus angesteckt. Und wenn wir manch Berichte von den strahlenden Siegern kennen, dann muss uns doch klar sein, dass es stets auch eine größer Zahl an weniger Erfolgreichen und Besegten gegeben hat. Jedenfalls führte die zunehmende Popu- larität nach und nach dazu, dass die Abläufe bei solchen Veranstaltungen zunehmend standardisiert erfolgten und sich schließlich gewisse Gebräuche und Regeln zu entwickeln begannen, welche den Ablauf der Turniere gleichzeitig auch veränderten. Darüber soll aber dann in einer späteren Folge mehr berichtet werden ...
Weiter zum vierten Teil der Artikelserie
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Höfisches Leben
Das Turnier

Das ritterliche Turnier, Teil 2 - Turnei und Buhurt
Zum ersten Teil der Artikelserie
Die Frühform des ritterlichen Kampfspieles ähnelte, wie im ersten Teil der Artikelserie bereits beschrieben, sehr stark der wirklichen Reiterschlacht im Kriege; so wurde durchaus noch mit scharfen Waffen und voller Rüstung gekämpft. Nur die vorhandenen Ruhezonen und der Verzicht auf die Tötung des Gegners waren erste Schritte, um den Ernst einer solchen Auseinandersetzung abzumildern.
Wie hat man sich nun eine derartige Turnei, aus dem Begriff entwickelte sich später unsere Bezeichnung Turnier, vorzustellen? Tatsächlich findet man in den zeitgenössischen, uns erhaltenen Turnierbeschreibun- gen weniger Konkretes als man vorerst vermuten möchte. Ähnlich, wie dies in den Sportreportagen unserer Zeit üblich ist, hielten es auch die mittelalterlichen Korrespondenten nicht für notwendig, die genauen Regeln des Kampfspiels festzuhalten. Klar, waren diese doch dem damaligen Zielpublikum ohnedies bestens bekannt und somit für eine schriftliche Fixierung uninteressant - eine Problematik, wie sie uns häufig auch bei mittelal- terlichen (Brett-)spielen entgegentritt, wodurch uns die exakten Spielregeln unbekannt bleiben müssen.

Dennoch lässt sich natürlich Einiges erschließen; sei dies nun aus aus Abbildungen oder aber auch aus der zeitgenössischen Literatur, warum denn auch an dieser Stelle eine Lanze für die Lektüre mittelhochdeutscher Werke gebrochen werden soll ... Wie also, dürfen wir uns den Ablauf solcher Auseinandersetzungen ausma- len?
Beim eigentlichen Turnier wurden zwei Gruppen von Rittern gebildet, diese mögen schon jeweils 50 bis 100 Mann stark gewesen sein, die aufeinander losstürmten. In der Frühzeit waren meist offene Flächen, Felder oder Wiesen, in der Nähe von Burgen gelegen, die Austragungsorte, da spezielle Turnierplätze als solche noch nicht existierten. Dabei fehlten auch die späteren räumlichen Begrenzungen, sodass ein solches Treffen rasch in eine Reihe von Einzelauseinandersetzungen zerfallen konnte, die dann über ein weites Gelände verstreut stattfanden.
Die Kunst des Turnierkämpfers bestand nun nicht nur darin, Waffen und Ross in der direkten Auseinander- setzung virtuos zu beherrschen, sondern auch im wechselseitigen Angriff und Zurückweichen, Vortäuschen von Flucht und überraschendem Kehrtmachen und Übergehen in den Angriff. Da galt es auch, möglichst den Überblick über das Kampfgeschehen zu behalten, um bedrängten Kämpfern der eigenen Partei zu Hilfe zu eilen. Oder aber man bildete eine lokale Überzahl, um einen prominenten Gegner vom Pferd zu stoßen und gefangenzunehmen - dies äußerst lukrativ, da ein solcher Gefangener stets Garant für ein fettes Lösegeld war.
Doch bereits in seiner Frühzeit war das sportliche Kampfspektakel stets auch gesellschaftliches Ereignis, dem die adelige Oberschicht, soferne sie nicht im Geschehen selbst aktiv beteiligt war, beizuwohnen wünschte. Dies galt natürlich besonders für die Frauen, deren Anwesenheit häufig einen besonderer Ansporn für die kämpfenden Ritter darstellte, schenkt man der zeitgenössischen Romanliteratur Glauben. Daher auch die Ausrichtung des Kampfgeländes in der Nähe von Burgen, von denen dann das Kampfgeschehen überblickt und verfolgt werden konnte.
Manchmal waren es auch andere Gebäude inmitten oder am Rande des Kampfgeschehens, die den mitfie- bernden Beobachtern als Aussichtsplattform dienten, oder aber auch eigens dafür errichtete Tribünen. Und ein besonderes Ereignis und eine willkommene Unterbrechung des grauen Alltags ist eine derartige Veran- staltung allemal gewesen, sodass gefüllte Besucherränge garantiert waren.
Bereits hier wird verständlich, wie solche Turniere Anstöße für heraldische Entwicklungen und vor allem die Entstehung des Heroldwesens gegeben haben mögen. Schließlich wollte man doch wissen, unter welcher Rüstung sich sein persönlicher Favorit befand und wer jener Herr war, der sich gerade so vortrefflich unter den Burgmauern bewährte. Jeder der Kämpfer sollte für die Zuseher zu identifizieren sein - wenn man mal vom obligaten 'Schwarzen Ritter' absieht, der stets als letzter Kämpfer eintrifft und nach erfolgreichem Ge- fecht wiederum unerkannt entweicht ...
Neben der geschilderten Turnei existierte bald schon eine weitere Art von Massenauseinandersetzung, die Buhurt. Im Gegensatz zu ersterem wurde eine solche Buhurt nicht in voller Rüstung ausgetragen. Zwar waren ebenfalls zwei gegnerische Gruppen im Einsatz, doch versuchte man eher seine Geschicklichkeit beim Reiten in geschlossener Formation und beim spielerischen Gebrauch der Waffen zu beweisen.
Solche Buhurten konnten dabei durchaus humoristischen Anstrich haben und damit eine stets willkommene Abwechslung zum ernsten Kampfgeschehen der Turnei bilden; so etwa, wenn sich die Kontrahenten mit sandgefüllten Säcken oder Stangen vom Pferd zu befördern suchen. Dabei kannte das Geschehen durchaus in ein 'jeder gegen jeden' ausarten, bei dem der letzte im Sattel Verbliebene eben den Sieg davontrug. Dass diese Art von Auseinandersetzung in der Regel mit weniger Verletzungen verbunden war als die Turnei, ver- steht sich von selbst ...
Weiter zum dritten Teil der Artikelserie
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Höfisches Leben
Das Turnier

Das ritterliche Turnier, Teil 1 - Herkunft und Frühform
Fragt man heutzutage nach Begriffen, die mit dem Mittelalter in Zusammenhang gebracht werden, dann ge- hört das ritterliche Turnier sicher zu den Favoriten. Wer kennt sie nicht, all die prachtvollen Schilderungen jener Kampfspiele - sei es nun aus Hollywoodfilmen oder Büchern. Ja selbst in unseren Redensarten begeg- nen sie wieder, wenn wir etwa jemanden in die Schranken weisen, oder - bei etwas höheren Sympathie- werten - sogar eine Lanze für ihn brechen.
Dabei verbinden wir mit dem Begriff Turnier üblicherweise falsche Vorstellungen. Ursprünglich war damit der Kampf zweier gegnerischer Gruppen zu Pferde gemeint, die Nachbildung einer Feldschlacht also. Der Zwei- kampf zweier Ritter hingegen, die mit eingelegten Lanzen gegeneinander anritten und versuchten sich aus den Sätteln zu stechen, kam erst später in Mode.

Woher stammt aber das Turnier und wie entwickelte es sich? Nun, schenkt man alten Chroniken Glauben, dann geht seine Geschichte in das Jahr 1066 zurück, in welchem es durch den angevinische Adelige Geoffroy de Preuilly begründet worden sein soll. Ob hinter solch legendären Berichten die Wahrheit steckt, wird man wohl nicht mehr mit Sicherheit feststellen können. Gesichert hingegen sind die ersten historischen Belege, die jedoch erst zu Beginn des 12. Jahrhunderts auftauchen. Das Ursprungsgebiet kann wohl im nördlichen Frank- reich vermutet werden, von wo sich die neue Mode rasch in alle Gegenden Europas verbreitete, war doch Frankreich das Zentrum ritterlicher Kultur, von dem entsprechende Impulse ausgingen.
In der Anfangsphase der Turnierentwicklung bestand zweifelsohne eine enge Verknüpfung mit dem krieger- ischen Handwerk des Ritters. Als Elitekämpfer war dieser auf die perfekte Beherrschung seiner Waffen zu Pferde angewiesen. So könnten auch technologische und militärtechnische Neuerungen entscheidende An- stöße zur Entwicklung des Turniers gegeben haben. Der Angriff von schwergepanzerten Reitereinheiten mit eingelegter Lanze (melée) wurde im 11. Jahrhundert entwickelt. Um die volle Wucht und Durschschlagskraft zu erzielen, war dabei der gemeindsame Angriff einer Gruppe von Reitern erforderlich. Das die Perfektion einer solchen Taktik fortlaufende Übung - auch in der Gruppe - nötig machte, versteht sich fast von selbst.
Der altfranzösische Begriff tornoiier bedeutet etwa soviel wie 'sich drehen, kreisen' oder 'wirbeln' und stammt von den typischen Bewegungen, die ein geschickter Kämpfer zu Pferd während einer Schlacht ausführen muss um Angriffe abzuwehren und selbst in die Offensive zu gehen. Etwa um 1170 taucht dann das einge- deutschte Verb turnieren in unserem Sprachraum auf; nun sind auch nicht mehr kriegerische Handlungen da- mit gemeint.
Wenn wir den Übungsaspekt betonen, den eine Turnierteilnahme für die Mitstreitenden zweifelsohne besaß, dann soll nicht vergessen werden, dass dies hauptsächlich für die Frühformen galt. Jedenfalls war ein solches Ereignis immer auch ein gesellschftliches und festliches, bei dem nebenbei auch hohe Politik gemacht werden konnte (Ähnlichkeiten mit modernen Sportgroßveranstaltungen, bei denen sich die Granden von Politik und Wirtschaft mit entsprechenden Club-/Nationalfarben gerne auf den VIP-Tribünen zeigen, fallen durchaus ins Auge). Man denke nur an ben berühmten Mainzer Hoftag von 1184. Neue Regeln sollten in späterer Zeit das Risikopotential minimieren und auch die Formen der Wettkämpfe änderten sich, so gewinnen etwa der Zwei- kampf (Tjost) und Geschicklichkeitsübungen zunehmend an Gewicht.
Vorerst jedoch unterscheiden sich Turniere kaum von wirklichen Reiterschlachten, wurde doch mit scharfen Waffen gekämpft. Einzig die Einrichtung von Ruheplätzen und die Grundregel des Turniers, nämlich die geg- nerischen Ritter keinesfalls zu töten, sondern gefangenzunehmen und gegen ein Lösegeld später wieder freizulassen, zeigen, dass es sich um ein 'Spiel' und nicht mehr um blutigen Ernst handelt. Dennoch - und das liegt in der Natur der Sache - gab es genügend Verwundete und Tote. Auch konnte es schon einmal vorkom- men, sei es nun im Eifer des Gefechtes oder aber weil sich die Parteien zweier verfeindeter Herren am Felde gegenüberstanden, dass ein solches Turnier zur echten Schlacht ausartete.
Verständlich, dass sich bald schon die ersten Stimmen wider die neue 'sportliche' Betätigung der Ritter, die Turniere, erhoben. Sei es nun von kirchlicher Seite mit den Turnierverboten oder aber von den Landesherren selbst, die um so wertvolle Ressourcen wie ausgebildete Kämpfer, Pferde und Waffen fürchteten. Wie nun auf solche kritischen Einwände und Verbote reagiert wurde und wie sich das Turnier weiterentwickelte, darüber mögt ihr hier demnächst mehr lesen ...
Weiter zum zweiten Teil der Artikelserie
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Islam
Die Mamelucken

Die Mamelucken - Kriegerelite islamischer Herrscher
Bei den zahllosen Auseinandersetzungen, welche die christlichen Kreuzfahrerkontingente im Heiligen Land auszufechten hatten, trafen die fränkischen Ritter nicht nur auf Widersacher muslimischen Glaubens. In den Reihen der islamischen Armeen fanden sich auch zahlreiche Anhänger anderer Religionen, die von den ein- heimischen Herrschern als Berufskrieger rekrutiert worden waren.
Anders als im christlichen Abendland mit seinem Rittertum hatte sich in der muslimischen Welt ursprünglich keine ständisch orientierte Kriegerkaste herausgebildet. Zudem erlaubten die Lehren Mohammeds keinen Krieg zwischen Muslimen geben; einzig gegen Andersgläubige durften Waffen zum Einsatz kommen.
Beide Punkte stellten Probleme für islamische Herrscher dar: Einerseits ließen sich in Zeiten politischer und re- ligiöser Spannungen Auseinandersetzungen zwischen muslimischen Staatsgebilden auf Dauer ebensowenig vermeiden, wie Kriege zwischen den christlichen Herrschern Europas. Um diese Auseinandersetzungen zu führen, benötigten die Emire und Machthaber gut ausgebildete, in ständiger Übung stehende Berufssoldaten.

Vielfach wurden zu diesem Zweck ausländische Berufskrieger in den Dienst genommen, die häufig von den Reitervölkern der östlichen Steppen, turkmenischen und kursischen Stämmen, rekrutiert wurden. Ägyptische Herrscher griffen auch auf die Dienste von Nubiern oder Sudanesen zurück. Wenn diese Krieger ihrem eige- nen Glauben treu blieben, dann konnte sich der 'Dienstgeber' ungeniert ihrer bedienen, um durch sie seine Auseinandersetzungen mit anderen muslimischen Herrschern austragen zu lassen - das Verbot der Auseinan- dersetzung zwischen Muslimen war dadurch umgangen. So wurden diese angeworbenen Krieger zu einem festen Bestandteil der islamischen Armeen.
Eine Besonderheit unter diesen Berufskriegern stellten die sogenannten Mamelucken dar, wobei die arabische Bezeichnung 'mamluk' soviel wie 'eigen' oder 'in Besitz genommen' bedeutet. Es handelte sich bei diesen Krie- gern also ursprünglich um Sklaven, die für den Militärdienst vorgesehen waren. Von turkmenischer, slawischer oder tscherkessischer Herkunft wurden sie ihren Eltern als Kinder abgekauft oder als Kriegsbeute von Feldzü- gen mitgeschleppt. Die ausgezeichnete militärische Ausbildung, dauernder Drill und die Spezialisierung auf das Kriegshandwerk machte sie zu echten Profis, welche sich mit den europäischen Kreuzfahrern durchaus messen konnten. Mit ihnen wurde eine Entwicklung vorweggenommen, welche später die türkischen Osma- nen mit den Janitscharen fortsetzen sollten.
Der Abbasiden-Kalif al Musatin soll im 9. Jahrhundert der Erste gewesen sein, der verstärkt solche Militärskla- ven eingesetzt hat. Doch wie so häufig, brachte die Ausbildung einer derartigen Elite auch ihre Gefahren für die Herrschenden mit sich. Es lag in der Natur der Sache, dass sich mit dieser Spezialisierung auch ein hohes Standesbewusstsein herausbildete. Stets musste der Herrscher darauf bedacht sein, sich die Loyalität seiner Spezialeinheiten zu erhalten beziehungsweise mussten sich die Prätendenden, im Falle von Auseinanderset- zungen um die Herrschaftsnachfolge, stets der Gunst ihrer Garde versichern. Man findet in der Geschichte manches Beispiel, man denke nur an die Prätorianergarde der römischen Cäsaren, in der solche Eliten schließ- lich entscheidend Einfluss genommen haben.
1250 kam es in Ägypten schließlich zur Ermordung des herrschenden Ayyubidensultan Turan Schah und zur anschließenden Machtübernahme durch den Mameluckengener Aybak, der den ägyptischen Mamelukenstaat begründete. Der Mameluckeneinfluss sollte sich in Ägypten bis in das 19. Jahrhundert hinein erhalten.
Von der hohen militärischen Qualität dieser Kriegerelite zeugen unter anderem ihre Erfolge in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts gegen die bis dahin unbesiegten Mongolen und auch die endgültige Vertreibung der Franken aus Palästina durch Baibars und seine Nachfolger...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Alte Berufe
Der Drechsler

Altes Handwerk - Der Drechsler
Das Drechseln erfolgt mit schneidenden Werkzeugen auf einer Drehbank, wobei aus dem ursprünglich recht- eckigen Holzrohling durch Spanabnahme ein Produkt mit rundem Querschnitt erzeugt wird. Diese Technik dürfte sich vor etwa 4000 Jahren im alten Ägypten beginnend entwickelt haben, wobei sie ihren Ausgang vermutlich vom Vorgang des Bohrens mit rasch bewegtem Bohrer genommen hat. Charakteristisch ist jeden- falls die drehende Bewegung des Werkstückes während des Bearbeitungsvorganges. (Übrigens: Im Gegen- satz zum Drechseln spricht man bei der drehenden Bearbeitung von Metallen und Kunststoffen vom Drehen.)
Der Übergang vom Feuerquirl zum Fiedelbohrer bereitete den Weg zum Drechseln. Bei diesem Bohrer wird ein Holzstab von einer Bogensehne umschlungen und kann durch Vor- und Rückwärtsbewegen des Bogens in schnelle Umdrehungen versetzt werden. Wird der Holzstab horizontal drehbar gelagert, ist der Schritt zur Fie- deldrehbank getan, wie sie in ägyptischen Abbildungen auftaucht. Bearbeitet wurden Materialien wie Grün- und Trockenholz, aber auch Elfenbein, Knochen, Speckstein, Alabaster und Marmor.

Zur Bedienung einer derartigen Drehbank, wie sie auch heute noch im Orient anzutreffen ist, sind allerdings zwei Personen nötig, der Meister hantiert dabei wohl am Werkstück herum, während der arme Gehilfe für die Drehbewegung mit Hilfe des Bogens zu sorgen hat. (Schreckliche Vorstellung, ein derartiger achtstündiger Ar- beitstag ..) Man datiert die Einführung in Ägypten etwa auf 1500 vor Christus, was die Drehbank zur ältesten bekannten Maschine der Menschheitsgeschichte macht. Erhaltene archäologische Drechselerzeugnisse aus Knochen datieren auf etwa 700 v.Chr. zurück, die Ausbreitung der Technik über weite Teile Europas setzte vermutlich im 6. vorchristlichen Jahrhundert ein. Bei den Römern war die Kunst des Drechselns sehr beliebt, was auch zu literarischer Erwähnung führt - etwa bei Plinius.
Im Mittelalter findet sich der früheste Hinweis auf das Vorhandensein des Drechselhandwerkes im Capitulare de villis Karl des Großen, das um 800 erlassen wurde. Darin finden sich unter der Auflistung berufsmäßig aus- geübter Handwerke auch die Drechsler, als sogenannte tornatores bezeichnet. Im nur wenig jüngeren St. Galler Klosterplan sind Werkräume für tornatores bzw. tornarii aufgelistet - ein Hinweis daruf, dass sich in je- ner Zeit spezialisiertes Handwerk überwiegend in Klöstern entwickeln konnte.
Allzuviel an Spezialisierung darf man sich dennoch im 9. und auch in den folgenden Jahrhunderten immer noch nicht erwarten: Bis weit in das 14. Jahrhundert hinein bestand die Aufgabe der Drechsler vor allem darin, ein- faches Mobiliar zu erzeugen. Erst nach und nach entwickelten Aristokratie und Großbürgertum einen gehobe- nen Lebesstil, wodurch den Drechslern Gelegenheit geboten wurde neben den einfachen Gegenständen des häuslichen Gebrauches auch Produkte für verfeinerte Lebensbedürfnisse zu schaffen. Im 16. Jahrhundert set- zte damit eine zunehmende Spezialisierung in Holz-, Bein- und Horndrechsler beziehungsweise Metalldreher ein. Produkte wie Schreib- und Spielzeugezeuge, Leuchter, Möbel, Musikinstrumente, Büchsen, Drehteile für den Schreiner und vieles mehr finden nun Absatz.
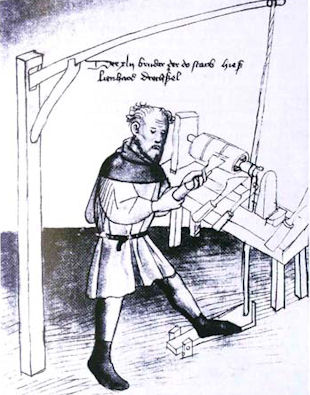
In hohem Grade behilflich für diese Entwicklung war eine neue Erfindung: Die Wippdrehbank, bei der die be- nötigte Drehbewegung durch die Betätigung eines Fußpedales erzeugt und somit die Bedienung durch nur eine Person ermöglicht wurde, stellte eine große Weiterentwicklung dar - auch wenn damit immer noch kein kontinuierlicher Betrieb möglich war (siehe die obige Abbildung). Vermutlich datiert die Erfindung ins 13. Jahr- hundert zurück; spätestens im 15. Jahrhundert war die bis dahin gebräuchliche Fiedeldrehbank in Europa durch die Neuentwicklung abgelöst.
Zunftmäßige Organisation der Dreher findet sich im deutschsprachigen Raum erstmalig 1180 in Köln, von 13. bis ins 15. Jahrhundert folgten Zuftordnungen in zahlreichen anderen Städten. In den überlieferten Hand- werksordnungen wird auch die Abgrenzung zu verwandten Berufen wie dem Tischler oder dem Zimmermann geregelt. Es war - mit Ausnahmen - üblich, dass der Drechslergeselle auf Wanderschaft ging.
Die Weiterentwicklung der Dreherei führte dann zur Entwicklung der eigenständigen Kunstdrechslerei im Ba- rock. Technische Neuerungen waren etwa die Drehbank mit Fußbetrieb und gekröpfter Welle, von Leonardo da Vinci um 1500 entwickelt, an der ein Schwungrad befestigt war. Dadurch wurde erstmalig ein kontinu- ierlicher Betrieb möglich. Seit dem 16. Jahrhundert ist dann auch die Nutzung der Wasserkraft zum Antrieb belegt ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Technologie des MA
Schriftwesen

Schriftlichkeit im Mittelalter - Teil 3: Das Aufkommen der Codices
Zum ersten und zum zweiten Teil der Artikelserie
Das römische Reich mit seiner straffen Verwaltung und seinem hochentwickelten Schreibwesen prägte für Jahrhunderte den europäischen Raum - sei dies nun direkt, in jenen Ländern die Bestandteil Imperiums wa- ren, oder indirekt durch die immense Ausstrahlung seiner kulturellen Errungenschaften, die zahlreiche Ange- hörige der barbarischen Völker jenseits der Grenzen in die Dienste des Kaisers treten ließ.
Bevorzugte Schriftträger für umfangreichere Aufzeichnungen waren die Schriftrollen aus Papyrus. Daneben existierten Wachstafeln, ursprünglich einfache Holztafeln, welche sich gut für das Aufzeichnen kurzer Notizen eigneten, da Korrektur und Löschen der Schriftzeichen im Wachs einfach und beliebig oft möglich ist. Beschrie- ben wurden derartige Tafeln mit Hilfe eines robusten Schreibgriffels, des stilus, der aus Metall oder Knochen, bei wertvollen Ausfertigungen auch aus Elfenbein, gefertigt war. Während das spitze Ende zum Schreiben diente, wurde das andere meist abgeflacht ausgeführt, wodurch Fehler im Wachs rasch ausgetilgt werden konnten.

Allerdings bietet eine derartige Wachstafel allenfalls Raum für kurze Aufzeichnungen. Daher band man, um mehr Platz zu gewinnen, zwei solcher Tafeln häufig zum sogenannten Dyptichon zusammen. Bei drei solch- erart verbundener Tafeln spricht man vom Triptychon, bei mehreren vom Polyptychon. Im Vergleich zur Schrift- rolle war damit das Aufsuchen bestimmter Textnotizen bedeutend einfacher, da man sich das umständliche Ab- und anschließende Wiederaufrollen ersparte.
Vermutlich war dies auch der Grund dafür, dass ab dem 4. Jahrhundert der Codex die Rolle zu verdrängen be- gann. Codices bestehen, wie die heutigen Bücher auch, aus einzelnen Blättern und Lagen, die ineinander- gelegt und verbunden wurden. Vorbild für diese Buchform war das Polyptychon, statt Wachs und Holz be- stand ein Codex allerdings vorerst noch aus Papyrus. Das Bezeichnung Codex leitet sich übrigens aus dem lateinischen caudex ab, was nichts anderes als Holzblock bedeutet und somit eindeutig auf die Wachstafel als Vorbild hinweist.
Das Aufkommen des Christentums dürfte einen wichtigen Grund dafür darstellen, dass sich die Codices durch- zusetzen begannen. Die Lehren der jungen Religion waren in der Bibel zusammengefasst, und wer immer die Aussagen verbreiten wollte, war darauf angeweisen, Abschriften davon zu besitzen. Schließlich sind Lesun- gen aus der Heiligen Schrift wichteiger Bestandteil des christlichen Gottesdienstes. Dies macht es aber erfor- derlich, dass bestimmte Textpassagen rasch aufgesucht werden können, was bei Aufzeichnung in Rollenform kaum oder nur sehr umständlich zu bewerkstelligen ist. Vermutlich darum wurden bereits die frühesten Bibel- handschriftenaus aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert in Codexform aufgezeichnet, wenn auch noch auf Papyrus.
Die Anfälligkeit dieses Materials gegenüber Umwelteinflüssen war aber nur zu gut bekannt und speziell für wertvolle Schriften, wie dies beispielsweise eben die Bibel für einen Christen ist, ein großer Nachteil. Schließ- lich macht dies eine aufwändige, weil handgeschriebene, Neuübertragung notwendig.
Ab dem 4. Jahrhundert begann man darum bereits diese wertvollen Schriften auf das bedeutend haltbarere Pergament zu übertragen, also Schreibmaterial, das aus Tierhäuten gewonnen wurde und dementsprechend teurer als Papyrus war. Obwohl Papyrus vorerst ebenfalls noch zum Einsatz kam (bis in das frühe Mittelalter hinein), wurde er nach und nach vom Pergament verdrängt. Bis zur Durchsetzung des Papiers in Europa, die im 13. Jahrhundert erfolgte, blieben Tierhäute der bevorzugte Schriftträger. Und selbst danach kam Perga- ment immer noch zum Einsatz, speziell zur Aufzeichnung wichtiger Dokumente oder wertvoller Handschriften. So verbot etwa der in Süditalien residierende Stauferkaiser Friedrich II. den Einsatz von Papier zur Erstellung von Urkunden und Dokumenten, da er dem Pergament eine bessere Haltbarkeit unterstellte.
Die Schriftrolle war in dieser Epoche, bis auf wenige Ausnahmen, längst schon von den buchförmigen Codices ersetzt. Interessanterweise findet sich der Rotulus dennoch in den Abbildungen zahlreicher Handschriften, die selbst in Codexform gefertigt wurden. Wie nun ein derartiger Codex hergestellt wurde, welche Arbeitsschritte dazu erforderlich waren und wer damit zu tun hatte, darüber mögt ihr in den folgenden Teilen dieser Artikel- serie mehr erfahren ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Technologie des MA
Schriftwesen

Schriftlichkeit im Mittelalter - Teil 2: Schreibmaterialien im Wandel der Zeit
Zum ersten Teil der Artikelserie
Wie und wo es erstmalig dazu gekommen ist, dass die Menschheit die Kunst des Schreibens erlernte, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen; derzeit gelten jedenfalls die Sumerer diesbezüglich als Hauptverdächtige. Auch ist nicht bekannt, ob die Schrift einmal erfunden und in der Folge entlehnt oder mehrfach entdeckt wur- de. Allenfalls lassen sich mehr oder weniger plausible Überlegungen dazu anstellen: So betätigte sich schon der steinzeitliche Jäger künstlerisch. Davon geben etwa die großartigen Höhlenmalereien von Altamira und Lascaux Zeugnis. Dass solche bildnerischen Abbildungen den ersten Schritt zur Ausbildung von Schriftsys- temen dargestellt haben könnten, die dann erfolgte, als durch Bildung größerer Siedlungseinheiten religiöse Motive und die beginnende Notwendigkeit organisierter Zusammenarbeit dies erforderlich machte, scheint nachvollziehbar.

Überhaupt dürfte im Begriff der Notwendigkeit beziehungsweise des Bedarfes der Schlüssel zu manch großer Entdeckung und Entwicklung liegen. So lautet die plausible Vermutung, die Entwicklung von Zahlensystemen könnte mit der Entstehung von großen Herden in größeren Siedlungen, also mit beginnender Arbeitsteilung zu tun haben. Für den Steinzeitjäger mag es ja noch ausgereicht haben, die Anzahl der erlegten Bären durch einfache Kerben auf seinem Speer zu markieren.
Dort aber, wo größere Herden zu beaufsichtigen waren, war es für den Hirten von Bedeutung, am Abend zu wissen, dass auch alle Schafe, die des Morgens auf die Weide getrieben worden waren, wieder den heimat- lichen Stall erreicht hatten. Was tun, wenn man aber noch keine Zahlen kennt und die Anzahl der Tiere eine große ist? Nun, für jedes Schaf, das die heimische Koppel verlässt, wird ein Stein einem Haufen hinzugefügt. Bei der Heimkehr ist dann für jeden Blöker, der das Tor passiert, wiederum ein Stein zu entfernen. Bleiben Steine übrig, kennt der Hirte die Anzahl der Tiere die fehlen und kann sich folglichermaßen seufzend auf die Suche machen - oder aber den Krokodilen und Löwen ihre Festtagsschmaus gönnen.
Wenn dann bei sehr großen Herden das Hantieren mit vielen Steinen zu unhandlich wird, oder - weil gerade kein Kiesweg zur Hand ist - einfach nicht genügend zur Hand sind, und ein schlauer Hirte einen großen Stein für beispielsweise zehn kleine setzt, dann befinden wir uns schon auf dem Weg zu einer Zahlensystemdars- tellung (das in unserem angeführten Beispiel ein sogenanntes Nichtstellenwertsystem darstellt, und zwar ein dezimales. Die Beliebtheit von solchen Zehnersystemen erklärt sich ja aus der Anzahl von zehn Fingern, wel- che die überwiegende Mehrheit von uns aufzuweisen hat. Interessant, wenn auch etwas vom Thema ab- schweifend ist in diesem Zusammenhang, dass das Zahlensystem der alten Sumerer auf der Basis 12 be- ruhte, weiß der Kuckuck warum, was uns als späte Auswirkung unter anderem immer noch die Unterteilung der Minute in 60 Sekunden oder die 360 Winkelgrade beschert!).
Unabhängig davon, wie die einzelnen Schriften sich entwickelten, sei es nun als reine Symbolschrift, in der für jedes Objekt oder jede Tätigkeit ein 'passendes' Zeichensymbol gesetzt wird (also etwa ein gezeichnetes Rind für ein derartiges Rindvieh), sei es als Silben-, als Buchstabenschrift oder als Kombination davon, jede benötigt ein passendes Medium, also das geeignete Material, zur dauerhaften Aufzeichnung. Wie dieses Ma- terial aussah, hing anfänglich nicht zuletzt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Denn während im schlam- migen Mesopotamien Tontäfelchen die erste Wahl waren, in die mit gespitzen Rohren Keilschriftzeichen ge- drückt wurden, lieferte im schilfreichen Ägypten die Papyruspflanze den passenden Untergrund für die Hyroglyphen.
Tontäfelchen sind aber nicht besonders handlich wenn es darum geht, längere Texte aufzuzeichnen. Eben- sowenig große Felsklippen, in welche man allenfalls Steinreliefs für die Ewigkeit meisselt, etwa um die Taten seines Herrschers der Nachwelt zu hinterlassen. Darum verbreitete sich schließlich der Papyrus in Form von Buchrollen über die antike Welt. Dabei wurde die beschriebene Papyrusbahn um einen Stab gewickelt aufbe- wahrt. Zum Lesen wurde dann der Stab herausgezogen , die Rolle mit der rechten Hand gehalten und mit der Linken der gelesene Teil wieder aufgewickelt. Nach dem Lesen der Rolle musste diese dann zurückgewickelt werden um die bei neuerlicher Lektüre wieder von vorne starten zu können. Beschrieben waren die Papyrus- rollen waagrecht in Kolummnenform, wobei als Schreibwerkzeug der Calamus, ein Schreibrohr, zum Einsatz kam, mit dem schwarze und rote Tinte aufgetragen wurde.
Autor und Name des Werks waren auf einem Streifen ersichtlich, der aus der aufgerollten Rolle heraushing, sowie auch am Ende der Textrolle selbst aufgeführt. Derartige Bezeichnungen wurden notwendig, da bereits im 3. Jhdt.v.Chr. die ersten großen Bibliotheken gegründet wurden, in denen tausende Schriften aufbewahrt wurden. Aber auch private Sammlungen existierten, wie etwa jene 1800 Rollen umfassende, die in einem Haus im vulkanverschütteten Herkulaneum erhalten geblieben ist. Im römischen Reich selbst waren Sklaven für die Vervielfältigung von Schriften zuständig - eine sehr kostengünstige Angelegenheit und der Traum jedes hausübungsgeschädigten Schülers: Ein griechischer Sklave, bewandert in Mathematik und Physik, mehrerer Sprachen mächtig, willig und billig ...
Die Schriftrolle überlebte auch den Fall des weströmischen Reiches und so kam Papyrus als Schreibmaterial bis in das 7. Jhdt hinein in der merowingischen Hofkanzlei zum Einsatz. In Rollenform, als rotulus bezeichnet, wurden dort die Urkunden, Akten, Briefe und Listen aufgezeichnet, ebenso liturgische Texte. Noch Jahrhun- derte später fanden sich Buchrollen, so etwa der byzantinische Josua-Rotulus, Aufzeichnungen der jüdischen Thora, die traditionellerweise in dieser Form erfolgten, aber beispielsweise auch grundherrschaftliche Ver- zeichnisse im deutschsprachigen Bereich, allerdings war bis dahin der Papyrus längst nicht mehr in Verwen- dung. Interessant zu bemerken ist, wie sich die Art, in der Rollen beschrieben und gelesen wurden, geändert hat: In der Antike seitwärts gerollt, werden die mittelalterlichen Rotuli überwiegend von oben nach unten gelesen.
Doch offenbart die Kombination von Papyrus, das in unserem Wort 'Papier' fortlebt, und Rolle einige Schwäch- en: schlechte Haltbarkeit, insbesondere in feucht-kaltem Klima, wie es zeitweise in den rauen Frankenlanden zu herrschen pflegt, Unhandlichkeit und schnelles Aufsuchen bestimmter Textpassagen. Diese und die Verfüg- barkeit anderer Materialien führten schließlich zu seiner Ablösung durch andere Schreibmedien, worüber in der nächsten Folgen der Serie mehr zu erfahren sein wird. Dass der Buchrolle als älteste 'Buchform', obwohl kaum noch verwendet, dennoch ein hohes Ansehen verblieb, davon zeigen unter anderem auch die Darstel- lungen in zahlreichen Handschriften, so etwa im Codex Manesse oder auch der Carmina Burana-Handschrift.
Weiter zum dritten Teil der Artikelserie
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Technologie des MA
Schriftwesen

Schriftlichkeit im Mittelalter - Teil 1: Die Voraussetzungen
'Oh glücklicher Leser, wasche deine Hände und fasse das Buch so an, drehe die Blätter sanft, halte die Finger weit ab von den Buchstaben. Der, welcher nicht weiß zu schreiben, glaubt nicht, dass dies eine Arbeit sei. Oh, wie schwer ist das Schreiben: es trübt die Auge, quetscht die Nieren und bring zugleich allen Gliedern Qual, Drei Finger nur schreiben, doch der ganze Körper leidet. ...'
(Zitat eines mittelalterlichen Schreibers)
Das angeführte Zitat mag den einen oder anderen Leser an die Klagen seiner hoffnungsvollen Sprößlinge er- innern, wenn sie des Abends von den Erlebnissen in der Schule berichten oder gar eigene schreckvolle Erleb- nisse wachrufen. Und dennoch sind es gerade diese Errungenschaften, die Kunst des Schreibens und des Lesens, welche dem Menschen jene Entwicklung ermöglichte, die in unsere moderne Zeit führte. Denn erst mit der schriftlichen Fixierung auf haltbaren Medien wurde es möglich, Erfahrungen und Erinnerungen, erar- beitete Kenntnisse für spätere Generationen aufzubewahren und auch einem größeren Personenkreis zu- gänglich zu machen.

Natürlich kennen auch schriftlose Kulturen Methoden um erworbenes Wissen weiterzugeben: Orale Erzähl- traditionen, wie sie ja auch Germanen, Kelten, Slaven und viele andere Völker pflegten, - so gilt ja als ge- sichert, dass das Nibelungenlied auf derartiges mündliches Erzählgut aus der Völkerwanderungszeit zurück- greift, ebenso wie das angelsächsische Beowulfepos auf germanische Heldenerzählungen, in den Geschichten aus dem Umkreis von König Artus finden sich zahlreiche Bezüge auf bretonisch/walisisch/keltisches Sagengut - und in denen sich Weltdeutung und geschichtliche Erinnerung, Rückbesinnung auf wichtige Ereignisse und bedeutende Ahnen finden. Wissensvermittlung, etwa über die Geheimnisse der Metallverarbeitung, erfolgt im direkten Kontakt zwischen Lehrer und Schüler, Meister und Lehrling. Doch fehlt es diesen Kulturen an Mög- lichkeiten der Sammlung all der verschiedenen Erkenntnisse und Fähigkeiten an einem zentralen Ort.
Allerdings bedürfen Sippen oder Völkern, die wandernd und jagend oder in kleinen Gemeinschaften Land- wirtschaft betreibend ihren Lebensunterhalt erwirtschaften, gar nicht dieser Form von Wissensspeicherung. Dann jedoch, wenn sich größere Gruppen von Menschen organisieren und zusammentun, etwa um gemein- sam Projekte zu bewältigen, welche die Möglichkeiten weniger übersteigen, ergibt sich rasch ein Bedürfnis nach dauerhaften Aufzeichnungen. Man denke nur an jene alten Kulturen, deren wirtschaftliches Überleben davon abhängig war, dass große Bewässerungsanlagen errichtet und instandgehalten, dass der richtige Zeitpunkt für Aussaaten errechnet werden konnte. Aufgaben, deren Erledigung eine zentrale Organisation durch Königtum, Beamten- beziehungsweise Priesterschaft erforderlich machte. Die sumerischen Stadtstaaten im Zweistromland oder das ägyptische Pharaonenreich sind die prominenten und ersten Beispiele.
Just dort, wo diese ersten Hochkulturen erwuchsen, entwickelte sich folgerrichtig uch die Schrift. Ob nun unabhängig voneinander oder durch Entlehnung sei dahingestellt. Jedenfalls erforderten die zentralen Ver- sorgungsspeicher der antiken Palastkulturen Register, Termine mussten mit Hilfe von Kalendern errechnet werden, Abgaben mengenmäßig erfasst ... Dass die neu errungene Fähigkeit nicht nur zur Erstellung von Listen und Inventarien verwendet wurde, sondern bald schon dazu diente die Taten von Göttern und Herr- schern zu verherrlichen, versteht sich aus der Natur des Menschen heraus von selbst. Bedeutsame Fragen finden schon bald Eingang in erste literarische Werke, bereits Gilgamesch sucht nach dem Kraut des Lebens.
Bald strahlten Glanz und Errungenschaften dieser Brennpunkte menschlicher Kulturentwicklung in alle Rich- tungen ab. In den Palästen von Knossos und Phaistos entstanden frühe Schriften auf europäischem Boden, vielleicht auch von den Phöniziern lernten später, nach einer kriegerischen Phase des Umbruchs und der Zer- störung, die Griechen das Alphabet und damit neuerlich die Kunst des Schreibens. Homers Ilias und Odysee entstehen, Herodot wird der Vater der Geschichtsschreibung, Thukydides führt diese über das Mythenhafte hinaus. Erste große Bibliotheken entstehen in den hellenistischen Metropolen Alexandria und Pergamon. Das Denken erlebt einen ungeheuren Aufschwung, es beginnt abstrakte Bereiche zu erobern mit den stets Wiss- begierigen, den Philosophen: Herodot, Parmenides, Platon, Aristoteles und wie sie alle heißen ...
Die Römer zeigen sich all den anderen Völkern in der alten Welt politisch und militärisch überlegen, sie ero- bern ihr großes Reich: Das Imperium Romanum behrrscht die Welt von Britannien bis zum Euphrat, vom Rhein bis zu den Nilkatarakten und es wird fortan das politische Denken bis in unsere Zeit hinein beinflussen. Den- noch erkennen die fähigen Krieger und Organisatoren die Überlegenheit des griechischen Denkens an und machen sich bereitwillig das umfassende Wissen der Hellenen zu eigen. Wissenschaft und Forschung, Philo- sophie und Literatur blühen, Wirtschaft und Verwaltung sind straff organisiert, eine bestens ausgebildete Beamtenschaft verwaltet ein Millionenreich.
Doch dann kommt es neuerlich zum großen Umbruch. Rom versinkt in den Wirren der Völkerwanderungszeit, das westliche Kaisertum geht unter. Horden von Barbaren fluten in die ehemaligen Provinzen, übernehmen die Macht und gründen ihre eigenen Königreiche. Die Errungenschaften der Zivilisation scheinen verloren, zu- mindest in Europa, während sich im Osten Byzanz als Rechtsnachfolger des römischen Reiches halten kann. Doch für eine dauernde Einflussnahme im Westen reichen dort die Kräfte nicht, zu lange befindet man sich im lebensbedrohlichen Kampf, vorerst mit mit dem sassanidischen Persien, später mit den anstürmenden Ara- bern, denen eine Religionsgründung zur explosionsartigen Ausbreitung verholfen hat.
Hinter dem Schutzwall, den Ostroms Armeen im Abwehrkampf bilden, bleibt der Westen lange Zeit sich selbst überlassen. In den Wirren der Zeiten etablieren sich langfristig zwei Mächte: das Frankenreich nördlich der Alpen, das nach und nach seine Machtbasis in Frankreich und Deutschland ausbreiten kann, und das römische Papsttum, allzeit bedroht von weltlichen Feinden.
Viele, doch nicht alle antiken Errungenschaften sind da verloren. In dieser Artikelserie soll nun beleuchtet werden, wie es trotz aller Umbrüche und Verheerungen gelingen konnte, die Kunst des Schreibens und auch das Wissen über manch antiken Autor und seine Werke in die neue Zeit hinüber zu retten. So war denn das Mittelalter schlussendlich nicht nur jene dunkle Zeit, in der die Erkenntnisse der großen antiken Zivilisation verlorengingen, sondern auch eine Epoche, in der manches gerettet und bewahrt werden konnte und in der schließlich, aufbauend auf dieses bewahrte Wissen, verbunden mit neuen Einflüssen, der Weg in die Moderne in Angriff genommen werden konnte ... So euch dies interessiert, mögt ihr hier darüber einiges erfahren. Demnächst hier, auf diesem Kanal - oder so ähnlich ..
Weiter zum zweiten Teil der Artikelserie
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Das Frankenreich
Frühmittelalter

Die erste Nachfolgeregelung Ludwig des Frommen - Die 'Ordinatio imperii' von 817
Als Karl der Große 806 in seiner Reichsteilungsordnung 'Divisio regnorum' die Herrschaftsnachfolge so zu re- geln suchte, dass er seinen drei (überlebenden) Söhnen Pippin, Karl und Ludwig jeweils einen Teil seines rie- sigen Reiches zum Erbe bestimmte, folgte er damit gültigem fränkischem, ja germanischem Brauch. Wenige Jahre später hatte sich diese mögliche Zersplitterung erledigt, waren doch die beiden älteren Brüder Pippin und Karl in den Jahren 810 und 811 unerwartet verstorben. Als alleiniger Erbe verblieb Ludwig, der in später- er Zeit mit dem Beinamen 'der Fromme' versehen werden sollte.
813 wurde dieser Ludwig auf einer Reichsversammlung zu Aachen von seinem Vater zum Mitkaiser einge- setzt, wodurch seine Nachfolge sichergestellt wurde, ohne dass der Machtumfang des alten Kaisers dadurch eingeschränkt worden wäre. Nach dem nur wenige Monate später erfolgten Tod seines Vaters im Jänner 814 konnte Ludwig somit unverzüglich die Herrschaft im Gesamtreich antreten.

Bereits drei Jahre später, also noch in verhältnismäßig jungen Jahren, suchte der neue Herrscher die Nach- folge für den Fall seines Todes zu regeln. Der Entschluss, diese Regelung so früh zu treffen, so nimmt man an, dürfte aus dem Eindruck eines unbeschadet überstanden Unfalls hergerührt haben. Jedenfalls enthielt die 'Ordinatio imperii' eine bahnbrechende Neuerung, war doch in ihr erstmalig keine gleichberechtigte Aufteilung des Reiches mehr unter die erbberechtigten Söhne vorgesehen, wie der folgende Auszug zeigt:
...
Teilung des Reiches des Herrn Ludwig unter seine geliebten Söhne, unter Lothar, Pippin und Ludwig, im vierten Jahre seiner Herrschaft. Im Namen unseres Herrn Gottes unseres Erlösers Jesus Christus. Ludwig, nach Gottes weiser Voraussicht Kaiser und Augustes. Da wir in Gottes Namen im Jahre der Fleischwerdung des Herrn 817, in zehnten Indiktion, im vierten Jahre unserer Herrschaft, im Monat Juli zu Aachen in unserer Pfalz gewohntermaßen einen heiligen Konvent und einen Reichstag unseres Volkes einberufen haben, um kirchliche Fragen, aber auch die Angelegenheiten zum Nutzen des ganzen Reiches zu besprechen, und da wir ernsthaft darum bemüht sind, ist es plötzlich auf Gottes Geheiß geschehen, dass uns unsere Getreuen ermahnt haben, mit Rücksicht auf unsere gute Gesundheit und da uns überall von Gott Frieden gewährt ist, über die Lage des ganzen Reiches und über unsere Söhne nach der Weise unserer Väter zu verfahren. Wie untertänig und in wie sehr ergebener Gesinnung diese Mahnung nun auch vorgebracht worden sein mag, so ist es doch weder uns noch denen, die das Richtige wissen, richtig erschienen, dass aus Liebe zu den Söhnen die Einheit des Reiches, das Gott uns verliehen hat, durch eine menschliche Teilung zerspalten werde, damit nicht etwa bei einer solchen Gelegenheit die heilige Kirche in Ärgernis verfalle, und wir uns selbst den Zorn dessen zuziehen könnten, in dessen Kraft die Gerechtigkeit aller weltlichen Herrschaft besteht. Daher haben wir es für notwendig gehalten, mit Fasten und Gebet und Almosen durch ihn zu erreichen, was unsere Schwäche nicht wagte. Nachdem wir drei Tage dies so gehalten haben, ist es, wie wir fest glauben, auf Befehl des allmächtigen Gottes geschehen, dass unsere Stimme und die des ganzen Volkes in der Wahl unseres geliebten erstgeborenen Sohnes Lothar übereinstimmten. Ihn, der durch solchen göttlichen Ratschluß kundgetan wurde, habe ich nach meinem und meines ganzen Volkes Willen feierlich mit dem kaiserlichen Diadem gekrönt und als unseren Mitregenten und Nachfolger am Kaisertum, wenn Gott will, öffentlich eingesetzt. Es hat uns auch gefallen, seine Brüder Pippin und Ludwig, der unseren Namen trägt, unter allgemeiner Zustimmung mit dem königlichen Titel auszuzeichnen, und wir haben sie über die unten näher bezeichneten Gebiete gesetzt, wo sie nach unserem Dahinscheiden unter der Hoheit ihres älteren Bruders mit königlicher Gewalt herrschen sollen nach den unten angefügten Kapiteln, die Bedingungen, so wie wir sie zwischen ihnen festgesetzt haben, enthalten. Es hat uns auch gefallen, diese Kapitel zum Nutzen des Reichs und um des ewigen Friedens zwischen den Brüdern willen und als Schutz für die ganze Kirche mit allen unseren Getreuen zu beraten, das Beratene niederzuschreiben und das schriftlich Fixierte durch unsere eigenhändige Unterschrift zu bestätigen, auf daß diese Artikel durch den Beistand Gottes ebenso unverletzlich in gemeinsamer Ergebenheit gehalten werden zum dauernden Frieden unter ihnen und des ganzen christlichen Volkes, wie sie auch alle in gemeinsamem Rat beschlossen haben; unbeschadet aber bleibe unsere kaiserliche Gewalt über unsere Söhne und unser Volk mit aller Ehrerbietung, die dem Vater von den Söhnen, dem Kaiser und Könige von seinen Völkern zukommt.
Kapitel 1. Pippin soll Aquatinten und die Gascogne und ganze Mark von Toulouse haben und dazu noch vier Grafschafen, nämlich in Septimanien Carcassonne, in Burgund Auftun, Avallon und Nevers.
Kapitel 2. Ludwig soll Bayern und Kärnten erhalten und Böhmen und die Avarengebiete und die Slawischen Gaue an der bayerischen Ostgrenze und dazu zwei königliche Höfe zu seinem Gebrauch im Nordgau, Lauterhofen und Ingolstadt.
Kapitel 3. Wir wollen, dass diese beiden Brüder, die den Namen von Königen führen sollen, innerhalb ihres Machtbereiches alle Ehren aus eigener Gewalt verteilen, so dass kirchliche Ordnung in den Bistümern und den Abteien bewahrt bleibe, wie die Würde und der Nutzen gewahrt werden sollen, wenn sie andere Ehren austeilen.
Kapitel 4. Wir ordnen auch an, daß sie einmal im Jahre zu gelegener Zeit, entweder gleichzeitig oder einzeln, je nach Umständen, ihren älteren Bruder aufsuchen mit ihren Geschenken, um ihn zu besuchen und zu sehen und um über notwendige Fragen und Angelegenheiten des gemeinsamen Nutzens oder des dauernden Friedens in wechselseitiger brüderlicher Liebe zu beraten.
...
Kapitel 7. Auch befehlen wir, daß sie weder Frieden noch Krieg gegen fremde und diesem von Gott geschützten Reich feindliche Völker ohne Rat und Zustimmung des älteren Bruders zu unternehmen wagen. Sie sollen aber nach Maßgabe ihrer Kräfte selbst unerwartete Angriffe von Feinden und überraschende Einfälle abwehren.
Kapitel 8. Gesandten fremder Völker aber, die um Frieden zu schließen oder um Krieg zu erklären oder aus anderen wichtigen Ursachen kommen mögen, oder die Städte und Kastelle ausliefern wollen, soll keiner ohne Wissen des älteren Bruders antworten, ebensowenig sie zurückschicken.
...
Kapitel 14. Wenn einer von ihnen bei seinem Tode legitime Söhne zurücklässt, dann soll doch die Macht nicht unter diesen geteilt werden, sondern lieber soll das Volk zusammenkommen und einen von den Söhnen, den Gott berufen will, erwählen; und diesen soll der ältere Bruder an Bruders- und Sohnesstelle annehmen. Er soll ihn ehrenvoll wie ein Vater erheben, und diese Konstitution ihm gegenüber mit allen Mitteln bewahren. Hinsichtlich der anderen Kinder sollen sie mit frommer Liebe zusehen, wie man sie nach der Art unserer Vorfahren ausstatte und klug halte.
...
(Auszug aus der 'Ordinatio imperii' von 817)
Ludwig bestimmte also in seiner Verordnung seinen ältesten Sohn Lothar zum Nachfolger als Kaiser, der da- mit auch die Oberherrschaft über das Gesamtreich behalten sollte. Erstmalig wurde hiermit das Prinzip des Erstgeborenenrechtes eingeführt - im Interesse der Reichseinheit. Die jüngeren Brüder Ludwig und Pippin wurden zwar nominell zu Königen in 'ihren' Reichsteilen bestellt, in denen sie auch alle Herrschaftsbefugnisse besitzen sollten. In wichtigen außenpolitischen Belangen hatten sie aber den Anordnungen des kaiserlichen Bruders zu folgen. So sah der väterliche Plan aus, der jedoch in dieser Form niemals Wirklichkeit werden soll- te.
Warum? Nun, einerseits hatte Ludwig der Fromme einen Aufstand seines Neffen Bernhard, dem noch von Karl dem Großen eingesetzten König von Italien, niederzuschlagen, da dieser durch die neue Reichsteilungord- nung seine Machtbasis bedroht sah. Die äußerst grausame Bestrafung eines engen Angehörigen - Bernhard starb an den Folgen der angeordenten Blendung - schadete dem Ansehen des Kaisers.
Dazu kam noch seine zweite Ehe mit der schönen und machtbewussten Welfentochter Judith, die all ihren Einfluss geltend machte, um den 823 geborenen gemeinsamen Sohn Karl nicht leer am Erbe ausgehen zu lassen. Was tut man als liebende Mutter nicht alles ... Als Ludwig nun um des lieben Familienfriedens wegen begann einen Herrschaftsbereich für diesen neuen Filius zu schaffen (was tut man als liebender Gatte nicht alles um seine Frau bei Laune zu halten), bewirkte dies genau das Gegenteil: Die drei älteren Halbbrüder sa- hen die Bemühungen der Stiefmutter nicht mit Freuden, gingen diese doch klar zu ihren Lasten. Das Nesthäk- chen konnte somit nicht nicht mit brüderlicher Zuneigung rechnen, sondern wurde als lästiger Rivale betrach- tet ...
Einen verhängnisvolle Entwicklung setzte ein, in derem Verlauf eine neue Nachfolgeregelung entstand, Söhne gegen den Vater revoltierten, der Kaiser mehrmals ab- und wieder eingesetzt wurde und an derem Ende die endgültige Reichsteilung stand. Doch darüber soll ein andermal mehr berichtet werden ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Das Frankenreich
Frühmittelalter

Die Nachfolgeregelung Karl des Großen - Das 'Divisio regnorum' von 806
Mittelalterliche Herrschaft beruhte stets auf einem komplexen Netz von Beziehungen und Abhängigkeiten. Für einen Herrscher war dabei die Anerkennung, die er vor den Großen seines Machtbereiches genoss, von we- sentlicher Bedeutung. Immer dann jedoch, wenn es zu einem Machtwechsel kam, galt es, neue persönliche Bindungen zwischen dem designierten Nachfolger und den entscheidenden Machtträgern aufzubauen. Denn schließlich wurden in einem solchen Fall die Karten neu gemischt, was häufig zur Folge hatte, dass Unruhen und Thronstreitigkeiten ausbrachen - nicht selten unter den Mitgliedern der herrschenden Dynastie.
Als möglicher Lösungsansatz für derartige Probleme drängte sich mittelalterlichen Regenten die zeitgerechte Ernennung eines Nachfolgers aus dem eigenen Haus auf, vorzugsweise des erstgeborenen Sohnes. (Dieses Prinzip der Nachfolgeregelung reicht weit zurück: Als Beispiel sei nur die spätrömische Zeit erwähnt, in wel- cher die beiden Augusti jeweils einen Cäsar zum Mitregenten ernannten. Der wurde damit automatisch auch zum natürlichen Nachfolger des aktuellen Augustus. Dass diese Regelung trotzdem nicht die zahllosen Ausei- nandersetzungen zwischen den Tetrarchen verhindern konnte, dürfte jedoch bekannt sein ...)
Dann nämlich, wenn der Thronfolger rechtzeitig benannt war, möglicherweise auch schon Erfahrungen durch politische Tätigkeiten unter der Schirmherrschaft seines Vaters oder gar als Mitregent hatte sammeln können, die Mächtigen des Reiches - freiwillig oder unter Druck - auf ihn eingeschworen waren, dann standen die Aus- sichten gut, dass der Machtwechsel ohne Unruhen vor sich gehen konnte.
Wer aber sollte den Vater beerben? Im Sinne der Sicherung der Dynastie war für den Herrscher der männliche Nachwuchs entscheidend. Unfälle, Krankheiten, Krieg - alles Gründe, tunlichst mehr als einen Sohn aufzuzie- hen. Dies jedoch führt wiederum zwangsläufig zu Problemen und Streitigkeiten bei der Thronfolge. Zwei mög- liche Strategien, die in unterschiedlichen Abstufungen auftreten konnten, wie denn nun im Falle des Ablebens des Vaters Macht und Besitz zu vererben wären, sind aus dem europäischen Raum jener Zeit bekannt.
Die germanischen Völker kannten das Prinzip der Aufteilung des Besitzes unter allen männlichen Nachkom- men. In Hinblick auf Grundbesitz ebenso wie auf Herrschaftsgebiet bedeutet dies, dass Erbstreitigkeiten da- mit vorerst einmal unterbleiben können; schließlich erbt jeder Sohn seinen (hoffentlich gerechten) Anteil. Gleichzeitig bedeutet dies aber, dass der betroffene Grundbesitz beziehungsweise das betreffende Gebiet dadurch in kleinere Bereiche zerfallen muss. Und theoretisch schreitet dieser Zerfall mit jeder Generation wei- ter fort (z.B. 3 Erben in der ersten Generation, 3x3 Erben in der zweiten, usw.), die Teilherrschaftsgebiete werden also mit der Zeit immer kleiner und politisch und wirtschaftlich immer schwächer.
Um dies zu vermeiden, wurde schon bald in manchen Gegenden Europas das Prinzip der Primogenitur ange- wendet (für welches es aber bereits weit ältere Zeugnisse gibt), welches dem Erstgeborenen das alleinige Recht auf die Nachfolge sichert. Dadurch kommt es dann auch zu keinerlei Zersplitterung des Herrschaftsbe- reiches, allerdings werden durch dieses Prinzip auch manch Unzufriedenheiten geschürt, welche wiederum in Thronstreitigkeiten münden können. Dann etwa, wenn der Erstgeborene zeitig nach Antritt der Herrschaft verstirbt und selbst einen unmündigen Sohn hinterlässt.
Von diesem Recht des Erstgeborenen weiß uns auch die schöne Mär vom dritten Müllersohn zu berichten, der zu seinem Leidwesen von des Vaters Besitz nicht mehr zugemessen bekam als einen lausigen Kater, wäh- rend sein ältester Bruder mit der Mühle selbst den Löwenanteil des Erbes einheimste. Dass dieser Kater sprechen konnte und nebenbei auch noch eine gewisse Fähigkeit zum zielgerichteten Handeln besaß, darf wohl als außergewöhnlicher Glücksfall gewertet werden, wie er nicht jedem Nachgeborenen zuteil wurde. Daher lässt sich wohl auch der große Anteil an zweit- oder spätergeborenen Adelssprösslingen unter jenen Rittern erklären, welche sich im späten 11. Jahrhundert auf den Weg nach Jerusalem aufmachten um dort das Grab des Heilands zu befreien und sich nebenbei etwas weltlichen Besitz zu sichern, welcher ihnen in der Heimat verwehrt war ...
Im merowingischen Frankenreich erfolgte die Teilung des Landes unter den Söhnen ebenso, wie unter den ersten Karolingern. Speziell in der Merowingerzeit führte die ständige Zersplitterung zu andauernden Kämp- fen und vielfachen Grausamkeiten - auch unter den Mitgliedern der Herrscherfamilie selbst.
Auch Kaiser Karl der Große bestimmte in seiner 806 erfolgten Reichsteilungsverordnung alle seine drei Söhne zu Erben:
...
Es ist allen bekannt und, wie wir glauben, niemandem von euch verborgen, dass die göttliche Gnade, durch deren Willen die zum Untergang treibenden Jahrhunderte erneuert werden, uns ein großes Gnaden- und Segensgeschenk gegeben hat, indem sie uns drei Söhne schenkte. Sie festigt durch sie einmal nach unserem Willen unsere Hoffnung gegenüber dem Reich, dann aber hebt sie auch die Sorge auf, dass wir von einer eitlen Nachwelt vergessen werden könnten, und so soll es euch nach unserem Willen bekannt sein, dass wir diese drei von Gottes Gnaden unsere Söhne zu unseren Lebzeiten als Mitbesitzer des uns von Gott gegebenen Reiches ansehen wollen und dass wir darum beten, sie nach unserem Hinscheiden aus dieser Sterblichkeit als Erben unseres von Gott bewahrten und auch in Zukunft geschützten Imperiums Regnum zurücklassen zu können, wenn die göttliche Majestät es will. Wir wollen ihnen aber den Staat nicht in Verwirrung und Unordnung hinterlassen, nicht eine Auseinandersetzung in Zank und Streit um das ganze Reich, sondern wir haben veranlasst, dass, indem wir den Körper des ganzen Reiches in drei Teile zerlegen, genau gekennzeichnet und schriftlich fixiert werde, welchen Teil ein jeder von ihnen regieren und schützen soll. So nämlich soll jeder nach unserer Weisung mit seinem Anteil zufrieden sein und die Grenzen seines Reiches, die ans Ausland stoßen, mit Gottes Hilfe zu verteidigen suchen und Frieden und Liebe seinem Bruder gegenüber beobachten.
1. Es ist unser Wille, daß von unserem von Gott behüteten und auch weiterhin geschützten Imperium und Regnum ganz Aquitanien und Gascogne, außer dem Gau von Tours, alles, was von da nach Westen und gegen Spanien liegt, dann die Stadt Nevers an der Loire mit dem Gau von Nevers und die Gaue von Avallon und Auxois, Châlons-sur-Saône, Mâcon, Lyon, Savoyer, Maurienne, Tarantaise, der Mont Cenis, das Tal von Susa bis zu den Klausen, das Land von den italienischen Berggrenzen bis ans Meer, alle diese Gaue mit ihren Städten und das Land von da nach Süden und Westen bis ans Meer und Spanien, also dieser Teil von Burgund, die Provence, Septimanien oder Gothien, bestimmungsgemäß an unseren geliebten Sohn Ludwig falle.
2. Italien, das man auch Lombardei nennt, und Bayern, wie Tassilo es besessen hat, außer den beiden Höfen namens Ingolstadt und Lauterhofen, die wir früher Tassilo zum Lehen gegeben haben und die zum Nordgau gehören, und der Teil von Alamannien, der auf dem südlichen Donauufer gelegen ist, dann verläuft die Grenze von der Donauquelle bis zum Rhein in der Nähe des Schlettgaues und Hegaus an dem Ort Engen, und dann rheinaufwärts bis zu den Alpen, alles, was innerhalb dieser Grenzen gelegen ist und nach Süden und Osten schaut, dazu der Dukat Chur und der Thurgau, soll Pippin, unserem geliebten Schrie, gehören.
3. Was aber von unserem Reiche außerhalb der genannten Grenzen liegt, das ist Franzien und Burgund, außer dem Teil, den wir Ludwig zugewiesen haben, und Alamannien, außer dem Teil, den wir Pippin zugeschrieben haben, Austrien, Neustrien, Thüringen, Sachsen, Friesland und den Teil von Bayern, den man Nordgau nennt, überlassen wir unserem geliebten Sohne Karl mit der Maßgabe, dass Karl und Ludwig eine Verbindung mit Italien haben, notfalls ihrem Bruder Hilfe bringen zu können, und zwar Karl durch das Tal von Aorta, das zu seinem Reiche gehört Ludwig durch das Tal von Susa, während Pippin seinerseits Eingang und Ausgang durch die Dorischen Alpen
Chur besitzt.
4. Wir ordnen so, daß der Teil des Gesamtreiches, den Karl als der Älteste gehabt hat, zwischen Pippin und Ludwig geteilt werden soll, falls er vor seinen Brüdern sterben sollte, wie er früher zwischen uns und unser Bruder Karlmann geteilt gewesen ist. Pippin soll dann den Teil bekommen, den unser Bruder Karmann gehabt hat, Ludwig aber den Teil empfangen, den wir von diesem Reichsteil in Besitz gehabt haben. Falls aber noch bei Lebzeigten Karls und Ludwigs Pippin das menschliche Geschick erleiden sollte, dann soll der Teil des Gesamtreiches, den Pippin im Besitz hatte, zwischen Karl und Ludwig geteilt werden, und diese Teilung soll so geschehen, daß Karl vom Eingang nach Italien bei Aorta an die Gegenden von Ivrea, Vercelli, Pavian erhalten soll, von da den Fluss entlang bis an das Gebiet von Regii, Regii selbst und Cittannova, Modena bis zu den Grenzen des Heiligen Petrus. Diese Städte mit ihren Weichbildern und Gebieten, mit den dort bestehenden Grafschaften und alles, was einem nach Rom wandernden Manne zur Linken liegt, von dem Reichsteil des Pippin, dazu der Dukat von Spoleto, das alles soll, wie schon gesagt, Karl erhalten. Was aber von dem bezeichneten Relchsteil aus von den genannten Städten und Grafschaften einem nach Rom gehenden Manne zur Rechten liegt, das heißt der Rest von Transpadanien, dazu der Dukat von Tuszien bis ans Meer und bis zur Provence, werde Eigentum Ludwigs zur Vergrößerung seines Reichsanteils. Wenn aber Ludwig bei Lebzeiten der anderen stirbt, dann soll Pippin den Teil von Burgund, den wir Ludwigs Reich zugeteilt haben, mit der Provence und Septimanien oder Gothien bis nach Spanien hin erhalten, Karl aber Aquitanien und die Gascogne.
5. Falls aber einem der drei Brüder ein Sohn geboren werden sollte, den das Volk zum Nachfolger seines Vaters wählen möchte, dann ist es unser Wille, daß die Oheime dieses Knaben der Wahl zustimmen und den Sohn ihres Bruders in dem Teilreich, den sein Vater, ihr Bruder, besessen hat, herrschen lassen.
...
(Auszug aus dem 'Divisio regnorum' von 806)
Vergleicht man allerdings die in dieser Nachfolgeregelung den einzelnen Söhnen zugedachten Gebiete, so ist zu erkennen, dass von einer gleichwertigen Aufteilung keine Rede mehr sein kann: Dem ältesten Sohn Karl war mit Austrien und Neustrien, dem gesamten fränkischen Kernland, sowie zusätzlich Sachsen, Thüringen, Friesland und Teilen Baierns, der bedeutendste Reichsteil zugedacht. Ludwig schließlich, der jüngste Sohn, sollte bei seiner Nachfolgeregelung für das Gesamtreich schließlich noch einen Schritt weitergehen ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Technologie des MA
Bauwesen

Planung, Bauausführung und feine Gestaltung: der mittelalterliche Werkmeister
'Auf den großen Baustellen pflegt ein Hauptmeister zu sein, welcher nur durch das Wort anordnet, selten oder niemals legt er Hand an, und doch erhält er einen höheren Lohn als die anderen.'
...
(Auszug aus einer Predigt des Franziskanermönchs Nicolas de Byard, um 1260)
Wenn im Mittelalter bedeutende Bauwerke initiierte wurden, dann stets auf das Betreiben von finanzkräftigen Bauherren. Diese mochten Einzelpersonen sein, Könige, Fürsten, Päpste oder sonstige Mäzene, aber auch Kommunen, reiche Städte. Die erste Aufgabe bei der Errichtung, welche sich häufig genug über mehrere Jahr- zehnte hinziehen und somit auch ein Menschenleben überdauern konnte, bestand wohl in der Einrichtung ei- nes Verwaltungspostens für das Bauvorhaben. Oft genug handelte es sich dabei um ein angesehenes Mit- glied der betreffenden Kommune, ein Ratsmitglied vielleicht, welchem diese Aufgabe zufiel. So wählte etwa der Rat in Wien stets eines seiner angesehnsten Mitglieder zum Bauverwalter für den Stephansdom.
Dieser Auserwählte wurde meist für eine begrenzte Zeitdauer, oft für ein halbes oder ganzes Jahr, zum Leiter der Bauhütte (fabricia) gewählt und hatte als solcher die Baumaßnahmen finanziell und organisatorisch zu überwachen. Wenn er die ihm übertragenen Aufgaben zur Zufriedenheit erledigte, wurde seine Funktion nach Ablauf seiner Amtszeit in der Regel verlängert.

Mit der eigentlichen ausführenden - planerischen und handwerklichen - Tätigkeit am Bau hatte dieser, in den Quellen als magister operis, rector, provisor, procurator oder deutsch auch als Baumeister Bezeichnete, nicht direkt zu tun. Interessanterweise überliefern früh- und auch hochmittelalterliche Quellen bis etwa 1250 kaum die Namen der leitenden Handwerker, welche den Bau eigentlich geplant und die Baudurchführung überwacht und geleitet haben, sondern in erster Linie sind es die oben genannten Leiter der Bauverwaltungsaufgaben.
Jene Tätigkeit, die wir eigentlich mit dem Begriff des Baumeisters verbinden, nämlich die Planung und Durch- führung des eigentlichen Bauvorhabens, lässt sich in den mittelalterlichen Quellen oft nur schlecht von der des angesprochenen Bauverwalters unterscheiden, da die verwendeten Begriffe nicht einheitlich gebraucht wurden. Am ehesten noch scheint der Begriff des Werkmeisters für die oberste Instanz auf der Baustelle selbst zutreffend zu sein.
1180 wird im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der Kathedrale von Canterbury mit Wilhelm von Sens erstmalig ein Werkmeister namentlich und mit seinen Tätigkeiten genannt:
'Inzwischen suchten die Brüder Rat, wie und nach welcher Planung die niedergebrannte Kirche wiederher- gestellt werden könnte, aber sie fanden ihn nicht.
...
So wurden Kunstfertige (artifices) aus Frankreich und England zusammengerufen, aber selbst die stimmten nicht überein in ihrem Ratschlag.
...
Es kam aber unter den anderen Kunstfertigen einer aus Sens, Wilhelm genannt, ein ausgesprochen tüchtiger Mann, in Umgang mit Holz und Stein ein ganz besonderer Kunstfertiger. Diesen nahmen sie, indem sie die anderen fortschickten, wegen der Lebhaftigkeit seiner Erfindungsgabe und wegen seines guten Rufes auf.'
...
(Auszug aus aus einem Bericht des Gervasius von Canterbury, 1180)
Wie aus der Fortsetzung des Berichtes hervorgeht, erlitt Meister Wilhelm im Verlaufe der Bauausführung beim Einsturz eines Gerüstes schwere Verletzungen, von denen er sich nicht mehr erholte und die ihn schließlich zur Heimkehr nach Frankreich veranlassten. Aus dem Geschriebenen geht klar hervor, dass er die Bauaus- führung nicht nur leitete, sondern sich auf der Baustelle auch selbst aktiv beteiligte - ganz entgegen den Aussagen eines Nicolas de Byard in seinen Predigten.
Wie man sich nun den Aufstieg eines einfachen Mauerers und Zimmermanns, wie etwa des genannten Wilhelms, 'erfahren in Holz und Stein', zum Werkmaeister vorstellen kann, darüber gibt uns eine Stelle aus der Lebensgeschichte des Paderborner Bischofs Meinwerk, dessen Amtszeit ins frühe 11. Jahrhundert fällt, Auskunft:
...
Als aber die Handwerker tüchtig am Bau [des Paderborner Doms 1009 - 1015] beschäftigt waren, kam eines Tages ein Unbekannter, welcher den anwesenden Bischof demütig grüßte und ihm ergeben den Dienst antrug. Als ihn der Bischof fragte, in welcher Fertigkeit dieser Dienst bestehe, gab er an Maurer und Zimmermann zu sein; darauf wurde ihm vom Bischof befohlen, einen Nagel herzustellen, der gerade für eine Holzverbindung benötigt wurde. Als der schnell und mit raschen Handgriffen angemessen und passend gefertigt war, wurde er den Werkenden als Mitarbeiter zugesellt, und nachdem er durch sein Fachwissen als tüchtig anerkannt und durch jegliche Erfahrung ausgewiesen war, wurde er vom Bischof dem ganzen Werke vorgestellt.
...
(Auszug aus der Vita das Bischofs Meinwerk des Abdinghofer Abtes Konrad, um 1160)
Aus dem Geschriebenen lässt sich schließen, dass ein bauleitender Werkmeister aufgrund seiner Erfahrung und seiner Fertigkleiten in seine Position gelangte. Damit scheint aber auch klar zu sein, das kaum einer die- ser von der einfachen Handwerkertätigkeit aufgestiegenen Männer des Lesens und Schreibens mächtig ge- wesen ist, schon gar nicht war er in der Lage das Latein der gelehrten, aus antiker Zeit überkommener Schrif- ten zu verstehen. Die Attribute des Werkmeisters, die ihn in bildlichen Darstellungen charakterisierten, waren folgerichtig auch Zirkel und Richtscheit, die Werkzeuge des Steinmetzes und Zimmermannes.
Planung des Baus und Ausführung waren zum damaligen Zeitpunkt noch in einer Hand. Eine Aufspaltung, wie wir sie heute in der Trennung zwischen dem planenden Architekten und dem ausführenden Ingenieur erken- nen, gab es nicht. Natürlich mussten die Vorgaben des Bauherren eingehalten werden. Ebenso gab es schon die Probleme, über die auch in heutiger Zeit noch geklagt wird: Überhöhte Kosten, überlange Bauzeit, Korrup- tion und Begünstigung, Sparmaßnahmen an der falschen Stelle, unwillige Handwerker und manch anderes noch.
Ist es aber tatsächlich vorstellbar, dass die vielen großartigen Bauten des Mittelalters, die hochstrebenden, filigranen gotischen Kathedralen, die mächtigen Kuppelbauten, einzig auf praktischer Erfahrung ihrer Erbauer beruhen und es zu ihrer Errichtung dazu keinerlei statischer Berechnungsmethoden bedurfte? Es scheint so, sind doch für das gesamte Früh- und Hochmittelalter keinerlei Schriften derartigen Inhalts bezeugt.
Dennoch zeigen moderne Überprüfungen gotischer Kathedralen mit sehr schlankem Strebewerk und dünnen Pfeilern, welche tragendes Mauerwerk zu ersetzen hatten, dass diese angemessen dimensioniert waren (und sind). Eine beeindruckende Leistung. Allerdings zeigte sich auch, dass an manchen Bauten Korrekturen wäh- rend des Baus vorgenommen wurden, welche durch das Auftreten von Schäden und Mängeln - etwa Rissen - erforderlich wurden. Manchmal geschahen diese Änderungen überhaupt erst nach Einstürzen, was beim be- mitleidenswerten Bauherren wohl den einen oder anderen besorgten Blick in sein Geldsäckel bewirkte.
Interessiert euch, wie die Werkmeister ihr Handwerk erlernten? Dann klickt zum Artikel über die Ausbildung zum Steinmetz und Dombaumeister.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Das Frankenreich
Frühmittelalter

Geschichtsschreibung im frühen Mittelalter - Die Annalen: Ereignisse in Jahrbüchern
Als sich am Hofe Karls des Großen eine Gruppe von Gelehrten sammelte, konzentrierten sich die Interessen dieser Männer hauptsächlich auf dem Studium der älteren Literatur, wie sie aus der Antike überkommen war, auf philosophische und theologische Fragen, an den septem artes liberales, den sieben freien Künsten. An Ge- schichtsschreibung oder geschichtlicher Forschung waren sie zumeist wenig interessiert.
Zwar gab es in den verschiedene Klöstern mit den sogenannten Annalen oder Jahrbüchern notizenhafte Auf- zeichnungen, die von Brüdern über Generationen hinweg geführt wurden. Ursprünglich wohl zur Berechnung wichtiger Termine gedacht (Ostern), wurden in ihnen auch wichtige Ereignisse verzeichnet, welche für die Ge- meinschaft von Bedeutung waren: Naturkatastrophen, Kriege und Todesfälle. Die Erfassung derartiger Vor- kommnisse in der zeitlichen Reihenfolge ihres Geschehens ergab tagebuchartigen Aufzeichnungen, die äus -serst kurz und lapidar gehalten waren. Die Enge des klösterlichen Blickfeldes bedingte, dass in diesen Werke oft nur Meldungen lokaler Natur verzeichnet waren, neben wenigen anderen, welche dem Schreiber durch Reisende zugetragen worden sein mochten.

Andererseits hatten Große des Reiches , die Bischöfe vor allem aber auch weltliche Würdenträger, die Not- wendigkeit erkannt, den Übersicht über Geschehnisse von Bedeutung zu behalten, etwa die regelmäßigen Teilnahmen an Reichstagen und Heerzügen, und so veranlassten sie ihre Schreibkundigen, die Kleriker, zur Aufzeichnung. So war mancherorts aus dürftigen annalistischen Aufzeichnungen schon der Ansatz zu einer Reichsgeschichtsschreibung zu erkennen.
Auch der Herrscher selbst, Karl, erkannte die Wichtigkeit derartiger Aufzeichnungen und legte den Grundstein für deren sorgfältige Archivierung. So verordnete er, dass die Kapitularien, die Gesetze und Beschlüsse der Reichstage seiner Zeit aufbewahrt werden sollte. Eingedenk der Gefahren, die archivierten Schriften drohten, etwa durch Brand, sollte diese Aufbewahrung in mehreren Exemplaren und und an verschiedenen Orten er- folgen.
Dieser Einsicht des Kaisers in die Wichtigkeit gewisser Dokumente verdanken wir ein eigenes Buch, das aller- dings nur noch teilweise erhalten ist, und das eine wichtige Geschichtsquelle für diese Zeitepoche darstellt: Im Codex Carolinus sind die Schreiben der Päpste und der griechischen Kaiser an Karl, seinen Vater und Groß- vater zusammengefasst.
Im Laufe der Zeit gewannen die Jahrbücher zusammenhängende Gestalt, auch dadurch, dass ihre Informa- tionen mit Hilfe anderer Annalen, teils auch älterer Herkunft, ergänzt wurden. Unter diesen Jahrbüchern stechen die sogenannten Annales regni Francorum, die Reichsannalen oder großen Lorscher Annalen, wie sie früher nach ihrem Fundort, dem Kloster Lorsch, benannt wurden, hervor. In ihnen werden Ereignisse aufgelis- tet, welche sich zwischen 742 und 829 zugetragen haben, und wie sie auszugsweise hier wiedergegeben werden sollen:
...
743:
Karlmann und Pippin zogen mit vereinten Streitkräften gegen Odilo, den Herzog der Baiern, und schlugen sein Heer in
einem Treffen. Nach ihrer Rückkehr zog Karlmann allein nach Sachsen, wo sich ihm die Burg Hohseoburg und in ihr der
Sachse Theoderich, der Hauptmann dieses Orts, ergab.
744:
Die beiden Brüder Karlmann und Pippin zogen mit vereinten Kräften nach Sachsen, worauf sich ihnen Theoderich abermals
unterwarf.
...
(Auszug aus den Reichsannalen, für die Jahre 743 und 744)
Man nimmt an, dass der erste der Verfasser, seine Aufzeichnungen um 790 begann, die ersten etwa fünzig Jahre also rückblickend geschaffen wurden und dann in weiterer Folge mehr oder weniger fortlaufend mit den aktuellen Ereignissen dokumentiert wurde. Daraus erklärt sich einerseits die Kürze, mit der zurückliegende Er- eignisse geschildert werden, andererseits die zunehmende Detaildichte der späteren Eintragungen, wie der folgende Auszug verdeutlicht:
...
804:
Der Kaiser brachte den Winter in Aachen zu. Im Sommer aber zog er mit einem Heere nach Sachsen und führte alle Sachsen,
welche jenseits der Elbe und in Wihmuodi wohnten, mit Weib und Kind ins Frankenland ab und gab die Gaue jenseits der Elbe
den Abodriten. Zu derselben Zeit kam Godofrid der Dänenkönig mit seiner Flotte und der ganzen Ritterschaft seines Reichs nach
Sliesthorp auf der Grenze seines Gebiets und Sachsens. Er hatte nämlich versprochen, zu einer Unterredung mit dem Kaiser
zu kommen, aber er ließ sich durch den Rat seiner Leute abhalten weiter zu gehen. Der Kaiser lagerte zu Holdunsteti an der
Elbe, ließ von da eine Gesandtschaft an Godofrid abgehen wegen Auslieferung der Überläufer und kam um die Mitte Septembers
wieder nach Köln zurück. Nachdem er das Heer entlassen hatte, zog er über Aachen in die Ardennen auf die Jagd und kehrte dann
nach Aachen zurück. Um die Mitte Novembers erhielt er die Nachricht, daß Papst Leo Weihnachten mit ihm zu feiern wünsche,
an welchem Orte dies möglich wäre. Er schickte nun sogleich seinen Sohn Karl nach dem Kloster des heiligen Moritz und
ließ ihn ehrenvoll empfangen. Er selbst zog ihm nach der Stadt Remi entgegen, wo er mit ihm zusammentraf. Hierauf geleitete
er ihn über Carisiacus, wo Weihnachten gefeiert wurde, nach Aachen, machte ihm große Geschenke und ließ ihn dann seinem
Wunsche gemäß über Baiern nach Ravenna geleiten. Die Veranlassung seiner Reise war folgende: Der Kaiser hatte im vorigen
Sommer gehört, daß in der Stadt Mantua Blut Christi aufgefunden worden sei, und sich hierauf an den Papst gewandt mit der
Bitte, die Wahrheit dieses Gerüchts zu prüfen. Der Papst benutzte diese Gelegenheit, reiste zuerst nach Langobardien, um jene
Sache zu untersuchen, und kam dann von da plötzlich zu dem Kaiser. Acht Tage verweilte er bei ihm und kehrte dann wie schon
gesagt nach Rom zurück.
...
(Auszug aus den Reichsannalen, für das Jahr 804)
Welche historische Gestalten sich hinter den verschiedenen Autoren, deren Wechsel sich in mancherlei Stil- brüchen nachvollziehen lässt, verbergen, darüber besteht keinerlei Einigkeit. So wurde Einhard genannt, der Gelehrte und Biograph Karls, der in der Nachfolge des großen Alkuins die Hofschule leitete, und obwohl große Zweifel an dessen Autorenschaft bestehen findet sich immer noch die Bezeichnung Einhards Jahrbücher ....
Nach dem Wiederauffinden der Reichsannalen in Lorsch hatte man ursprünglich angenommen, dass auch dieses Werk in der klösterlichen Abgeschiedenheit von Brüdern der Gemeinschaft geschaffen worden wäre. Von dieser Vorstellung ist man mittlerweile abgekommen: Zuviel an Information ist in den Aufzeichnungen enthalten.
Vielmehr meint man nun, die Entstehung dem Hofe Karls selbst zuzuorden können, Männern, die dem Zen- trum der Entscheidungsfindungen nahestanden. Dafür spricht die Fülle an Informationen, die Auflistung der Heerzüge, die Zusammensetzung der Truppen, die Angabe ihrer Befehlshaber. Was aber stützt die Meinung, man hätte es mit einer 'offiziellen' Reichsgeschichtsschreibung zu tun, die im Auftrage Karls geschaffen wor- den war oder zumindest von ihm angeregt? Nun, das meint man aus der Tatsache zu erkennen, dass die Reichsannalen tendenziell gefärbt sind. Manche Ereignisse, von denen man aus anderer Hand weiß, werden ausgespart - dann vornehmlich, wenn es sich um solche handelt, die ein unschönes Bild auf die karolingischen Herrscher werfen könnten - große Unglücksfälle, Verschwörungen, Unruhen ...
Nicht Neues unter der Sonne also. Denn sowohl früher, man denke da nur an die großen Felsinschriften altori- entalischer Potentaten, wie auch später, Prawda und diverse Parteizeitungen lassen grüßen, waren und sind derartige Praktiken durchaus gebräuchlich ... Ob diese Färbung befohlen war oder in vorauseilendem Gehor- sam geschah, bleibt dahingestellt.
So sind die Reichsannalen inhaltlich für uns mit Vorsicht zu genießen. Manches werden wir bei genauerer Be- trachtung als parteilich erkennen, als Rechtfertigung für eigene Aggressionen ... Nichtsdestoweniger bleiben sie eine unersetzliche Quelle für diese Zeitepoche und der Ausgangspunkt für das Wiederentstehen einer Geschichtsschreibung ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Das Frankenreich
Frühmittelalter

Das Heerwesen zur Zeit Karl des Großen - Teil 2
Zum ersten Teil der Artikelserie: Das Heerwesen zur Zeit Karl des Großen
Angeführt und zu den Sammelpunkten gebracht wurden die jeweiligen Teilaufgebote des Heeres von den Grafen und Großen des Landes. Im Falle Karls des Großen war es häufig der König beziehungsweise Kaiser selbst, welcher das Heer in die Schlacht führte. Doch finden sich in den Annalen der damaligen Zeit auch die Inhaber der bedeutenden Hofämter als fränkische Befehlshaber (so, dass sich aus dem Begriff des Sene- schall/Seneschalk, was ja ursprünglich den Aufseher über die königlichen Ställe meinte, später die Bezeich- nung Marschall für wichtige Befehlshaber zu Felde einbürgern konnte; man denke beispielsweise an den Feldmarschall).
Doch nicht nur weltliche Würdenträger hatten Männer beizustellen. Auch die hohe Geistlichkeit, wie etwa Bi- schöfe und Äbte, waren verpflichtet mit ihren Mitteln zum Aufgebot beizutragen, wie uns etwa ein Brief Karls an den Abt Fulrad des bedeutenden Klosters St. Denis zeigt. Interessant zu lesen ist, wie detailiert der Karl seinen Gefolgsleuten Anweisungen übermittelte und dabei jede Kleinigkeit berücksichtigte.

So findet sich eine genaue Auflistung über die Ausrüstung, mit der jeder Gefolgsmann des Abtes versehen sein sollte. Insbesondere entdecken wir darin eine Auflistung der Waffen, aber auch der Werkzeuge, die für Schanz- und Belagerungsarbeiten benötigt werden:
...
Wir teilen dir mit, dass dass wir in diesem Jahr den großen Reichstag nach Ostsachsen zusammengerufen haben, und zwar nach Straßfurt an der Bode. Deshalb befehlen wir dir, am 17. Juni mit allen deinen wohlbewaffneten und ausgerüsteten Leuten an dem genannten Platze dich einzustellen, also sieben Tage vor der Messe des heiligen Johannes des Täufers. Du wirst also wohlvorbereitet mit deinen Leuten auf dem genannten Platze erscheinen, um von hier aus, wohin dich auch unser Befehl schicken mag, eine militärische Expidition durchzuführen; das heißt mit Waffen und Gerät und aller anderer kriegerischer Ausrüstung, mit Proviant und Bekleidung. Jeder Berittene soll Schild, Lanze, Schwert und Hirschfänger haben, dazu Bogen, Köcher mit Pfeilen. Eure Packwagen sollen Vorräte aller Art mitführen, Spitzhacken und Äxte, Bohrer, Beile, Spaten, eiserne Grabscheite und alle anderen Werkzeuge, die man bei einem Feldzug braucht. Die Lebensmittel müssen vom Reichstage an gerechnet für drei Monate ausreichen, Waffen und Bekleidung für ein halbes Jahr
...
(Auszug aus einem Brief Karl des Großen an den Abt Fulrad von St. Denis, zwischen 804 und 811)
Wie man sieht, war zu jenen Zeiten eine genaue Reiseplanung unabdinglich, schließlich galt es unter Umständen halb Europa zu durchqueren, um fristgerecht auf den Tag genau am Reichstag einzutreffen.
Für uns ist es schwer verständlich, dass sich der Kaiser in seinen Einberufungsschreibungen selbst um derar- tige 'Kleinigkeiten' kümmern muss. Unmittelbar verständlich wird diese Vorgangsweise aber dann, wenn man sich vor Augen hält, dass es zu der damaligen Zeit eben kein Berufsstreitkräfte gab, sondern der Heerbann sich mehrheitlich aus den freien Bauern zusammensetzte. Wollte man den Erfolg eines Feldzuges nicht durch unzureichend ausgerüstete Teilnehmer gefährden, so waren eben entsprechend genaue Anweisungen zu geben.
Aus diesen Anweisungen geht aber auch deutlich hervor, warum derartige Kriegszüge solch große Belastung- en für den einzelnen Teilnehmer darstellten: Da waren die Kosten für Pferd, Waffen, Ausrüstung und Lebens- mittel, die Feldzüge selbst konnten sich über mehrere Monate hinziehen, wodurch die Arbeitsleistung am hei- matlichen Hof entfiel. Ganz abgesehen vom Risiko im Kampf verwundet oder getötet zu werden. Wolgemerkt, der Aufruf war verpflichtend und konnte nicht ignoriert werden, wollte man Sanktionen vermeiden. Grund genug für viele Bauern, sich in die Unfreiheit zu flüchten.
Natürlich bestand für derartige Heerhaufen, welche sich aus allen Ecken des Frankenreiches zum Reichstag aufmachten, stets die Verlockung, sich aus den Ställen und Scheunen der Landbevölkerung zu bedienen, speziell dann, wenn man die heimatliche Umgebung bereits verlassen hatte und durch fremdes Gebiet zog. Strenge Anweisungen an die Führer der einzelnen Aufgebote sollten derartige Übergriffe verhindern, wie der folgende Auszug aus dem selben Brief zeigt:
...
Wir befehlen dir, streng darauf zu achten, dass du in Ruhe und Frieden den genannten Ort erreichst, durch welche Teile unseres Reiches dein Marsch dich auch führen mag. Außer Grünfutter, Holz und Wasser mögen keinerlei Vorräte angerührt werden. Durch welchen Besitz eure Männer mit Packwägen und Pferden gerade marschieren, der soll immer dabei sein, auf dass nicht die Abwesenheit des Herrn seinen Besitz den Leuten preisgibt, um Unheil anzurichten und das soll bis zur Ankunft am Ziel gelten.
...
(Auszug aus einem Brief Karl des Großen an den Abt Fulrad von St. Denis, zwischen 804 und 811)
Ob derartige Ermahnungen immer von Erfolg gekrönt waren, bleibe dahingestellt, schließlich verringert alles, was man sich auf einem derartigen Zug von anderer Seite 'organisiert' die eigenen Aufwändungen. Allein das Vorhandensein dieser Passage zeigt, dass der Kaiser seinen guten Männern nicht uneingeschränkt traute ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Das Frankenreich
Frühmittelalter

Das Heerwesen zur Zeit Karl des Großen - Teil 1
Wie bei allen germanischen Völkern wurde auch bei den Franken das Heer durch das Aufgebot der freien Männer gestellt, welche überwiegend Bauern waren und die zu Fuß kämpften. Unter den Merowingern hatte jeder Freie hatte die Pflicht, sich an einem Kriegszug seines Königs zu beteiligen und die dazu benötigte Aus- rüstung bereitzustellen. Dies stellte in Zeiten häufiger Wirren bereits eine beträchtliche Belastung des Ein- zelnen dar, mussten doch nicht nur die Kosten getragen werden, sondern ging zudem noch die Arbeitskraft am heimatlichen Hof für die Dauer der kriegerischen Unternehmung verloren.
Mit Beginn des 8. Jahrhunderts änderte sich die Charkteristik des fränkischen Heeres - wohl auch als Reaktion auf die Auseinandersetzung mit anderen Völkern. Als nämlich die Araber, die 711 in Spanien gelandet waren, das westgotische Reich zerschlagen und den Großteil des Landes erobert hatten, sich anschickten ihre Plün- derungszüge ins benachbarte Gallien auszudehnen, sahen sich die Franken mit einem Male einem Gegner ge- genüber, dessen Taktik im Gefecht der eigenen vollständig entgegengesetzt war. Anstatt auf eine Phalanx von engstehenden und dichtgestaffelten Kämpfern zu Fuß zu vertrauen, welche sich gegenseitig Schutz bo- ten, setzten sich die Hauptstreitkräfte der Mauren aus leichter, beweglicher Reiterei zusammen, hervorragen- den Bogenschützen, welche von einem nichtberittenen Gegner kaum zu bekämpfen waren.

Obwohl beispielsweise in der berühmten Schlacht von Tours und Poitiers, in welcher der Majordomus Karl Martell der arabischen Expansion Einhalt gebot, die bäuerlichen Fußtruppen immer noch das Gros der frän- kischen Streitmacht stellten, traten nun auch im fränkischen Heer Reiterkrieger zunehmend in Erscheinung. Schwerer gerüstet als ihre arabischen Gegner, waren sie aber auch weniger beweglich als diese. Dieser Ge- gensatz zwischen schwer gepanzerter abendländischer Reiterei und leichter morgenländischer sollte auch in den folgenden Jahrhunderten bestehenbleiben, wobei die zahllosen Gefechten im heißen Outremer stets wechselnde Sieger sahen.
Die Ausrüstung eines schwerbewaffneten Reiterkriegers, Panzer, Pferd und Waffen, war teuer und überstieg die finanziellen Möglichkeiten vieler Freier, zudem erforderte der Kampf zu Pferd fortlaufendes Training und die dafür benötigte verfügbare Zeit. Dies hatte zur Folge, dass der ursprünglich freie Bauernstand wegen Überschuldung zunehmend in Unfreiheit geriet. Oder sich freiwillig in kirchliche Abhängigkeit begab, nur um dem erdrückenden Kriegsdienst zu entgehen. Schließlich führte Karl der Große über den Großteil seiner Herr- schaftsdauer hinweg nahezu jährlich Kriegszüge an.
In jene Zeit fallen die Anfänge eines berittenen Berufskriegertums, welches sich den Krieg leisten konnte und das für seine Dienste mit Land belohnt wurde, dessen Nutznießung den teuren 'Beruf' ermöglichte - dem Lehen. Dass sich diese Spezialisten, in denen man die Vorläufer des späteren Ritters erkennen kann, zuneh- mend als Elite sahen, dessen Lebenszweck der Kampf war, während der Bauer für die Versorgung zu werken hatte, ist nur verständlich.
Karl erkannte diese Probleme der zunehmenden Flucht in die Unfreiheit - freiwillig oder erzwungen - und suchte der Entwicklung gegen Ende seiner Regierungszeit durch königliche Verordnungen (sogenannte Kapitularien) entgegenzusteuern. Etwa dadurch, dass die Last des Kriegsdienstes auf mehrere Kleinbauern aufgeteilt werden sollte, von denen dann nur einer stellvertretend ins Heer einrücken musste, wie im folgenden Ausschnitt aus einem aus dem Jahre 808 erlassenen Kapitular über das Heerwesen ersichtlich wird:
...
Jeder Freie, der vier Hufen freies Land zu eigen oder von irgend jemand zu Lehen hat, muss sich bereithalten und in eigener Person ins Feld ziehen und zwar mit seinem Herrn, wenn dieser ebenfalls auszieht, oder mit seinem Grafen. Wer drei Hufen besitzt, werde mit einem anderen verbunden, der nur eine Hufe hat und ihm Unterstützung geben soll, damit dieser für beide ausziehen kann. Wer aber nur zwei Hufen zu eigen hat, werde mit einem anderen zusammengetan, der ebenfalls zwei Hufe besitzt und einer von ihnen rücke mit der Unterstüt- zung des anderen aus. Wer aber eine einzige Hufe besitzt, mit dem sollen drei andere zusammengetan werden, die auch nur eine haben und einer soll ausrücken, die anderen ihn aber unterstützen. Die drei aber, die ihn unterstützen, sollen zu Hause bleiben.
...
(Auszug aus dem Kapitular Karls über das Heerwesen, aus dem Jahre 808)
Offensichtlich gab es trotz alledem Versuche, sich der Verpflichtung nach dem Kriegsdienst zu entziehen, denn Karl sah sich im selben Erlass genötigt, seinen Königsboten (den missi dominici) Anweisungen zu geben, wie derartige 'Verweigerungen' zu ahnden seien:
...
Wir wünschen und befehlen, dass unsere missi sorgfältig untersuchen, wer sich im vergangenen Jahr der Dienstpflicht entzogen hat über die Anordnung hinaus, die wir oben für Freie und Arme anzuwenden empfohlen haben; und wer dabei angetroffen wird, dass er seinen Mann beim Ausmarsch nicht unserem Befehl entsprech- end unterstützt hat, der hat Strafe für unseren Heerbann zu zahlen, und er soll die volle Buße nach dem Gesetz erlegen.
...
(Auszug aus dem Kapitular Karls über das Heerwesen, aus dem Jahre 808)
Langfristigen Erfolg zeitigten die Maßnahmen nicht, die Entwicklung des schwerbewaffneten, berittenen Elite- kriegers auf der Basis des Lehenssystems machte rasche Fortschritte und so finden sich im bereits 12. Jahr- hundert kaum noch freie Bauern, sieht man einmal von gewissen, etwa alpinen Gegenden ab ...
Weiter zweiten Teil der Artikelserie: Das Heerwesen zur Zeit Karl des Großen
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Höfisches Leben

Die Hofämter - Teil 3 : Karriere eines Emporkömmlings
Zum ersten Teil der Artikelserie: Die Hofämter - Teil 1
Zum zweiten Teil der Artikelserie: Die Hofämter - Teil 2
Einfluss und Macht waren in Europa über viele Jahrhunderte hinweg adeligen Geschlechtern vorbehalten. Dies gilt in besonderem Ausmaß auch für das Mittelalter. Dabei ist es gar nicht so einfach, den Stand des Adels zu definieren, insbesondere auch zu erklären, warum bestimmte Familien Vorrechte vor ihren Volksgenossen er- langen konnten. Auch gelang es zu allen Zeiten Einzelnen immer wieder für sich und die ihrigen eine Verbes- serung des Standes zu erreichen. Die Grenzen zwischen Adel und gemeinem Volk konnten manchmal durch- lässig werden ...
Bei vielen Völkern und auf allen Kontinenten findet sich die Erscheinung, dass gewisse Familien beziehungs- weise Sippen besonderes Ansehen und damit verbunden besondere Vorrechte besitzen. Aus den Reihen die- ser 'Ausgezeichneten' wird häufig der König gewählt, ihre Mitglieder führen in Kriegszeiten die Kämpfer an, vielfach sind sie auch an Besitztum herausragend. Wie und wieso es anscheinend überall und zu allen Zeiten zur Herausbildung einer derartigen Führungsschicht kam, ist ein Thema, dass eine eigene Artikelserie recht- fertigen würde. Hier an dieser Stelle wollen wir nur einen Blick auf das frühe europäische Mittelalter machen.
Diese Epoche, in der es zur Ablösung der römischen Herrschaft durch germanische Eroberer und in Folge zur Etablierung germanscher Nachfolgestaaten kam, war eine Zeit großer Umbrüche. Von all den Staaten, die sich auf ehemals weströmischen Reichsgebiet bildeten, hatte nur jenes der Franken Bestand, während die Herr- schaftsbildungen der Vandalen in Nordafrika, jene der Ostgoten und später der Langobarden in Italien und auch das Reich der Westgoten über kurz oder lang wieder zerfallen waren. Jedoch war überall ein stetes Rin- gen zwischen König und Adel, zwischen Zentralgewalt und lokalen Herren zu beobachten, bei dem das Pen- del in die eine oder andere Richtung ausschlagen konnte; so hatte etwa das Langobardenreich stets darun- ter zu leiden, dass sich keine starke Königsgewalt gegen die Grafen etablieren konnte.
Entscheidend war immer auch die Persönlichkeit des jeweiligen Herrschers: So waren die Nachfolger Karl des Großen häufig Spielbälle jener einflussreichen Kreise, die Karl selbst noch weitgehend kontrollieren konnte. Wichtig für einen König war es auch, bestimmte einflussreiche Positionen, wie etwa jene der Hofämter, mit vertrauenswürdigen Personen zu besetzen - so geschehen etwa, als sich die Karolinger in der Auseinander- setzung um das Amt des 'major domus' endgültig durchgesetzt hatten und in Folge viele ihrer Anhänger aus den angestammten Herrschaftsgebieten in Schlüsselstellungen vorrückten.
Diese 'Ernennungen' bildeten somit einen Möglichkeit zum sozialen Aufstieg. Man könnte in diesem Zusam- menhang von der Etablierung eines dienstadeligen Standes sprechen, wie dies auch im hohen Mittelalter mit dem Ministerialienwesen noch gebräuchliche Praxis der Herrschenden war. Derartige Aufsteiger konnten bei entsprechender Befähigung großen Einfluss gewinnen - man denke etwa an Markward von Annweiler, den Reichstruchsess Kaiser Heinrich IV und späteren Regenten Siziliens - und sie waren ihrem Herrn in der Regel treu ergeben, da sie ihm ihren Aufstieg ver- dankten.
Im Gegensatz zu diesen Dienstleuten stand der Geburtsadel. Letzterer rekrutierte sich, wie etwa im frühren Frankenreich, einerseits aus den angesehenen Familien der Barbaren. Andererseits waren es mächtige gallo- römische Provinzbeamte, die in Gallien ausgedehnte Ländereien besessen und diese in den Wirren der Völ- kerwanderungszeit bereits wie lokale Fürsten verwaltet hatten, die sich nun mit den neuen Machthabern arrangierten. Zum beiderseitigen Nutzen, da die Eroberer so auf funktionierende Strukturen zurückgreifen, die Alteingesessenen hingegen ihren Einflusß weitgehend behalten konnten. So finden sich auch auf den einflussreichen Positionen der fränkischen Kirche zumeist Angehörige dieser Klasse. Des Lesens und Schrei- bens kundig, mit dem Land vertraut, waren sie befähigt, Organisations- und Verwaltungsaufgaben zu über- nehmen und damit bestens geeignet, um einflussreiche Posten auszufüllen. Das Interesse dieser Schicht musste es sein, das Königtum nicht zu stark zu werden zu lassen, um auf keinen Machtverlust hinnehmen zu müssen.
Gregor von Tours ist einer jener Abkömmlinge aus gallorömischen Adel, welcher uns schreibgewandt in seiner Historia Francorum wichtige Ereignisse aus dem Frankenreich der frühen Merowinger überliefert. Darin findet sich auch ein Abschnitt, in dem er über den Aufstieg eines ursprünglich Unfreien in die Position des Marschalls und später in die Grafenposition zu berichten weiß:
An der Küste von Poitou liegt eine Insel, mit Namen Cracina , dort wurde er (Anm.: Leudast, der spätere Graf von Tours) geboren, sein Vater war Leucadius, der Knecht eines königlichen Winzers. Er wurde alsdann für den Dienst ausgehoben und der königlichen Küche zugeteilt. Da er jedoch in seiner Jugend triefäugig war, und deshalb der Rauch ihm die Augen schmerzen machte, nahm man ihn vom Topfe und brachte ihn an den Backtrog. Da tat er nun so, als ob er bei seinem Sauerteig sich ganz wohl befände, aber im Stillen dachte er auf Flucht und entkam auch wirklich dem Dienst. Als er zwei oder dreimal bereits so entwischt und wieder eingeholt war, und man ihn nicht anders von einer abermaligen Flucht zurückhalten konnte, kerbte man ihm endlich zur Strafe das eine Ohr ein. Doch floh er abermals, als er schon dies Schandmal an sich trug und auf keine Weise verbergen konnte, zur Königin Marcovefa, welcher König Charibert ganz ergeben war und sie statt ihrer Schwester seinem Lager beigesellt hatte. Diese nahm sich gern seiner an, beförderte ihn und machte ihn zum Aufseher über ihre besseren Pferde. Seitdem wurde er von Eitelkeit und Hochmut geplagt und wollte ihr Marschall werden. Er erlangte dies auch und fing nun an auf alle herabzusehen und Jedermann gering zu achten, blähte sich in eitlem Stolze gewaltig auf und überließ sich zügelloser Schwelgerei und allen Lüsten. In Sachen seiner Gebieterin wurde er, als ihr besonderer Schützling, auch bald hierhin bald dorthin gesandt. Bei ihrem Tode war er durch Erpressungen bereits reich geworden, und es gelang ihm durch Geschenke, die er König Charibert machte, seine Stelle bei ihm zu behaupten.
Später wurde er zur Strafe für unsere Sündenschuld als Graf nach Tours geschickt. Dort brüstete er sich noch mehr in dem eitlen
Gefühl seiner hohen Würde, zeigte sich überdies als einen Räuber und Blutsauger, einen Händelsucher und schmutzigen Ehebrecher und
scharrte sich durch das Anstiften von Zwietracht und Angebereien ein nicht unbedeutendes Vermögen zusammen.
(Gregor von Tours, Historia Francorum - Fünftes Buch, Kapitel 48)
Gelang es also, das Vertrauen einer hochgestellten Persönlichkeit, wie im beschriebenen Fall jenes der Köni- gin am Hof, zu gewinnen, war ein Aufstieg in höchste Positionen möglich. Insbesondere jene Zeiten, in denen die Machtbereiche der merowingischen Teilkönige stets heiß umkämpft waren und sich häufig änderten, ließen Raum für den Aufstieg manch eines Wagemutigen. Tatsächlich bestand der Marschalldienst, von dem die Rede war, vordergründig in der Beaufsichtigung der königlichen Ställe. Zugleich geht aus Gregors Schilderung aber hervor, dass Vertrauenspersonen der Herrschenden, und nur solche bekleideten derart wichtige Ämter, jeder- zeit auch für andere Aufgaben eingesetzt werden konnten, etwa als Boten in wichtigen Angelegenheiten oder als Heerführer.
Angemerkt sei auch noch, dass es sich bei dem beschriebenen Leudast um keinen Freund Gregors handelte - was ja bereits aus dem zitierten Textbeispiel ersichtlich wird. Hatte doch Gregor einige Zeit mit Verleumdun- gen zu kämpfen, welche Leudast über ihn verbreitete. Doch mit einem frommen Kirchenmanne lege man sich tunlichst nicht an - besonders dann nicht, wenn der eine spitze Feder zu führen imstande ist wie Gregor. Denn sonst steht man vor der Geschichte schnell als Halunke und Ehebrecher da ..
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Das Frankenreich
Frühmittelalter

Missi dominici - die Königsboten Karl des Großen
Als Karl der Große im Jahre 800 zum Kaiser gekrönt wurde, herrschte er über ein riesiges Gebiet. In nahezu jährlichen Kriegsoperationen hatte er als Schutzherr des Papstes das italienische Langobardenreich, den Titel des Königs der Langobarden und die eiserne Krone erobert. Bayern war mit der Entmachtung und Entfernung Herzog Tassilos wieder botmäßig geworden und blutige Feldzüge und Zwangsumsiedlungen hatten auch die letzten Aufstände der Sachsen erstickt. Das Reich war befriedet und nun konnte sich der Kaiser daran ma- chen, inneren Frieden und Gerechtigkeit sicherzustellen, Witwen, Waisen und Schwachen vor Willkür zu schützen, ganz so, wie dies ein christlicher Herrscher dem Verständnis der Zeitgenossen nach zu tun hatte.
Doch die Zustände hatten sich seit den Tagen des römischen Weltreiches geändert: Karl verfügte nicht mehr über die straffe Verwaltung und die funktionierende Bürokratie des Imperiums. Die Schriftlichkeit war in vielen Bereichen verlorengegangen und in Ermangelung an Geld war man wieder zur Naturalwirtschaft übergegan- gen. Die Verkehrsverbindungen in den weitläufigen Gebieten ermöglichten keine rasche Nachrichtenübermitt- lung und schon gar keinen großräumigen Gütertransport. Dort wo intakte Straßen verliefen, stammten sie zum überwiegenden Ausmaß noch aus der römischen Epoche. In den 'neuen' Gebieten, jenen Ländern, wel- che niemals Rom zugehörig waren, sah die Situation noch viel schlechter aus.

Auf den Punkt gebracht: Karl war der Herr über ein riesiges Gebiet, zu dessen Verwaltung den frühmittelalter- lichen europäischen Völkern die geeigneten Mittel fehlten. Byzanz, mit seiner Tradition und seiner ausgebilde- ten Beamtenschaft konnte derartiges bewerkstelligen, nicht jedoch das Frankenreich. Damit war eine Teilung, wie sie nur wenige Jahrzehnte später aus dynastischen Gründen dann tatsächlich erfolgte, nur eine Frage der Zeit.
Doch noch hielt die starke Persönlichkeit des Eroberers und Begründers alles zusammen. Karl war sich der Probleme wohl bewusst: Die königliche Macht beruhte wesentlich in der physischen Präsenz in den verschie- denen Reichsteilen und der Zurschaustellung von Glanz und Reichtum. Darum reiste der Kaiser samt Frauen - ja, Frauen, denn Karl wollte Zeit seines Lebens auch stets seine Töchter um sich haben - und Hofstaat stets von einer Pfalz zur nächsten, wenn es auch mit Aachen in den späteren Lebensjahren eine bevorzugte gab. Reichsversammlungen waren abzuhalten, Rechtsstreitigkeiten zu schlichten.
Trotz aller Tatkraft konnte er nicht überall präsent sein. Dies erforderte die Einsetzung von lokalen Vertretern, welche in des Kaisers Abwesenheit die Gerichtsbarkeit innehatten, und in Krisenzeiten für den Schutz der Be- völkerung zu sorgen mussten. Diese Grafen oder Amtmänner, wie sie in den Kapitularien auch bezeichnet werden, die im Auftrag des Herrschers das Reich zu verwalten hatten, wussten den Kaiser sehr häufig in weiter Ferne. Und wie immer, wenn es an ausreichender Kontrolle fehlt, war der Anreiz für diese lokalen Machthaber groß, die Position für eigene Zwecke zu missbauchen: Ungerechtfertigte Abgaben, Frondienste über Gebühr, Bevorzugung eigener Klientel in Streitigkeiten - all dies dürfte an der Tagesordnung gestanden haben, denn es finden sich zahlreiche Hinweise darauf in den Kapitularien, mit denen der Herrscher die Miss- stände zu bekämpfen versuchte. Offensichtlich kaum mit durchschlagendem Erfolg.
Im Jahre 802 erließ Karl auf einer Reichsversammlung in Aachen mehrere Kapitularien, darunter jenes, wel- ches die Durchsetzung seiner Verordnungen und die Kontrolle der Grafen durch die Einsetzung sogenannter Königsboten (missi dominici) zum Inhalt hat. Dabei handelte es sich jeweils um einen geistlichen und einen weltlichen Amtsträger, welche das besondere Vertrauen des Kaisers besaßen. Diese sollten gemeinsam in kurzen Abständen ihren Amtsbezirk bereisen, die Amtsführung der Grafen überprüfen und auch Beschwerden der Untertanen entgegennehmen. Dabei sollten sie vor zugunsten der Schwachen - Witwen, Waisen, Arme - eingreifen:
...
Der allergnädigste und allerchristlichste Herr Kaiser Karl hat von seinen fähigsten Großen die weisesten Männer ausgewählt, die da sind Erzbischöfe und andere Bischöfe, ehrwürdige Äbte sowie fromme Laien und hat sie in sein gesamtes Reich abgeordnet, um alle Untertanen, die unten angeführt sind, die Möglichkeit zu geben, nach Recht und Gesetz zu leben. Er befiehlt, dass sie sorgfältige Untersuchungen anstellen, falls irgendwo etwas anders als recht und gerecht verordnet sein sollte und wünscht darüber Berichterstattung: Dann nämlich will er mit Gottes Gnade für Verbesserung sorgen. Und niemand wage es, wie es leider häufig geschieht, mit vermeintlicher Schläue nach eigenem Gutdünken das gültige Gesetz oder seine Gerechtigkeit zu eigenem Vorteil zu beugen oder dies zu versuchen; weder gegenüber den Kirchen Gottes noch den Bedürftigen noch auch gegenüber Witwen und Waisen, wie überhaupt gegen keinen Christenmenschen.
...
Wenn aber irgendwo ein Mensch behauptet, ihm sei von einem anderen Unrecht widerfahren, dann sollen meine Boten, weil ihnen doch daran gelegen ist, die Gnade unseres allmächtigen Gottes zu behalten und die beschworenen Treue zu bewahren, sorgfältige Untersuchungen anstellen. Denn sie mögen ganz und gar und allen Menschen gegenüber und überall, gegenüber den heiligen Kirchen Gottes und gegen die Armen, gegen Witwen und Waisen und gegen das ganze Volk das Gesetz in voller Gerechtigkeit ausüben in dem Willen und der Furcht Gottes. Alle jene Fälle aber, in denen sie selbst aus eigener Kraft und mit Hilfe der Provinzgrafen keine Besserung erreichen und die Gerechtigkeit nicht wiederherstellen können, sollen sie mit ihrem Bericht ohne Umschweife dem Gericht des Herrn Kaisers unterbreiten: Es darf nicht geschehen, dass Speichelleckerei, Bestechung, Vetternwirtschaft oder Furcht vor Mächtigen die Gerichtsbarkeit behindert.
(Auszug aus einem Kapitular Karls, im Jahre 802 in Aachen erlassen)
Allein die Tatsache, dass Karl in seinen Kapitularien wiederholt Missbräuche der Mächtigen anprangern und bekämpfen und den Schutz des gemeinen Volkes verordnen musste (siehe dazu auch Ausschnitte im Capitulare de villis, zeigt, dass es sich bei den angeführten Missständen um eine verbreitete Problematik gehandelt haben dürfte - die immer und überall, unabhängig von Epoche und Kultur, aufzutreten scheint, wenn es an der notwendigen effektiven Kontrolle fehlt. Leider darf nicht unerwähnt bleiben, dass dem gut- gemeinten Versuch Karls kein dauerhafter Erfolg beschieden war - auch die Königsboten konnten allenfalls punktuelle, jedoch keine dauerhafte Verbesserungen bewirken. Schon wenige Jahre später sollte sich das Frankenreich, von schwächeren Königen beherrscht, in Teilreiche aufteilen. Und oft waren es dort lokale Machthaber und nicht mehr der König, welche den Schutz gegen raubende und plündernde Nordmänner und Sarazenen übernahmen. Es sollte noch lange Zeit vergehen - in den deutschsprachigen Gebieten sogar sehr lange Zeit - bis sich wieder eine starke Zentralgewalt etablieren konnte ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Höfisches Leben

Die Hofämter - Teil 2
Zum ersten Teil der Artikelserie: Die Hofämter - Teil 1
Das Amt des Kämmerers war ein weiteres von jenen, die bereits in merowingische Zeit zurückreichen. Ur- sprünglich mit thesaurarius beziehungsweise cubicularius bezeichnet, findet sich erstmals im späten 9. Jahr- hundert bei Hinkmar von Reims (in seiner Schrift 'De ordine palatii' ) der camerarius. Der Begriff geht auf das lateineische camera zurück, was soviel wie Raum, Kammer oder Gewölbe bedeuten kann.

Dabei meinte die Kammer am Hof der fränkischen Könige ursprünglich jenen Raum, in dem der wertvolle Pri- vatbesitz des Königs aufbewahrt wurde. Thesaurarius beziehungsweise der spätere Kämmerer hatten unter der Patronanz der Königin die Aufsicht über die königliche Kammer und somit auch die Aufsicht über den kö- niglichen Schatz, Schmuckstücke, Geschenke aber auch über die kostbare Bekleidung inne. Bemerkenswerter- weise bekleidet im Waltharius, dessen Entstehung möglicherweise in spätkarolingische Zeit zurückreicht und in dem volkssprachlicher Sagenstoff über die Taten des aquitanischen Königssohn Walther in Latein verarbei- tet wurde, mit der burgundischen Königstochter Hiltgunt am Hunnenhof eine Frau dieses Amt:
' ...
Auch die gefangene Jungfrau gefiel durch Fügung des höchsten Gottes dem Blick der Königin und gewann alsbald ihre Liebe, weil sie sich emsig hervortat durch Fleiß und durch edles Betragen. Schließlich wurde sie bestellt zur Hüterin sämtlicher Schätze, sorgsamen Sinns; und es fehlte nicht viel, dass sie selber herrschte. Was sie auch wünschte in ihrem Bereich, sie setzte es ins Werke. ...'
(Waltharius, Vers 110 ff)
Unschwer ist zu erkennen, welche Vertrauensposition die burgundische Geisel inne hat (die sie, hier sei es angemerkt, später weidlich ausnützen wird, um mit ihrem Liebsten Waltharius die gemeinsame Flucht unter Mitnahme eines beträchtlichen Schatzes zu bewerkstelligen) und wie groß Geltung und Machteinfluss waren, die im konkreten Fall mit dem Amt verbunden waren. Der lateinische Text weist übrigens noch auf die ältere Bezeichnung, wenn es dort heißt ' ... Postremum custos thesauris provida cunctis ... '
Zunehmend entwickelten sich die Kämmerer in den folgenden Jahrhunderten zu Finanzbeamten, denen bei- spielsweise auch die Verantwortung über die Kosten der Hofhaltung oblag. Aufgrund der Vorbildwirkung, welche die kaiserliche Hofhaltung innehatte, übernahmen die bedeutenden Fürstenhöfe ebenfalls die Hof- ämter und mit ihnen jenes des Kämmerers. So sind bereits im ausklingenden 11. Jahrhundert im Kölner und Trierer Erzstift Kämmerer bezeugt. Neben ihren eigentlichen Aufgaben bei der Hofhaltung unterstanden ihnen etwa die Münzergenossenschaften oder auch die Juden.
Mit dem ausgehenden Mittelalter verkümmerte die Bedeutung des Amtes am königlich-kaiserlichen Hof be- ziehungsweise an den Fürstenhöfen. Dafür erfuhr es in den Städten eine Institutionalisierung, wo in den Ratsämtern meist mehrere Personen, die ebenfalls als Kämmerer bezeichnt wurden, mit der Führung der Finanzgebarung und des Rechnungswesens betraut waren. Noch heute findet sich in deutschen Kommunen Benennungen wie Kämmerei- und Steuerabteilung ...
Die Aufgabe des Mundschenks (mittellatein picerna, buticularius, scancio - aus letzterem leitet sich das alt- hochdeutsche scenko her, während im buticularius der lateinische Keller steckt), dessen Tätigkeit sich bereits an den germanischen Königshöfen der Völkerwanderungszeit findet, war es, die königliche Tafel mit Geträn- ken zu versorgen. Anbei bemerkt sei, dass schon die antiken Völkerschaften der Ägypter, der Assyrer oder Perser dieses Amt kannten, welches allezeit eine große Vertrauensposition darstellte: Demjenigen, der Trank (oder auch Speise) reichte, traute der Herrscher Wohl und Gesundheit an. Daher stand die Position des Mund- schenken im Mittellater auch in hohem Ansehen. Aber nicht nur die Könige ließen sich von Schenken bedienen, sondern auch geistliche und weltliche Große, wie schon Gregor von Tours zu berichten weiß:
... Als er aber die Erde verlassen, riß jener abscheuliche Priester, der von den beiden genannten noch am Leben war, sogleich voll
Habsucht alles Vermögen der Kirche an sich und tat, als ob er schon Bischof wäre. 'Endlich, sagte er, hat Gott mich angesehen
und erkannt, daß ich gerechter als Sidonius bin, und mir solche Macht erteilt.' Hochmütig zog er durch die ganze Stadt, und am Sonntage nach dem Tode des heiligen Mannes ließ er ein Mahl bereiten und alle Bürger zum Kirchenhaus einladen. Er ließ sich aber zuerst auf seinen Sitz nieder und zeigte nicht die gebührende Achtung gegen die älteren Personen. Da überreichte ihm
sein Schenk einen Becher und sprach: 'Herr, ich sah einen Traum, den will ich dir mit deiner Erlaubnis erzählen. Mir träumte in
dieser Sonntagsnacht, ich sähe einen großen Palast, und in demselben war ein Thron aufgeschlagen, auf dem thronte als Richter
Einer, der mächtiger war als alle andren. ...'
(Gregor von Tours, Historiarum - Aus dem zweiten Buch)
Der Auszug macht deutlich, dass ein derartiger Schenke, wusste er es geeignet einzurichten und die passen- de Stunde abzuwarten, nicht unerheblichen Einfluss auf die Entscheidungen seines Herrn nehmen konnte. Schließlich besaß er Gehör vor dessen Ohr - vor allem auch dann, wenn der sich in entsprechender weinseli- ger Laune befand. Nicht umsonst fungierte der Mundschenk in karolingischer Zeit als Verwalter der Weinkel- ler und -gärten und der daraus resultierenden Produkte. Der obige Traum, von dem der Schenke seinem ver- ruchten Herrn zu berichten weiß, mit dem darin geschilderte göttlichen Gericht, führt übrigens zum überhaste- ten Ableben des bestürzt Lauschenden. Ein Beleg mehr dafür, dass die Position des Schenken eine von bedeutsamer Einflussnahme sein konnte ...
An den mittelalterlichen Höfen leistete der Inhaber des Mundschenkenamtes beim alltäglichen Mahl allenfalls Überwachungstätigkeiten, während die eigentliche Arbeit von untergeordnetem Personal erledigt wurde. Wie die Inhaber der anderen Hofämter stand der Mundschenk als herausragende Persönlichkeit wohl häufig für unterschiedliche Aufgaben im Interesse des Reiches zur Verfügung. Doch dazu mögt ihr später mehr erfahr- en ...
Zum dritten Teil der Artikelserie: Die Hofämter - Teil 3
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Höfisches Leben

Die Hofämter - Teil 1
Um einen möglichst reibungslosen Tagesablauf des fürstlichen (königlichen) Haushaltes zu gewährleisten, war die Erledigung gewisser Aufgaben notwendig. Jene Männer, die die dafür zuständig beziehungsweise verantwortlich waren, bekleideten bestimmte Positionen, die an allen mittelalterlichen Höfen in vergleichbarer Form anzutreffen sind und die als Hofämter bezeichnet werden. Die wichtigsten davon waren Kämmerer, Mar- schall, Truchsess oder Seneschalk (Seneschall) und Mundschenk. Doch unterlagen Anzahl, Bezeichnungen und auch die Bedeutungen der Ämter einem steten Wandel.
Die Hofämter erscheinen an den Höfen der germanischen Nachfolgereiche Westroms, etwa am Hof der frän- kischen Merowinger. Dort wo der König residierte, konzentrierte sich das öffentliche Leben und der Herrscher benötigte Männer an seiner Seite, die ihn bei der Erledigung der Staatsgeschäfte unterstützten, aber auch den Dienst an der königlichen Familie zu erledigen hatten. Man könnte diese Personen wohl am ehesten als hohe Beamte bezeichenen, welche aber nicht nur Verwaltungsaufgaben zu Hofe, sondern über das ganze Land zu erledigen hatten.

Ursprünglich dürften sich die Inhaber dieser Ämter aus den Reihen der Unfreien rekrutiert haben, bald jedoch scheinen die Aufgaben, die mit hoher Verantwortung und entsprechendem Ansehen und Einfluss verbunden waren, auch von höhergestellten Freigeborenen übernommen worden zu sein. Später wiederum kam es zu- meist zu einer Verdoppelung dieser Positionen, die dann normalerweise von Ministerialen ausgeübt und nur zu hohen Anlässen von hohen Würdenträgern übernommen wurden. Mit jedem Amt war ein bestimmter Dienst am Herrscher verbunden, den der Amtsinhaber ursprünglich wohl selbst zu besorgen hatte. Doch gleichzeitig übernahm er damit auch die Aufsicht über unfreien Knechte in seinem Bereich.
So lässt sich der Begriff Seneschalk (seniscalcus) als ältester Knecht deuten, der als solcher die Aufsicht über das gesamte Gesinde innehatte. In dieser Funktion trägt er Sorge über das Hauswesen, besonders über den Unterhalt des Hofes und somit auch die Mahlzeiten. Daher wird er auch als Vorsteher des königlichen Tisches bezeichnet, als Meister der Köche und Träger der Speisen. Dabei steht ihm der Oberschenk, der spätere Mund- schenk, zur Seite, dessen Amt in karolingischer Zeit zu höherem Ansehen gelangt. Zusätzlich fungieren meist jüngere Männer, die am Hofe leben als zusätzliche Schenken.
Auch der Küchenmeister (coquus) hatte als Aufseher über die Küche für das leibliche Wohl des königlichen Hof- staates zu sorgen. In merowingischer Zeit wohl von untergeordneter Bedeutung, kann im Nibelungenlied (um 1200 entstanden) Rumolt, der 'oberste Küchenchef', der als wackerer Kämpe beschrieben wird (Rûmolt der kú- chenmeister, ein ûz erwelter degen, ...), seinen Herren durchaus wohlgemeinte Ratschläge erteilen (auch wenn diese unglücklicherweise nicht befolgt werden):
Da sprach der wackere Küchenmeister Rumolt:
...
'Wollt ihr Hagen aber nicht folgen, so rät euch Rumolt,
denn ich bin Euch treu und dienstbereit verbunden,
bleibt mir zuliebe hier
und lasst König Etzel dort bei Kriemhild sein.
... '
Dô sprach der kuchenmeister, Rûmolt der degen:
...
'Welt ir niht volgen Hagene, iu rætet Rûmolt,
wand ich iu bin mit triuwen vil dienestlîchen holt,
daz ir sult hie belîben durch den willen mîn,
und lât den künec Etzel dort bî Kriemhilde sîn.
...'
(Nibelungenlied, 24. Âventiure - 1466. Strophe)
Der fränkische major domus oder Hausmeier scheint ursprünglich ähnliche Funktionen wie der Seneschalk innegehabt, der Begriff somit also nur eine andere Bezeichnung für dieses Amt dargestellt zu haben. Welchen Einfluss die Inhaber eines solchen Hofamtes gewinnen konnten, zeigt die fränkische Geschichte, in derem Verlauf das Hausmeieramt von einflussreichen Geschlechtern ausgeübt wurde, die mehr und mehr die tat- sächliche Macht im Königreich übernahmen. Die Absetzung des letzten Merowingerherrschers und die Krö- nung Pippins bestätigten schließlich nur die realpolitischen Gegebenheiten. Klugerweise entschlossen sich die neuen karolingischen Herrscher sofort, das so einflussreiche Amt des Hausmeiers aufzulassen - wodurch die Position des Seneschalks wiederum an Bedeutung gewann.
Auch in der Position des Marschalls zeigt sich ein ständiger Wandel von Bedeutung und Einfluss: Der Marschalk (comes stabuli, Stallgraf) war eigentlich der oberste der Rossknechte und hatte als solcher die Aufsicht über den königlichen Stall (Marstall) über. Bald schon wurde er aber auch als Leiter von Gesandtschaften und - infolge der zunehmenden Bedeutung der berittenen Truppe - als Heerführer eingesetzt. Später bezeichnete der Titel allgemein hochrangige Heerführer.
Allerdings scheint es auch so zu sein, dass die Aufgabenverteilung nicht immer eine eindeutige war. So wissen die fränkischen Reichsannalen Einhards für das Jahr 786 von einem Feldzug gegen die Bretagne zu berichten, der vom Seneschall Audulf geführt wird:
Als der Winter vorbei und das heilige Osterfest zu Attiniacum vom König begangen worden war, beschloß er ein Heer in
das diesseits des Meeres gelegene Brittannien zu schicken. Denn als die Insel Brittannien von den Angeln und Sachsen in Besitz
genommen wurde, fuhr ein großer Teil ihrer Bewohner übers Meer und ließ sich am äußersten Ende Galliens im Gebiet der
Veneter und Coriosoliten nieder. Dieses Volk war von den Franken- königen unterworfen und zinsbar gemacht, und pflegte
obwohl ungern die ihm auferlegte Steuer zu entrichten. Da es aber zu der Zeit den Gehorsam verweigerte, wurde Audulf des Königs
Seneschall abgeschickt, um den Trotz des treulosen Volks zu brechen: er führte dieß mit ungemeiner Schnelligkeit aus und
brachte die Geißeln, die er erhalten hatte, und mehrere von den Großen des Volks vor den König nach Worms.
('Reichsannalen' (Einhards Jahrbücher) - 786)
Wie es scheint, wurden die Hofämter von Karl dem Großen mit Männern besetzt, die durchaus unterschied- liche Aufgaben zu erledigen wussten und deren Tätigkeiten sich folglich auch nicht auf einen einzigen Tätig- keitsbereich einschränken ließ ...
Weiter zum zweiten Teil der Artikelserie: Die Hofämter - Teil 2
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Wirtschaftsorganisation
im Mittelalter
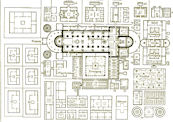
Ackerbau und Dreifelderwirtschaft
Im vorliegenden Artikel werden die dörflichen Strukturen angesprochen, wie sie im mittelalterlichen Zentraleu- ropa häufig anzutreffen waren. Dazu ist zu bemerken, dass sich die ländlichen Lebensumstände über lange Zeit hinweg nur wenig verändert haben. Daher wird manches von dem, was in jener Epoche Recht und Sitte ist, viel älteren Ursprungs sein und bereits in germanische Zeit zurückreichen. Dies gilt möglicherweise auch für die hier beschriebenen dörflichen Organisationsformen.
In allen mittelalterlichen Gemeinden ist zwischen Privat- und Gemeindeigentum (der Allmende) zu unterschei- den. Alles, was der Einzelne im Dorf besaß, sei dies nun Haus und Hofstatt, Acker und Recht an der Allmende, wurde als Hufe bezeichnet (ahdt. huoba, mhdt. huobe, huofe). Im Namen des Huberbauern hat sich dieser Begriff übrigens erhalten. Die Hofstatt ist jener Platz, den Haus und Hof, also der eingefriedete Wirtschafts- platz beim Haus, einnehmen. Die Umzäunung kennzeichnet dabei ihre Trennung vom Gemeineigentum.

Neben der Hofstatt sind auch die zugehörigen privaten Grundstücke Teil einer Hufe - also Äcker, Wiesen, Wei- den, Weinberge, Waldstücke. Ursprünglich waren die Grundstücke jedes Einzelnen von gleichen Abmessun- gen, wobei die Größen örtlich wechseln: So finden sich Hufen von 20, 30 oder 40 Morgen; Königshufen sogar zu 60 oder 120 Morgen. Das Morgen wurde ursprünglich übrigens jene Fläche bezeichnet, die mit einem Ge- spann an einem Morgen gepflügt werden konnte. Auch war es lange Zeit üblich gewesen, den für den Acker- bau bestimmten Boden eines Dorfes gemeinsam anzulegen und danach jedem Mitglied der Gemeinschaft seinen Anteil zuzuweisen. Dabei wurde darauf geachtet, dass jeder gleichermaßen Anteil am guten wie am schlechten Boden hatte.
Der gesamte Ackerboden wurde in drei Fluren eingeteilt, wobei diese Einteilung in der sogenannten Dreifel- derwirtschaft begründet lag, die - seit karolingischer Zeit bekannt - sich im Hochmittelalter verbreitet durchge- setzt hatte. Die Dreifelderwirtschaft besteht darin, dass alle Äcker in einem dreijährigen, periodischen Zyklus derselben Bepflanzung ('Kulturfolge') unterworfen wurden, wodurch ein Auslaugen des Bodens verhindert werden soll.
Ein Acker wurde dabei in zwei aufeinanderfolgenden Jahre mit unterschiedlichem Saatgut bepflanzt: Im ers- ten Jahr mit der sogenannten Winterfrucht (Roggen, Emmer), die noch vor dem Winter auszusäen war, im zweiten mit der Sommerfrucht (Hafer, Gerste, Hirse), deren Saat erst im Frühjahr ausgebracht wurde. Im dritten Jahr erfolgte keine Bepflanzung - der Acker (der dann als Brache bezeichnet wurde) lag brach. Aller- dings wurde er in diesem Zeitraum als Viehweide benutzt und auch Unkraüter sollten beseitigt werden. Bei korrekter Pflege war die Brache dreimal zu pflügen; einmal um die Stoppeln der letzten Frucht einzupflügen, dann erfolgte das sogenannte Felgen und schließlich, nach der Düngung, das Saatpflügen für die folgende Winterfrucht.
Schließlich gehörten auch Wiesen zur Hufe und somit zum Privateigentum, wobei sie zerstreut zwischen Äckern, beim Dorf, im Wald liegen konnten. Der Ertrag einer solchen Wiese wurde in Fudern oder Mannmad (d.i. was ein Mann an einem Tag mähen kann) angegeben. Früh finden sich auch Waldungen im Privatbesitz, ebenso Obst- und Weingärten.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Wirtschaftsorganisation im Mittelalter
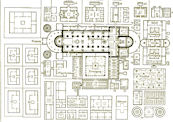
Das 'Capitulare de villis' Karl des Großen - Teil 2
Zum 'Capitulare de villis' - Teil 1
LXX. Volumus quod in horto omnes herbas habeant, id est lilium, rosas, fenigrecum, costum, salviam, rutam, abrotanum, cucumeres, pepones, cucurbitas, fasiolum, ciminum, ros marinum, ...
De arboribus volumus quod habeant pomarios diversi generis, pirarios diversi generis, prunarios diversi generis, sorbarios, mespilarios, castanearios, persicarios diversi generis, cotoniarios, avellanarios, amandalarios, morarios, lauros, pinos, ficus, nucarios, ceresarios diversi generis. ...
Wie schon im ertsten Teil dieser Artikelserie erwähnt, gibt die Landgüterverordnung Karl des Großen, das Capitulare de villis vel curtis imperialibus genaue Anweisungen, wie die Verwaltung der königseigenen Güter zu erfolgen habe, wobei sich die Anordnungen häufig an den bewährten Vorbildern aus römischer Zeit orientier- en. War doch gerade die Machtübernahme in der ehemaligen römischen Provinz Gallien durch die Franken so verlaufen, dass sich zunächst römische Organisation und Verwaltungsstrukturen erhalten hatten - nicht zu- letzt aufrechterhalten durch die Kirche, welche sehr schnell ein Bündnis mit den neuen Machthabern einging.
Die Römer hatten unter anderem eine hochentwickelte Gartenkultur besessen, während gerade die germa- nischen Völker vorerst nichts Vergleichbares aufweisen konnten, sieht man davon ab, dass auch bei ihnen einige wenige Nutzpflanzen angebaut wurden. Doch in jenen ehemaligen Provinzen, in denen nicht sämtliche Errungenschaften des Imperiums in den Wirrungen der Völkerwanderzeit untergegangen waren, konnte die überlegene Kultur befruchtend auf die zugewanderten Völker einwirken.

Insbesondere entwickelten sich die Klöster der Benediktiner und der Zisterzienser zu Orten, in denen man- ches an altem Wissen erhalten werden konnte, wurde doch den Mönchen in ihren Ordensregeln neben dem Gebet durchaus auch weltliche Arbeit zur Aufgabe gemacht ('ora et labora' des Benedikt von Nursia). Neben anderen Tätigkeiten - etwa jener, der wir viel von unserem Wissen über diese und vorangehende Epochen verdanken, nämlich dem Kopieren und der Erhaltung alter Handschriften - stellte die Betätigung im kloster- eigenen Garten eine weitere Möglichkeit für die Brüder und Schwestern dar, sich nutzbringend zu betätigen. Gerade die in den Klostergärten gezogenen Nutz- und Heilpflanzen konnten der Gemeinschaft in diesen Zei- ten fehlender großräumiger Versorgung als Nahrungsmittel und zur Erzeugung von Heilmitteln sehr dienlich sein.
Karl konnte nun auf ein solcherart erhaltenes Wissen zurückgreifen, um in seinem 'Capitulare de villis' eine detailierte Vorgabe zu machen, wie die Krongüter zu organisieren seien. Die möglichen Gründe, warum eine derartige Vereinheitlichung angestrebt wurde, sind bereits angesprochen worden. Hungersnöte werden sicherlich ihren Teil dazu beigetragen haben.
Im Abschnitt 70, dem letzten seiner Verordnung, lässt Karl nun all jene Nutzpflanzen und -bäume auflisten, die auf den königseigenen Krongütern angebaut werden sollten. Dabei werden folgende 73 Nutzpflanzen (also Gemüsesorten, Küchenkräutern, Gewürz- und Heilpflanzen) und 16 Baumarten aufgelistet:
70. Wir ordnen an: In den Gärten soll man folgende Pflanzen ziehen: Lilien, Rosen, Hornklee, Frauenminze, Salbei, Raute, Eberreis, Gurken, Melonen, Flaschenkürbis, Faseolen, Kreuzkümmel, Rosmarin, Feldkümmel, Kichererbsen, Meerzwiebeln, Schwertlilien, Schlangenwurz, Anis, Koloquinten, Heliotrop, Bärenwurz, Sesel, Salat, Schwarzkümmel, Gartenrauke, Kresse, Klette, Poleiminze, Myrrhendolde, Petersilie, Sellerie, Liebstöckel, Sadebaum, Dill, Fenchel, Endivie, Weißwurz, Senf, Bohnenkraut, Brunnenkresse, Krauseminze, Rainfarn, Katzenminze, Tausendguldenkraut, Schlafmohn, Runkelrüben, Haselwurz, Eibisch, Malven, Karotten, Pastinaken, Melde, Mauskraut, Kohlrabi, Kohl, Zwiebeln, Schnittlauch, Porree, Rettich, Schalotten, Lauch, Knoblauch, Krapp, Kardendisteln, Pferdebohnen, maurische Erbsen, Koriander, Kerbel, Wolfsmilch, Muskatellersalbei, Auf dem Dach seines Hauses soll der Gärtner Donnerkraut ziehen.
An Fruchtbäumen soll man nach unserem Willen verschiedene Sorten von Apfelbäumen, Birnbäumen und Pflaumenbäumen halten, ferner Eberesche, Mispeln, Edelkastanien und Pfirsichbäume verschiedener Arten, Quitten, Haselnüsse, Mandelbäume und Maulbeerbäume, Lorbeer, Kiefern, Feigenbäume, Nussbäume und verschiedene Kirschsorten. Die Apfelsorten heißen: Gosmaringer, Krevedellen, Speieräpfel, süße und saure, durchweg Daueräpfel; weiters solche, die man bald verbrauchen muss; Frühäpfel. Drei bis vier Arten Dauerbirnen, süßere und mehr zum Kochen geeignete und Spätbirnen.
('Capitulare de villis')
Interessant jene Anordnung, welche die Auflistung der Nutzpflanzen abschließt: Der Gärtner hätte Donner- kraut auf dem Hausdach anzusetzen. Darin spiegelt sich in dem sonst sehr rational gehaltenen Dokument mittelalterlicher Volks- und Aberglauben wider: Dieses Donnerkraut (Hauswurz, auch Hauslauch oder Dach- ampfer) soll, am Dach wachsend, nämlich Schutz vor Blitzeinschlägen bieten. Übrigens findet sich auch heute noch der Hauswurz noch auf vielen Dächern - optisch sicherlich der Variante mit dem Blitzableiter vorzuziehen. Vielleicht versucht ein geneigter Leser ja einmal die Wirksamkeit dieser althergebrachten Methode bei seinem kleinen Eigenheim auszutesten und berichtet uns danach über Erfolg oder Misserfolg ..
Da es zu jener Zeit noch keine Pflanzensystematik mit eindeutig definierten Bezeichnungen gab, ist die Zu- ordnung der in der Verordnung verwendeten lateinischen Bezeichnungen zu unseren Pflanzenbezeichnungen nicht immer eindeutig zu bestimmen. Auffallend auch, dass die Liste Arten anführt, die in unterschiedlichen kli- matischen Zonen beheimatet sind - also auch solche die ursprünglich nur in mediterranen Gebieten vorkamen (etwa Rosmarin und Salbei). Letztere könnten zwar, von den Römern einst über die Alpen exportiert, einge- heimatet worden sein, doch wird dieser Abschnitt 70 eher als Wunschkatalog Karls gedeutet, der den jeweils regionalen Verhältnissen anzupassen war.
Idealerweise hätte jedes Gut sämtliche aufgelistete Arten anzubauen gehabt, in der Praxis werden es aber bedeutend weniger gewesen sein - wie dies etwa aus Inventaren (Verzeichnisse) von Krongütern ersichtlich ist, die Karl ebenfalls anlegen ließ und die beispielsweise in derselben Sammelhandschrift wie das 'Capitulare de villis' erhalten geblieben sind. So werden im Verzeichnis eines südfranzösischen Hofgutes 20 Blumen- und Gemüsearten und 8 Obstbäume genannt, in dem eines weiteren Gutes 27 Blumen- und Gemüse- und 10 Obstarten. Also in beiden Fällen bedeutend weniger, als in der Verordnung aufgelistet.
Dennoch stellt die Aufstellung im Capitulare de villis über viele - man muss schon sagen - Jahrhunderte hin- weg das Vorbild für den mittelalterlichen Klostergarten und - von dort beeinflusst - für die späteren Bauern- gärten dar. Ja, neuerdings werden vermehrt wieder Gärten angelegt, in denen Pflanzen nach historischen Vorgaben angepflanzt werden - und damit erleben Walahfried Strabo's 'De cultura hortorum' und Karls Capitulare eine gewisse Wiederauferstehung.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Wirtschaftsorganisation im Mittelalter
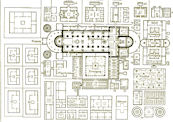
Das 'Capitulare de villis' Karl des Großen - Teil 1
I. Volumus ut villae nostrae, quas ad opus nostrum serviendi institutas habemus, sub integritate partibus nostris deserviant et non aliis hominibus.
II. Ut familia nostra bene conservata sit et a nemine in paupertate missa.
III. ...
Die Kapitularien der fränkischen Könige sind Erlässe und Verordnungen mit gesetzgeberischen, verwaltungs- technischen oder religiösen Inhalten. Mit der Veröffentlichung dieser Verordnungen, deren Gliederung in Ka- pitel namensgebend war, versuchten die jeweiligen Herrscher die politischen, rechtlichen, administrativen, kirchlichen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Verhältnisse in ihrem Sinn zu beeinflussen. Dadurch wer- den die Kapitularien für uns zu wichtigen Quellen des frühen Mittelalters, geben sie doch Einblicke in das All- tagsleben, das Bildungswesen, die Denkweise ihrer Zeit, aber auch in die vielfältigen Probleme, mit denen sich die Herrscher auseinandersetzen mussten.
Dass sich diese Verordnungen nicht nur mit 'hoher' Politik befassen, sondern durchaus auch auf die Lebens- umstände breiter Bevölkerungsschichten Bezug nehmen, zeigt die Landgüterverordnung Karl des Großen, das Capitulare de villis vel curtis imperialibus , das sich in einer Handschrift erhalten hat, die heute in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel aufbewahrt wird. Über das genaue Entstehungsdatum besteht keine abso- lute Gewissheit, doch wird ein gewisser Zusammenhang mit den großen Hungersnöten, die in den Jahren 792 und 793 das fränkische Reich heimsuchten, angenommen. Allerdings datieren manche Forscher die Verord- nung auch erst in das Jahr 812.

Von den Nachwirkungen her betrachtet, war das Capitulare de villis eine der bedeutendsten dieser frühmit- telalterlichen Verordnungen. Es enthält detaillierte Anweisungen zur Verwaltung der königseigenen Krongü- ter, also des Landes, das dem König selbst gehörte. Damit sollten die königlichen Güter vor Zweckentfrem- dung geschützt und die Versorgung des königlichen Hofes mit Nahrungsmitteln und gewerblichen Erzeug- nissen, mit Jagdfalken, und vielem mehr sichergestellt werden. In siebzig Abschnitten finden sich unter an- derem Regelungen über Dreifelderwirtschaft, Weinbau, Obstpflege, die Zucht von Hausvieh und Herdenvieh, Pferden, Rindern, Schafen, Schweinen, Ziegen und Bienen. Mit den jeweils notwendigen landwirtschaftlichen Techniken selbst befasst sich das Kapitular allerdings nicht. Lediglich die Pferdezucht und die Aufzucht junger Hunde werden näher beschrieben.
Als frühmittelalterlicher Herrscher war Karl darauf angewiesen, nahezu pausenlos sein riesiges Herrschafts- gebiet zu bereisen. Nur durch immerwiederkehrende Präsenz in den verschiedenen Landesteilen konnte der König seine Machtansprüche sicherstellen. Dabei war es natürlich von großer Bedeutung, dass seine und die Versorgung seines Trosses stets sichergestellt war. Auch führte Karl nahezu jeden Sommer Kriegszüge durch. Dafür musste er zuverlässig mit Lieferungen aus den königlichen Domänen für den Unterhalt des Heeres rech- nen können. Dazu war ein flächendeckendes Netz von gutorganisierten Stützpunkten notwendig.
Jedoch hatte Karl nicht ausschließlich die wirtschaftlichen Erträge seiner Güter im Auge, sondern er sorgte sich auch um das Wohl seiner Untertanen - wie einige Abschnitte aus dem Kapitular zeigen, beispielsweise die Ab- schnitte 2 und 3:
2. Unsere Hofleute sollen wohl versorgt und niemandem in Schuldknechtschaft gebracht werden.
3. Die Amtmänner sollen sich hüten, unsere Hofleute in ihren eigenen Dienst zu stellen; sie dürfen sie nicht zu Fronen, zum Holzfällen oder irgendeiner andere Arbeit zwingen und keine Geschenke von ihnen annehmen: weder Pferd, Ochsen, Kuh, Schwein, Hammel, Ferkel, Lamm noch sonst etwas, ausgenommen Würste, Ge- müse, Obst, Hühner und Eier.
('Capitulare de villis')
Die Amtmänner des Königs, das waren die Grafen, hatten bei Abwesenheit des Herrschers dessen Rechte zu vertreten und dessen Interessen zu verfolgen. So oblag ihnen die Gerichtsbarkeit, sie hatten den Zehnten an die Kirche abzuführen, usw. Oft genug verfolgten diese Amtsträger eigene Interessen. Es war ein ständiges Ringen, in dem die fränkischen Herrscher durch den Erlass von Kapitularien und durch die Aussendung der so- genannten Königsboten ihre Rechte sicherzustellen und die Eigenmächtigkeiten der Grafen zurückzudrängen. Dass ihnen dies auf Dauer nicht gelingen konnte, lag in den großen Distanzen ihres Herrschaftsgebietes und den fehlenden Infrastrukturvoraussetzungen zu hinreichenden Überwachung ihrer Amtmänner begründet.
Weiter zum 'Capitulare de villis' - Teil 2
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Technologie des MA
Wasserversorgung

Wasserreinigung und -bevorratung in Burgen: die Filterzisterne
Für die Besatzung einer Burg waren Bevorratung und Wasserversorgung eine Frage von großer Wichtigkeit - im Belagerungsfall sogar von existenzieller. Das Fehlen einer ausreichend ergiebigen Wasserquelle bedeutete im Friedensfall 'nur' eine Erschwernis des täglichen Lebens und eine gewisse Einschränkung des Lebensstan- dards. Immerhin konnte in diesen Zeiten dem Mangel abgeholfen werden: durch die Verwendung von Trag- tieren oder durch das Anlegen von Leitungen, durch welche die notwendigen Wassermengen von außerhalb und höher gele- genen Quellen abgeleitet werden konnten.
Im Fehde- oder Kriegsfall fielen diese Methoden zur Wasserbeschaffung häufig weg. Das Verlassen der Burg war im Belagerungsfall unmöglich und die Zuleitungen konnten von den Angreifern unterbrochen oder deren Quellen vergiftet werden. In solchen Fällen musste die Burg zumindest über eine zusätzliche, eigenständige Wasserver- sorgung verfügen - andernfalls konnte die Verteidigung nur kurze Zeit aufrecht erhalten werden.

Dennoch zeigt die Untersuchung von Burgen, dass für die Wahl der Standorte in erster Linie günstige räum- liche Verteidigungsmöglichkeiten entscheidend waren, wie dies die Verbreitung der Höhenburg in Europa klar zeigt. Die Unzugänglichkeit manch einer dieser Festungen, die sich wie Adlerhorste auf kleine Felsplateaus über wilde Abhänge schmiegen, machten solche Wehrbauten tatsächlich fast uneinnehmbar - vorausgesetzt die Burg war ausreichend stark besetzt. Jedoch genügten zur Verteidigung oft schon wenige Mann und so mussten sich die Angreifer häufig darauf beschränken, den umliegenden Besitz des Fehdegegners zu verwüs- ten. Eine Belagerung hatte nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn die Eingeschlossenen nicht über ausreichend Vorräte und vor allem Wasser verfügten.
Also mussten die Burgenerbauer ihr Augenmerk vor allem auf die Wasserversorgung legen. Nur in wenigen glücklichen Fällen entsprang eine Quelle im Inneren des Burgengeländes. Neben dieser einfachsten Variante war die Grabung eines eigenen Brunnens innerhalb der Ummauerung ebenfalls ein geeignetes Mittel, die Ver- sorgung weitgehend unabhängig von externer Wasserzufuhr zu gestalten. Doch auf dem felsigen Untergrund gestalteten sich die dazu notwendigen Bohrungen häufig als technisch sehr aufwändig - immerhin musste bis zum Grundwasserspiegel oder zumindest so tief durchgebrochen werden, dass Schicht- oder Sickerwasser in ausreichender Menge zur Verfügung stand. Zwar gab es tatsächlich auch sehr tiefe Brunnen, so erreicht der Brunnenschacht in der Nürnberger Burg eine Tiefe von 70 Metern, doch war der immense Aufwand in vielen Fällen einfach zu hoch oder überstieg die technischen Fähigkeiten der damaligen Zeit. Oftmals reichte auch die Wassermenge, die ein vorhandener Brunnen zu liefern vermochte, nicht aus, um alle Bedürfnisse zu erfül- len.
In solchen Fällen war es notwendig, geeignete Wasserreservoires anzulegen, welche zeitgerecht aufgefüllt werden mussten - durch Regen- und Schmelzwasser und, falls dieses nicht ausreichte, durch zusätzlichen händischen Wassertransport von außerhalb. Solche Zisternen wurden in vielen Gegenden eingesetzt und er- reichten im orientalischen Großstädten oft Fassungsvermögen von vielen tausenden Kubikmetern. In unseren einheimischen Burgenanlagen mussten und konnten diese Wassertanks weitaus kleiner gehalten werden. Ei- nerseits wegen der räumlichen Gegebenheiten, andererseits sind in einer Burg häufig nur vergleichsweise wenige Menschen zu versorgen. Außerdem kann in unseren mitteleuropäischen Breiten meist mit einer gewis- sen Niederschlagshäufigkeit spekuliert werden.
Als Zisternenbauformen kommen zwei Typen in Betracht: die einfache Tankzisterne und die aufwändigere Fil- terzisterne. Bei der Tankzisterne handelt es sich im Prinzip um einen unterirdischen Hohlraum, der geeignet ausgekleidet oder ausgemörtelt, der Aufnahme des Regenwassers dient. Dieses Wasser, das etwa von den Dächern herab durch bauliche Maßnahmen direkt eingeleitet wird, unterliegt keiner Reinigung. Baulich wurden derartige Zisternen häufig in Flaschenform ausgeführt, um nachrägliche Verunreinigungen durch den schma- len Schöpfschacht herab möglichst geringzuhalten.
Die Filterzisterne stellt die aufwändigere Bauform dar, die die Gewinnung qualitativ hochwertigen Wassers er- laubt. Ihrer klassische Ausführung ist durch einen mittig in der Grube sitzenden Schöpfschacht gekennzeich- net, der von einem Sand-Kies-Gemisch umgeben wird. Das kostbare Nass leitet man in diesen sandigen Fil- trierkörper ein, damit es beim Durchfließen von Verschmutzungen und Schwebstoffen befreit wird, bevor es in den Entnahmeschacht einsickert.
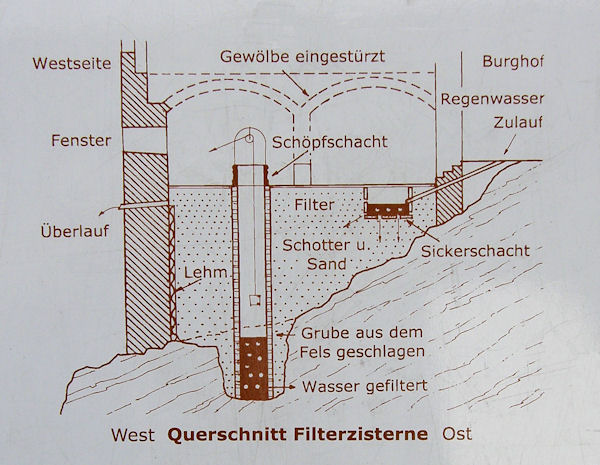
Da unterirdisch gelegene Hohlräume stets jene Teile einer Burg waren, die nach Aufgabe oder Zerstörung zu- erst unter Schutt und Gestein verschwanden, ist bei vielen Wehranlagen ungeklärt, ob sie durch Brunnen, Tank- oder Filterzisternen versorgt wurden. Erst 1991 wurde in der bei Krems gelegenen bedeutenden Burg- ruine Senftenberg eine Filterzisterne wiederentdeckt. Die obige Querschnittdarstellung zeigt, wie planmäßig diese Zisterne angelegt wurde, entstanden doch Schöpfschacht und Außenwand gleichzeitig, und zwar der- art, dass Naturhang und die Burgaußenmauer das Filterbecken für die Sand- und Kieselschicht bilden konnten
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Das Frankenreich
Frühmittelalter

Die Förderung der 'deutschen' Volkssprache durch Karl den Großen
Karl der Große hat in seinen zahlreichen Feldzügen all jene germanischen Stämme unterworfen und in das fränkische Reich eingegliedert, die später zur deutschen Nation verschmelzen sollten. Die Bayern, deren Her- zog Tassilo dem Frankenkönig lehnspflichtig war, der aber diese Pflicht abzustreifen suchte und sich den not- wendigen Rückhalt in einem Bündnis mit den Langobarden erhoffte, wurden wieder botmäßig gemacht. Die Sachsen wurden in Jahrzehnte währenden, grausam geführten Kriegen und blutigen Unterdrückungsmaß- nahmen unterworfen. Ebenso konnte Karl endlich die Eroberung Frieslands, die bereits unter seinem Urgroß- vater Pippin und seinem Großvater Karl Martell begonnen hatte, vollenden. Als Vorboten und im Gefolge der Eroberer kamen immer auch die Missionare, den neuen Glau- ben an den Christengott verkündend ...
Doch war Karl bereit, den einmal in den Reichsverband eingegliederten Stämmen eine gewisse Autonomie zu- zugestehen. So sollten Rechtsfälle nach dem jeweiligen, einheimischen Volksgesetz abgeurteilt werden. Dazu ließ der König und spätere Kaiser die einzelnen germanischen Volksrechte aufzeichnen, wie etwa das soge- nannte Lex Frisionum, das Gesetz der Friesen. 802 bzw. 803 wurden auf dem Reichstag zu Aachen diese ger- manischen Stammesgesetze festgeschrieben. Auch althergekommene Rechts- verhältnisse, wie etwa die Frei- heit des freien Grund und Bodens von Zins und Abgaben, blieben unangetastet.

Die Vereinigung der 'deutschen' Stämme war Karls zielbewusstes Werk. Er selbst entstammte ja dem germa- nischen Stamm der Franken und fühlte sich wohl diesen Völkern wesensverwandt. Vermutlich sprach er zual- lererst einen germanisch-fränkischen Dialekt - neben anderen Sprachen, die er erlernte und beherrschte. (Ein Franzose wird diese Behauptung selbstverständlich zurückweisen, schließlich gibt es ja den allseits bekann- ten Diskurs, ob Karl denn nun 'Deutscher' oder 'Franzose' gewesen sei. 'Weder - noch', wird wohl am Tref- fendsten sein ...) So ließ er die 'barbarischen Lieder' wie sie sein Biograph Einhard nennt, die altgermanischen Heldengesänge aufzeichnen, eine Tat, um derentwillen wir ihn wohl heute noch rühmen würden. Ja, würden, wären diese Aufzeichnungen nicht in den nachfolgenden wirren Zeitaltern dennoch verlorengegangen - ein unschätzbarer Verlust, der jedoch nicht mehr ihm anzulasten ist. Doch war der Langobarde Paulus Diaconus bei seinem Aufenthalt am fränkischen Hof möglicherweise mit solchen Bestrebungen zur Bewahrung in Be- rührung gekommen, was ihn in der Folge zur Abfassung seiner Geschichte der Langobarden veranlasst haben könnte ...
Karl selbst mühte sich um eine Förderung seiner 'Muttersprache'. So soll er mit der Verfassung einer Gram- matik begonnen und versucht haben, manch deutsche Bezeichnungen einzuführen, etwa für die Monate, die noch ihre altrömischen Namen führten (und - weil sich Karls Neuerungen schließlich nicht durchsetzen konnten - immer noch führen). Dach lassen wir dazu seinen Hofbiographen Einhard zu Wort kommen:
Da er (Anm.: Karl) sah, wieviel Mangelhaftes in den Gesetzen seines Volkes sei, - die Franken haben nämlich zwei Rechte,
die in manchen Stücken sehr voneinander abweichen - so nahm er sich nach der Annahme des Kaisertitels vor, das
Fehlende zu ergänzen, das Abweichende in Übereinstimmung zu bringen und das Verkehr- te und Untaugliche zu verbessern; indes
er kam damit nicht weiter, als daß er wenige Zusätze, und auch diese nicht ganz fertig, zu den Rechtsbüchern machte. Wo
das Recht eines der von ihm beherrschten Volksstämme noch nicht geschrieben war, da ließ er es zusammenstellen und
schriftlich aufzeichnen. Ebenso ließ er die uralten deutschen Lieder, in denen die Taten und Kriege der alten Könige besungen
wurden, aufschreiben, damit sie unvergessen blieben. Auch eine Grammatik seiner Muttersprache begann er abzufassen. Ferner
gab er den Monaten, für welche bei den Franken bis dahin teils lateinische teils deutsche Namen im Gebrauch gewesen
waren, Benennungen aus seiner eigenen Sprache. Ebenso gab er den zwölf Winden deutsche Namen, während man vorher
kaum für vier Winde besondere Benennungen hatte. Und zwar nannte er von den Monaten den Januar Wintarmanoth, den
Februar Hornung, den März Lentzinmanoth, den April Ostarmanoth, den Mai Winnemanoth, den Juni Brachmanoth, den
Juli Heuvimanoth, den August Aranmanoth, den September Witumanoth, den Oktober Windumemanoth, den November
Herbistmanoth, den Dezember Heilagmanoth. Den Winden aber gab er folgende Namen: den Ostwind (Subsolanus) nannte
er Ostronowint, den Südostwind (Eurus) Ostsundroni, den Südsüdostwind (Euroauster) Sundostroni, den Südwind (Auster)
Sundroni, den Südsüdwestwind (Austroafrikus) Sundwestroni, den Südwestwind (Afrikus) Westsundroni, den Westwind (Zephyr)
Westroni, den Nordwestwind (Chorus) Westnordroni, den Nordnordwestwind (Circius) Nordwest- roni, den Nordwind (Septemtrio)
Nordroni, den Nordostwind (Aquilo) Nordostroni, den Ostnordostwind (Vulturnus) Ostnordroni.
(Einhard: 'Annales regni Francorum')
Ein halbes Jahrhundert sollte es schließlich nur dauern, bis das Werk Karls zerfallen, die Einheit des Reiches Ge- schichte war. Doch hatte sich in dieser Zeit bereits so etwas wie ein Gefühl der Zusammengehörigkeit der ger- manischen Stämme im Osten des ehemaligen Frankenreichs entwickelt. Nach und nach sollte sich in diesem Ost- teil die deutsche Nation entwickeln, so wie aus den westlichen Gebieten schließlich Frankreich erstand. Das Frankenreich Karls jedoch, das beide große Territorien umfasste und mit ihnen auch noch Teile Italiens, könnte man bereits als ersten Vorläufer eines vereinten Europas betrachten ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Glaube und Politik
Religionsgeschichte

Einige Worte zum Einfluss der Religion auf den Verlauf der mittelalterlichen Geschichte
Um den Ereignissen einer Epoche gerecht zu werden, in der Glaube, Frömmigkeit und Hingabe oftmals einher- gingen mit Grausamkeit, Fanatismus und blutigen Exzessen, das Gebot der Nächstenliebe keinen Wider- spruch zu Glaubenskriegen darstellte, kann man die Einflüsse der Religionen nicht genug betonen. Doch wird man sich da- vor hüten müssen, den mittelalterlichen Menschen als rückständig zu belächeln und sich selbst ob seiner aufge- klärten Haltung auf die stolzgeschwellte Brust zu klopfen: Zu vieles an schrecklichen Ereig- nissen ist auch in un- serer jüngeren Geschichte passiert, trotz aller Aufklärung, als dass wir hoffen dürften, wir hätten jenen irrrationalen Teil im menschlichen Selbst überwunden, den wir in den grausamen Blutbädern jener längst vergangenen Epoche zu erkennen glauben ...
Vielfach vernimmt man heutzutage die Meinung, unsere Vorfahren hätten unter der Führung des Papsttums Feuer und Schwert aus dem christlichen Europa in eine friedliche Welt hinausgetragen, rohe Barbaren, die in Länder mit überlegener Kultur einfielen und dort plünderten und verheerten. Man denke da nur an die Plün- derungszüge und Kriege der Normannen, an die Tragödie der Eroberung Konstantinopels im Jahre 1204 durch christliche Kreuz- fahrer unter der Führung Venedigs, an die Kreuzzüge des Deutschen Ordens zur Eroberung und Missionierung des Baltikums, an die Reconquista in Spanien, welche den Mauren nach und nach ihr blühendes Al Andalus entriss ...

Alle dies Ereignisse haben zweifelsohne stattgefunden - und dennoch wird man sich vor einer allzu eindeu- tigen Verurteilung hüten müssen, wer denn nun Aggressor, wer der Überfallenen gewesen sei. Bei der Be- urteilung der damaligen Geschehnisse sollte man die weltgeschichtliche Situation im Auge behalten: Europa, das war zu jener Zeit das fränkische Reich beziehungsweise dessen Nachfolge'staaten', Italien mit dem Patrimonium Petri, Britannien und - an der Schwelle zum Orient und somit beiden Sphären zugehörig - By- zanz.
Dieses christliche Europa war ein von allen Seiten bedrängtes Gebiet: Im 7. Jahrhundert hatte der Islam seinen beispiellosen Eroberungszug begonnen. Unter seinen Schlägen war das persische Sassanidenreich gefallen; Byzanz hatte sich nur unter Aufbietung aller Kräfte halten können - doch um welchen Preis! Die reichen Orient- provinzen Ägypten, Syrien und das Exarchat von Karthago waren den Reiterheeren der Araber zum Opfer ge- fallen, die Hauptstadt selbst hatte zwei mehrjährige Belagerungen zu überstehen gehabt. 711 war das christliche Westgotenreich in Spanien dem Ansturm der muslimischen Berber erlegen, die zwei Jahr- zehnte danach sogar ins Frankenreich einfielen und dort erst von Karl Martell aufgehalten werden konnten. Von Sizilien aus, im 9. Jahr- hundert erobert, operierten die arabischen Seeräuber ungehindert die Küsten Italiens hinauf und setzten sich dort in lokalen Stüztzpunkten fest, ja erreichten sogar den St. Bernhard-Pass.
Vom Norden her verunsicherten die Normannen die fränkischen Teilreiche und fuhren brennend und mordend die großen Flussläufe hinauf und vom Osten her fielen immer neue zentralasiatische Nomadenvölker ein, Awaren, Ungarn, Türken ... Bei ihrem Auftauchen kulturell zumeist noch auf niedrigerer Stufe stehend, ver- fügten sie dennoch über ein Selbstverständnis, das sie glauben machte, sie seien für die Weltherrschaft vorbestimmt.
Dass es in jener bedrängten Situation gelungen war, die christliche Identität zu wahren, auf die später Eu- ropa aufgebaut wurde - was immer dieser Begriff auch bedeuten mag - , diese Leistung ist nicht hoch genug einzu- schätzen. Ihr verdanken wir unsere heutigen Wertvorstellungen, unsere Kultur, unseren Lebensstil. Mag man dem nun positiv oder negativ gegenüberstehen. Viel hat das Abendland dabei Byzanz zu danken, das lange Jahrhunderte ein Bollwerk bildete, hinter dem das fränkische Reich in die Nachfolge des weström- ischen Reiches hineinwachsen konnte. Dabei kam auch dem Bündnis der Frankenkönige mit dem Papsttum wesentliche Bedeu- tung zu.
Gerade diese allgegenwärtige Verbindung und Verquickung von Religion und Politik war so entscheidend für den Gang der damaligen Geschichte. Hatten doch erst die neue Religion des Islam die arabischen Stämme geeint und ihnene jene Stoßkraft verliehen, die sie im Verlaufe weniger Jahrzehnte von Indien bis nach Spanien führte. Und auf der anderen Seite sah man sich als Teil einer christlichen Gemeinschaft, welche den Kampf mit der neuen Weltreligion aufzunehmen hatte und der dieser Glaube half, in dieser Auseinandersetzung bestehen zu können.
Und dann waren da noch die theologischen Streitigkeiten innerhalb der Christenheit, aber auch innerhalb des Islams, die immer wieder den Verlauf der Geschichte beeinflussten: Ließ nicht der schwelende Streit zwischen Orthodoxie mit seiner Trinitätslehre und der monophysitischen Glaubensauslegung die Provinzen Ägypten und Syrien (sicherlich neben anderen Gründen) so leicht zur Beute der Araber werden? Anhänger des Nestorianismus wiederum, waren schon früher ins sassanidische Persien emigriert, wo auch die letzten Philosophen der platon- ischen Akademie, nach deren Schließung durch Justinian, Aufnahme gefunden hatten. All das hatte die kaiserlich-oströmische Politik sicherlich nicht vereinfacht. Und der Islam? Sunniten und Schiiten, die verschiedenen Kalifate, ...
Wie sah es im Westen aus? Dort gabe es den katholischen Bischof von Rom, der sich im Laufe der Zeiten immer mehr vom Kaiser in Byzanz emanzipierte und eine zunehmend eigenständige Politik betrieb, - was oftmals auch gegen die Interessen von Ostrom gerichtet war. Und vielleicht sogar sein musste. War doch das Auge des Kai- sers, erzwungen durch die Überlebenskämpfe gegen die Perser und Araber, oftmals nach Osten gerichtet und sah kaum die italienischen Probleme. Diese zunehmende Eigenmächtigkeit der Päpste, die schließlich im Jahre 800 in die Krönung eines westlichen Kaisers in der Gestalt des großen Karls mündeten, stellte sicherlich einen Grund, wenn auch nicht den einzigen, dar, der zur zunehmenden Entfremdung zwischen griechischer Ost- und latein- ischer Westkirche führte. Einer Entfremdung, die soweit ging, dass sich die christlichen Heere im Verlaufe des vierten Kreuzzuges gegen Konstantinopel selbst lenken ließen.
Aber dieser katholische Papst hatte zuvor noch eine Auseinandersetzung gegen eine gefährliche christliche Häre- sie zu gewinnen: Viele jener germanischen Völker die in das weströmische Reich eingeströmt waren um dort ei- gene Herrschaften zu begründen, etwa Goten, Vandalen und Langobarden, hingen der Lehre des Arius an und standen so im Gegensatz zur römischen Kirche und zu einer katholischen Bevölkerungsmehrheit. Bündnisse, Ver- folgungen, Übertritte waren die Folge - Ereignisse, welche die Politik und dem Verlauf der Geschichte immer neue Wendungen gab.
Einige hundert Jahre später war das Papsttum dann aus seiner bedrängten Rolle, in welcher er den Schutz des fränkischen Königs so dringend benötigt hatte, herausgewachsen und hatte in neuem Selbstvertrauen den obersten Führungsanspruch über die christlichen Völker beansprucht. In diesem Geiste und zur Untermauerung dieses Anspruches wurden die Kreuzzüge initiiert. Das unselige Ringen und die Auseinandersetzungen mit den salischen und staufischen Kaisern um Macht und Einfluss war eine Folge dieses gewachsenen Selbstverständ- nisses und beeinflusste wiederum den Gang der Dinge ...
Vieles mehr gäbe es an dieser Stelle noch über all die Verquickungen von Religion und Politik zu sagen. Aller- dings muss dies aus Zeit- und Platzgründen vorerst unterbleiben. Doch soll zumindest einiges davon in späteren Artikeln angesprochen werden und so hoffen wir, dass uns der geneigte Leser auch weiterhin sein Auge leihen möge ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Patrimonium Petri
Frühmittelalter

774 - Ein Rechtsgeschäft zwischen Papst Hadrian und dem Frankenkönig Karl
Der Abschluss von (bedeutenden) Rechtsgeschäften im Mittelalter erforderte die Einhaltung bestimmter Regeln, die üblicherweise eine Mischung verschiedener Elemente darstellten. Dadurch sollte die Vertragserfüllung sicher- gestellt werden. Wenn aber eine der Vertragsparteien die Kirche war, insbesondere der Papst, als deren höch- ster Vertreter, dann standen dem Nachfolger Petri über diese Regeln hinaus noch weitere Hilfsmittel zu Gebote. Die Vorgangsweise bei solchen Vertragsabschlüssen soll hier exemplarisch an einem Schenkungsvertrag darge- stellt werden, den der Frankenkönig Karl der Große mit Papst Hadrian I. 774 zu Gunsten der Kirche abschloss.
773 erreichte Karl ein Hilfeersuchen Papst Hadrians, als zum wiederholten Male die Langobarden unter König Desiderius Rom bedrängten. Der Frankenkönig führte sein Heer nach Italien und konnte bereits nach kurzer Zeit einen vollständigen Triumph feiern - wohl auch deshalb, weil die Langobarden uneins waren und viele bedeu- tende Herren zu ihm überliefen. Nach der Eroberung von Pavia konnte sich Karl fortan auch als König der Lango- barden bezeichnen.

Karl, der auch den Titel eines Patrizius von Rom führte, wurde unter großem Jubel vom Papst und den römischen Würdenträgern empfangen. Die folgenden Tage nützte der Frankenkönig zur Besichtigung der heiligen Stätten und der zahlreichen Sehenswürdigkeiten Roms aber auch zur Festigung der schon traditionellen Bande zwischen Papstum und Frankenreich. Die Ereignisse wurden von Einhard, dem Biographen Karls, der kein besonderes Interesse daran hatte, die Rolle des Papstes überzubewerten, sehr kurz gefasst:
Dieser Krieg endete übrigens damit, dass Italien unterjocht, König Desiderius auf Zeitlebens verbannt, sein Sohn Adalgis aus Italien vertrieben und die Eroberungen der Langobardenkönige dem Hadrian, dem Lenker der römischen Kirche, wieder übergeben wurden. (Einhard: 'Annales regni Francorum')
Naturgemäß ganz anders, nämlich viel ausführlicher, sind die damaligen Vorkommnisse in der Vita Papst Hadrians beschrieben, profitierte doch die Kirche wesentlich von diesem Vertrag:
Auf eigenen Wunsch und guten und freien Sinnes befahl der genannte und wirklich allerchristlichste König Karl, nach dem Muster der ersten Schenkung [Anmerkung: Hier wird auf die Pippinische Schenkung Bezug genommen] ein anderes Schenkungsversprechen durch Itherius, seinen frommen und höchst klugen Kapellan und Notar, schreiben zu lassen, worin er jene Städte und Territorien dem seligen Petrus gewährte und zu übergeben versprach innerhalb der bezeichneten Grenzen, wie sie in jener Schenkung offensichtlich enthalten sind, nämlich: Luna mit der Insel Korsika, dann nach Soriano, dann zum Monte Bardone, das ist Berceto, dann nach Parma, dann nach Reggio; und weiter nach Mantua und um Monselice, desgleichen auch der gesamte Exarchat von Ravenna, wie er von alters her war, und die Provinzen Venetien und Istrien; und ebenso die Herzogtümer Spoleto und Benevent.
...
Nachdem diese Schenkungsurkunde hergestellt und jener aller christlichste König sie mit eigener Hand bekräftigt hatte, ließ er alle Bischöfe, Äbte, Herzöge und auch Grafen in sie hineinschreiben. Zunächst legten sowohl der König der Franken wie seine Großen diese Schenkung auf dem Altar des seligen Petrus und dann in dessen heiliger Confessio nieder und übergaben sie dem seligen Petrus und dessen Vikar, dem allerheiligsten Papst Hadrian, unter einem entsetzlichen Eidschwur und versprachen, daß sie alles, was in jener Schenkung enthalten sei, bewahren wollten. Jener allerchristlichste König ließ Itherius ein zweites Exemplar jener Schenkung schreiben und legte dieses mit eigenen Händen in das Grab hinein auf die Reliquien des heiligen Petrus, unter das Evangelium, das dort geküßt wird, als sicherste Bürgschaft und ewiges Gedächtnis seines Namens und des Reiches der Franken. Ein weiteres, vom Scriniar unserer heiligen römischen Kirche ausgefertigtes Exemplar nahm seine Hoheit mit sich nach Hause.
(Aus der Vita des Papstes Hadrian, nach Hägermann: 'Karl der Große'))
Im Vorgang dieser Schenkung lassen sich als verschiedene Elemente dieses Rechtsgeschäftes ausmachen:
- Schriftlichkeit
- Übergabe einer Sache mittels Symbol oder Urkunde
- eigenhändige Unterfertigung durch den König
- Ausfertigung einer Zeugenliste und Bekräftigung durch Unterschrift/Zeichen
Nur der Kirche standen die folgenden zwei Besonderheiten zur Verfügung, um einem Vertrag besonderes Gewicht zu verleihen:
- die Niederlegung eines Vertragsexemplars am Grabe eines (in diesm Fall sehr bedeutenden) Heiligen
- Sicherung des Eides durch einen 'entsetzlichen Schwur' - eine Selbstverfluchung, die dann zum Tragen kommen soll, wenn ein Bruch des Vertrages erfolgt
Man braucht an dieser Stelle nicht extra anzumerken, dass die letzten beiden Punkte eine besondere Motivation für den gläubigen Menschen des Mittelalters dargestellt haben müssen, drohten ihm doch bei Vertragsbruch ewige Verdammnis und Höllenqualen. Die im zweiten Punkt angesprochenen sogenannten Poenformeln, man könnte sie als Strafandrohung bei Zuwiderhandlung bezeichnen, stellten speziell im frühen Mittelalter ein gängiges Mittel der Kirche dar, um eine Vertragseinhaltung sicherzustellen.
Abschließend sei noch bemerkt, dass der volle Umfang dieser sogenannten Schenkung auch von Karl niemals erfüllt wurde oder erfüllt werden konnte. Man einigte sich später auch so - Realpolitik eben ... Denn auch die Kirche selbst war ja nicht zimperlich bei der Interpretation von Verträgen: Schließlich tauchte vermutlich um diese Zeit ein Dokument auf, das die angebliche Abtretung des westlichen Reichsteils an Papst Silvester durch Kaiser Konstantin beweisen sollte und das von der Kirche jahrhundertelang als Rechtfertigung ihrer Machtansprüche verwendet wurde. Tatsächlich handelte es sich bei dieser sogenannten Konstantinischen Schenkung aber um eine Fälschung - allerdings konnte dies erst im 15. Jahrhundert nachgewiesen werden.
Die Schenkungsurkunde Karls, von der hier die Sprache ist und die der päpstlichen Kanzlei gleich in zweifacher Fertigung vorlag, ging übrigens verloren. Und dies, obwohl doch der Vatikan für seine akribisch genaue Archi- vierung bekannt ist! Könnte dies vielleicht seinen Grund darin haben, dass die darin angeführten Gebietszuweis- ungen nicht mehr mit späteren Machtansprüchen der Kirchenfürsten in Einklang zu bringen waren?
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Das Frankenreich
Frühmittelalter

Pippin der Jüngere erringt seinem Geschlecht die Königskrone des Frankenreichs
Als Karl Martell, der Großvater Karl des Großen, 741 starb, hinterließ er zwei erbberechtigte Söhne: Karlmann und Pippin (den Jüngeren), welche die Herrschergewalt im fränkischen Reich unter sich aufzuteilen hatten. Offiziell bekleideten sie immer noch das inzwischen erbliche Amt der Hausmeier (lat. Majordomus - 'Verwalter des Hau- ses'), wiewohl dieser Posten mittlerweise der einflussreichste im Reich war. Dessen Inhaber führten die Regier- ungsgeschäfte und trafen sämtliche wichtige Entscheidungen. Dennoch herrschten nominell noch immer Könige aus dem Geschlechte der Merowinger über die Franken, wenngleich diese Könige nur noch der Repräsentation dienten und keinerlei wirkliche Macht mehr besaßen.
Nach dem überraschenden Rückzug Karlmanns von sämtlichen Regierungsgeschäften 747 in das Kloster Monte Cassino und der Unterdrückung von nachfolgenden Empörungen (unter anderem seines Halbbruders Grifo) war Pippin Alleinherrscher des Reiches. Zu diesem Zeitpunkt fühlte er sich stark genug, um endlich nach dem Königs- titel selbst zu greifen. Allerdings war bei den Franken die Königswürde von jeher an das Geschlecht der Mero- winger gebunden. Darum war Pippin gezwungen, nach einer geeigneten Legitimation für die Übernahme des Königstitels zu suchen.

Diese Legitimation fand er in Papst Zacharias. Zu diesem Zeitpunkt stellte sich nämlich die Lage in Italien (wie so häufig) einigermaßen verworren und für den Papst sehr bedrohlich dar: Der Süden war noch immer oströmisches Herrschaftsgebiet, während die Gebiete weiter nördlich großteils dem Reich der Langobarden angehörten. Dieses Reich mit seiner Hauptstadt Pavia setzte sich aus mehreren Teilherzogtümern zusammen und bildete kein durch- gängiges Gebiet. Einerseits lag an der oberen Adria das von Byzanz behrrschte Exarchat Ravenna mit der Penta- polis ('Fünfstädte') wie ein Stachel im Fleisch der langobardischen Herrschaft und stellte einen stets umkämpften Zankapfel dar. Andererseits war da noch Rom, der Sitz des Papstes, das sich nominell noch unter byzantinischer Herrschaft befand, allseitig von langobardischem Herrschaftsgebiet umklammert.
Da sich der Papst zu diesem Zeitpunkt stark von den Langobarden bedrängt und bedroht sah, musste er nach einem geeigneten Verbündeten Aussschau halten. Eine Eroberung Roms durch die Langobarden hätte seine Machtposition in jeder Weise erschüttert. Byzanz wollte oder konnte keine Hilfe leisten, auch waren theologische und machtpolitische Differenzen (der Streit um die Natur des Heiligen Geistes, die Frage der Bilderverehrung, die Frage des Primats zwischen dem Patriarchen von Konstantinopel und dem römischen Bischof) zwischen dem Kaiser und der Ostkirche auf der einen und der Westkirche und dem Papst auf der anderen Seite längst offen- kundig. In dieser Situation lag ein Bündnis mit dem mächtigen und zudem katholischen Frankenreich auf der Hand.
Andererseits fühlte sich Pippin 750 in seiner Machtposition so gefestigt, dass er ein italienisches Abenteuer und die Auseinandersetzung mit den Langobarden wagen zu können glubte. In diesem Jahr schickte er eine Dele- gation unter der Führung zweier enger Vertrauter, Burkharts, des Bischofs von Würzburg, und Fulrads, des Abtes von St. Denis, nach Rom, um ein Rechtsgutachten vom Heiligen Stuhl einzuholen. Es ging um die Frage der Königsherrschaft im Frankenreich und die Antwort fiel, der Situation entsprechend, wenig überraschend aus:
Bischof Burchard von Wirzburg und der Kaplan Folrad wurden nach Rom zu Papst Zacharias abgesandt, um seinen Rat einzuholen in Betreff der Könige, die damals im Frankenland waren und nur den Namen eines Königs, aber keine königliche Gewalt hatten. Der Papst ließ durch sie erklären, es sei besser, dass der König heiße, der die höchste Gewalt in Händen habe, und befahl kraft seiner Vollmacht, dass Pippin zum König gemacht werde. (Einhard: 'Annales regni Francorum')
Auf dieses päpstliche Votum hin, wagte Pippin den entscheidenden Schritt: Childerich III., der letzte der mero- wingischen Schattenkönige wurde mitsamt seinen Nachkommen 'geschoren', das heißt hinter Klostermauern verbannt und somit unschädlich gemacht. 751 erhoben die Großen des Reiches Pippin auf den Thron, eine Vorgangsweise, die bereits auf Zukünftiges hinweist, nämlich die Einflussnahme des Adels auf die Königswahl.
In diesem Jahre ward Pippin dem Ausspruch des römischen Papstes gemäß König der Franken genannt, durch die Hand des Erzbischofs und Märtyrers Bonifatius seligen Angedenkens mit heiligem Öl zu der Würde dieser Ehre gesalbt und nach der Sitte der Franken auf den Thron des Reichs erhoben in der Stadt Suessona . Hilderich aber, der fälschlich den Königsnamen führte, wurde geschoren und ins Kloster geschickt. (Einhard: 'Annales regni Francorum')
Auch Pippin hielt seinen Teil der Abmachung ein und eilte dem Papst gegen die Langobarden zu Hilfe. Ravenna wurde erobert und im Zuge der sogenannten Pippinischen Schenkung 756 dem Papst übereignet, was die Grund- legung des Kirchenstaates bedeutete, mit all seinen Auswirkungen in die Zukunft hinein. Lassen wir dazu noch einmal Einhard zu Wort kommen:
In demselben Jahre (754) kam Papst Stephan nach dem Hofgut Carisiacus zu König Pippin und bat, ihn und die römische Kirche
vor der Feindschaft der Langobarden zu schützen. Auch Karlmann, der Bruder des Königs, damals bereits Mönch, kam auf Befehl
seines Abts, um bei seinem Bruder den Wünschen des römischen Papstes entgegenzuwirken. Wie man glaubt tat er es jedoch nur
ungern, indem weder er die Gebote seines Abts hintanzusetzen, noch dieser den Befehlen des Langobardenkönigs, der ihm solches
aufgetragen hatte, zu widerstehen wagte.
Nachdem Papst Stephan von König Pippin die Versicherung des Schutzes der römischen Kirche erlangt hatte, ertheilte er ihm
durch heilige Salbung die königliche Weihe und mit ihm zugleich auch seinen zwei Söhnen Karl und Karlmann; und er blieb den
Winter über im Frankenlande.
...
König Pippin zog auf die Bitte und Aufforderung des römischen Papstes mit Heeresmacht nach Italien, um dem heiligen
Apostel Petrus sein Recht zu verschaffen gegen den König der Langobarden. Da die Langobarden sich zur Gegenwehr stellten und
die Eingänge Italiens verteidigten, kam es an den Gebirgsklausen zu heftigem Kampf, bis endlich die Langobarden zurückwichen und
nun die ganze Macht der Franken auf einem beschwerlichen Wege, aber ohne große Mühe eindrang. Heistulf der König der
Langobarden wagte keinen offenen Kampf und wurde in der Stadt Pavia von König Pippin belagert. Dieser hob die Belagerung
auch nicht eher auf, als bis er zur Sicherheit für die Rückgabe der Gerechtsame der heiligen römischen Kirche vierzig Geißeln
erhalten hatte. Nachdem er diese empfangen und Heistulf sein Versprechen eidlich bekräftigt hatte, kehrte Pippin in sein Reich zurück, und ließ den Papst Stephan von dem Kaplan Folrad und einer nicht geringen fränkischen Mannschaft nach Rom zurückgeleiten.
(Einhard: 'Annales regni Francorum')
Der 'Staatsstreich' Pippins zeitigte mehrere langfristige Auswirkungen: Einerseits festigte er das Bündnis zwischen den karolingischen Frankenherrschern und dem Papst. Gleichzeitig war aber erstmalig ein kirchliches Oberhaupt in die Wahl eines Königs eingebunden, hatte Einfluss auf eine Entscheidung genommen, die bislang gänzlich außerhalb der Machtbefugnis eines Papstes lag. Das Königstum germanischer Prägung war somit zu einem 'Sakralkönigtum' geworden, was unter anderem durch die Salbung des Herrschers bei seiner Krönung zum Ausdruck kam. Mit den Landschenkungen schließlich war der Papst selbst von einem rein geistlichen Führer auch zu einem weltlichen Herrscher mit eigener Machtbasis geworden.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Das Frankenreich
Frühmittelalter

Das fränkische Reich: Latein, die Schriftsprache der Gelehrten
Um die Nachfolge des römischen Imperiums anzutreten, hatte Karl der Große eine Reihe von Feldzügen geführt. Um 800, dem Zeitpunkt der Annahme des Kaisertitels, war die politische Einigung des Kernbereiches des Abendlandes weitgehend vollendet. Doch Karl wollte das Reich auch nach innen festigen und leitete aus diesem Grunde eine bedeutende Erneuerungsbewegung ein, welche die Entwicklung der nächsten Jahrhunderte beeinflussen sollte (Die karolingische Erneuerung).
Eigene Rundschreiben hatten die Ordnung des Reiches und die Ausbildung des Klerus zum Inhalt. An der Aachener Hofbibliothek wurden ebenso wie in den Bibliotheken der bedeutenden Klöster (Reichenau, St. Gallen, Fulda ...) Handschriftensammlungen angelegt, deren Schriften zumeist erst durch aufwändiges Kopieren der wenigen Originale geschaffen werden mussten. Mit den karolingischen Minuskeln wurde eigens zu diesem Zweck eine neue Schriftart geschaffen, welche dieses Abschreiben in den Schreibstuben, den Scriptorien, erleichterte. Diese Bibliotheken erleichterten die Studien und nach dem Vorbild der Hofschule entstanden an allen Klöstern und Kathedralen ebenfalls Schulen, die sich der Ausbildung des Klerus widmeten.

Obwohl Karl die Geistlichkeit anwies, in den Landessprachen zu predigen, wurde dennoch Latein zur interna- tionalen Schriftsprache Europas. Dies hatte seinen Grund darin, dass die Bildungsinhalte, noch von den antiken Autoren übernommen, allesamt in Latein vorlagen. Griechischkenntnisse waren dem Westen hingegen ver- lorengegangen, was die Rezeption griechischer Autoren weitgehend verhinderte.
Die Träger dieser lateinischen Literatur und somit der Bildung waren fast ausschließlich Mönche: Die Literatur des frühen Mittelalters wurde von geistlichen Gelehrten zum überwiegenden Teil wiederum für Gelehrte geschrieben. Sie entstand großteils in den Schreibstuben kirchlicher Institutionen. Erst vier Jahrhunderte später sollten mit dem höfischen Roman und dem Minnesang bedeutende weltliche Literaturformen entstehen.
An dwn Schulen wurde natürlich Latein unterrichtet: Latein war die Sprache der Kirche, von Wissenschaft und Recht, von Verwaltung und Diplomatie. Dabei lernten die Schüler vor allem die Werke alter Autoren kennen. Schließlich galt es im Mittelalter mehr, anerkannte Autoritäten zu zitieren als selbst kühne Neuerungen einzuführen. Als Lektüren sind vor allem die Werke der bedeutenden christlichen Dichter des Altertums zu nennen, aber auch die Klassiker Vergil und Ovid, oder Prudentius. Häufig galt es für den Scholaren dabei, lange Textpassagen auswendig zu lernen.
Neben der Beschäftigung mit dem klassischen Latein der Antike lernte man das sogenannte Mittellatein, eine Form, die zwischen 500 und 1500 in Gebrauch war, und die die lebendige Weiterentwicklung dieser Sprache darstellte. In all den genannten Bereichen wurde dieses Mittellatein wie eine vollwertige Muttersprache ver- wendet und man kann daher mit Fug und Recht den Gebildeten des Mittelalters als zweisprachig bezeichnen.
Anders als dies heute der Fall ist, lebte diese Sprache noch: Ein Großteil der literarischen Zeugnisse wurde in ihr verfasst, man vertraute ihr seine Gedanken an. Und nicht zuletzt ermöglichten Lateinkenntnisse die Konversation zwischen den Gebildeten aller Herren Länder. Dabei erweiterten und veränderten sich Formen und Bedeutungen, muss sich doch eine lebende Sprache stets den Anforderungen der Zeit anpassen. Die Literatursprache, die dadurch entstand, überragte das alte Latein im Umfang. Daneben lebte das Volkslatein in den romanischen Ländern weiter fort und veränderte sich dort nach und nach zu den jeweiligen Landessprachen.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Das Frankenreich
Frühmittelalter

Das fränkische Reich - Die karolingische Erneuerung
In den Wirren der Völkerwanderungszeit entstanden zahlreiche germanische Königreiche auf dem Boden des ehemaligen weströmischen Reiches. Ost- und Westgoten, Vandalen, Burgunder und später die Langobarden gründeten ihre Herrschaften. Von all diesen Reichen hatte alleine das fränkische dauerhaften Bestand. Mit der Taufe des merowingischen Herrschers Chlodwig I. begann bereits im 6. Jahrhundert das geschichtsträchtige Bündnis zwischen römischer Kirche und ihrer fränkischer Schutzmacht. Nach zahllosen blutigen Auseinander- setzungen und Thronstreitigkeiten, die zumeist gewaltsam durch Verwandtenmord bereinigt wurden, hatte sich das fränkische Reich im 8. Jahrhundert endgültig als vorherrschende Macht auf vormals weströmischem Gebiet etabliert. Die realpolitische Macht war in dieser Epoche längst vom merowingischen Königsgeschlecht auf die karolingischen Hausmeier übergegegangen, was sich schließlich auch in der Absetzung des letzten Merowingers Childerich und der Übernahme der Königsherrschaft durch Pippin im Jahre 751 manifestierte.
768 wurden Pippins Söhne Karl und Karlmann von den Großen des Reiches feierlich auf den Thron erhoben und nach Karlmanns Tod, 3 Jahre später, übernahm Karl die Herrschaft im Gesamtreich. Die nun folgende Epoche sollte zu einer der glanzvollsten des mittelalterlichen Europas werden und der ungeheure Tatendrang und die Genialität als Herrscher Karl den Beinamen 'der Große' bescheren.
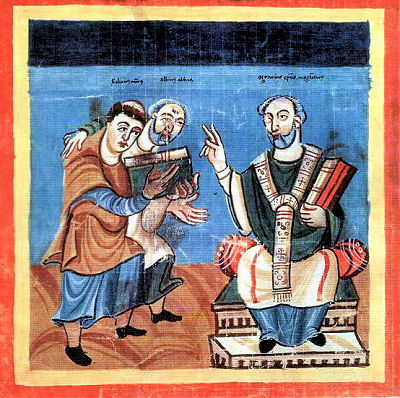
Italien wurde erobert und das Langobardenreich dem Reich eingefügt. Zum Dank für die päpstliche Unterstützung schenkte Karl dem Nachfolger Petri zahlreichen Grundbesitz, woraus der Kirchenstaat entstand. An der Nord- ostgrenze wurden die Sachsen in zahlreichen grausamen Feldzügen unterworfen und zwangschristianisiert, während das auf Unabhängigkeit schielende Bayern wieder botmäßig gemacht werden konnte und dessen Herzog Tassilo in ein Kloster verbannt wurde.
Doch Karl, der zu Weihnachten im Jahr 800 von Papst Leo zum römischen Kaiser gekrönt wurde, war nicht nur der Kriegsfürst. In zahlreichen königlichen Anordnungen, sogenannten Kapitularien, versuchte er Rechtsgrundlagen zu schaffen und Missstände in seinem Herrschaftsbereich zu beseitigen. Die Inhalte der Kapitularien umfassten alle Bereiche der Verwaltung und Rechtspflege, der Rechtssicherheit, der gerechten Verteilung von Lasten, insbesondere auch der Heerfolge, des Schutzes der Untertanen vor der Willkür königlicher Beamter. Sie befassten sich aber auch mit kirchlichen Fragen, so etwa, wie eine Erhöhung der Moral der Geistlichkeit zu erreichen sei. Das oberste Ziel dabei ist die Schaffung und Festigung geordneter Zustande im Reich.
Unter Karls Herrschaft erlebte Europa nach den dunklen Jahren der Völkerwanderungszeit einen ersten Wieder- aufstieg von Kunst und Wissenschaft, der als karolingische Renaissance bezeichnet wird. Zahlreiche prächtige Bauten entstanden, welche die Herrlichkeit des Reichs repräsentieren sollten - allen voran die Marienkirche zu Aachen, der Hauptresidenz des Kaisers. Zahlreiche weitere Pfalzen entstanden, bei Mainz wurde eine 500 Meter lange Brücke über den Rhein erbaut.

Karl ließ die Heldengesänge, in denen die Taten und Kriege der alten Könige besungen wurden, aufzeichnen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten sollten - verloren gingen diese unersetzlichen Kulturschätze in späterer Zeit dennoch. Er machte sich daran, eine Grammatik seiner Muttersprache zu verfassen, einer Sprache an der Wende vom germanischen Idiom zum Althochdeutschen, und er führte deutsche Bezeichnungen etwa für die Monate ein - so hat sich der Begriff des Wonnemonats ja noch bis heute erhalten. Doch auch fremde Sprachen suchte er zu erlernen und den Wissenschaften gegenüber zeigte er sich aufgeschlossen und als deren Förderer. An seinem Hof versammelte er die bedeutendsten Geister seiner Zeit - Alcuin, Berühmtester der Gelehrten, der gotische Dichter Theodulf, Paulus Diaconus, Peter von Pisa und wie sie alle hießen. Von hier strahlte das geistige Leben in alle Richtungen aus und zahlreiche begabte Schüler wuchsen heran: Einhard, dem wir die spätere Biographie des Kaisers verdanken, Angilbert und noch viele andere. All die großen Geister bildeten mit dem Kaiser zusammen eine gelehrte Tafelrunde, deren Teilnehmer sich Beinahmen nach großen Vorbildern aus Geschichte und antiker Literatur zulegten, die ungezwungen in großer geistiger Freiheit miteinander disputierten und die sich von den wunderschönen Töchtern ihres Herrn inspirieren ließen. Poetische Literatur entstand, die ihre Vorbilder in den klassischen römischen Dichtern suchte, durchaus auch weltliche Literatur, jedoch immer von christlichen Geist durchtränkt.
Schulen entstanden; Karl selbst suchte darauf zu wirken, dass die Ausbildung verbessert wird, wie der Auszug aus einem an die Metropoliten, Bischöfe und Äbte des Reiches gerichteten Schreiben zeigt:
'Es sei Eurer Gott wohlgefälligen Frömmigkeit bekannt, wie wir samt unseren Getreuen es für nützlich erachtet haben, dass
die unserer Regierung anvertrauten Bischofsitze und Klöster außer einem der Ordensregel ent- sprechenden Lebenswandel und
der Übung der heiligen Religion ihren Fleiß auch auf die Beschäftigung mit den Wissenschaften und die Unterweisung
derjenigen richten, die vermöge der Gabe Gottes lernen können, nach der Fähigkeit eines jeden. . . .
Denn da uns in den letzten Jahren von verschiedenen Klöstern öfters Schreiben zukamen, in denen angezeigt wurde, wie die in denselben wohnenden Brüder mit frommen und heiligen Gebeten für uns streiten, so haben wir aus den meisten Schreiben zwar
ihren guten Willen aber auch ihre ungebildeten Reden erkannt; denn was die fromme Demut innerlich treu eingab, das
konnte äußerlich wegen des vernachlässigten Unterrichts die ungebildete Sprache ohne Fehler nicht ausdrücken. Darum
kam die Befürchtung in uns auf, es möchte, wie die Kunst des Schreibens gering war, so auch und weit geringer als
recht die zum Verständnis der heiligen Schriften nötige Bildung sein. . . .
Daher erwähnen wir Euch, nicht allein Eure wissenschaftliche Bildung nicht zu vernachlässigen, sondern
auch das Ziel Eures Lernens darauf zu richten, daß Ihr leichter und richtiger in die Geheimnisse der göttlichen
Schriften eindringen könnet. Es sollen aber zu diesem Zweck solche Männer gewählt werden, welche den Willen und die
Fähigkeit zu lernen und zugleich den Trieb haben, andere zu unterrichten.'
Die Hofschule wurde durch die Berufung auswärtiger Gelehrter zur eigentlichen Hochschule. In Reichenau und Tours öffneten Schulen, in Utrecht, Freising, ebenso die Klosterschule Fulda. Unterricht fand in den sieben freien Künsten statt, die da sind: Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Astrologie und Musik. Bücher und Handschriften wurden systematisch abgeschrieben und in klösterlichen Bibliotheken gesammelt.
Aus dem Aufblühen der Wissenschaften und der Künste heraus entstand das Verlangen nach einer klaren, verständlichen Wiedergabemöglichkeit des Wissens in Form einer verbesserten Schrift - die karolingische Minuskelschrift wurde entwickelt. Verbesserte Orthographie und Interpunktation erhöhten die Lesbarkeit ...
Diesem ersten Wiedererheben von Kunst und Wissenschaft war keine Dauer beschieden. Nach dem Tode Karls versank Europa wiederum für lange Zeit in Wirren, ehe sich im Zeitalter von Aventüre und Minne ein neuerliche Aufbruch anbahnte. Lehrstoffe und Lernmethoden jedoch, wie sie unter Karl eingebürgert wurden, sollten für das ganze Mittelalter maßgebend bleiben ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Katastrophen -
Mensch und Natur

Die Hungersnot des Jahres 850 aus der Sicht der Fuldaer Annalen
Im Zuge der Völkerwanderungszeit gingen viele Kulturerrungenschaften der Antike verloren. Die Städte verödeten oder sanken zu kleinen Siedlungen herab. So lebte der überwiegende Anteil der frühmittelalterlichen Bevölkerung von den Erträgen einer Landwirtschaft, die sich auf sehr einfachem Niveau befand. Das Kummet war noch nicht bekannt, wodurch das Pferd als Zugtier ausschied, ebensowenig effektive Pflugformen. Man betrieb einfache Zweifelderwirtschaft, das heißt, es wurde jährlich zwischen Brachlegung und Getreidenutzung ge- wechselt - die eine Hälfte des Ackerlandes wurde also bebaut, die andere Hälfte lag brach, damit der Boden sich erholen konnte. Dazu verwendete man Getreidearten, die einen vergleichsweise geringen Ertrag abwarfen. (Man schätzt, dass vor dem 10 Jahrhundert der Ernteertrag das Fünfache der Saatmenge kaum überstiegen haben dürfte.) Nagetiere, gegen die keine wirksamen maßnahmen bekannt waren, dezimierten zusätzlich das gelagerte Saatgut.
Die Bevölkerungsdichte war insbesondere in den Ländern nördlich der Alpen sehr gering und die einzelnen, meist kleinen Siedlungen, die häufig auch nur schwer erreichbar waren, lagen weit voneinander entfernt. Ein Straßennetz wie zu römischen Zeiten existierte nicht mehr. Die großflächige Lagerhaltung und ein weiträumiger Verteilungsprozess von Lebensmitteln in Notzeiten war aus diesem Grund kaum zu bewerkstelligen. Aus diesem Grund waren die Menschen dieser Zeit besonders anfällig gegen Naturkatastrophen wie Hagel und Unwetter, Dürren und harte Winter, mündeten doch derartige Ereignisse zwangsläufig in Hungersnöten. Häufig, jedoch nicht immer, blieben diese lokal begrenzt - etwa wenn Hagelunwetter die Ernte vernichteten. Aufgrund der verkehrs- technischen Gegebenheiten, sowie der Tatsache, dass kaum Überschussproduktion erzielt werden konnte, war jedoch sogar in diesen Fällen die Hilfe von außen kaum möglich - selbst wenn es eine funktionierende Zentral- gewalt gab. Untersuchungen von Skelettfunden aus dem Frühmittelalter belegen weitverbreitete Mangeler- scheinungen durch nicht ausreichende Nahrungsversorgung - ein Umstand, der insbesondere auch die hohe Kindersterblichkeit jener Zeit mitverschuldet hat.
Das lebensnotwendige Getreide war in Notzeiten allenfalls noch in klösterlichen Speichern oder auf den Königs- gütern vorhanden - was die Preise in Hungerzeiten stark ansteigen ließ (Man schätzt etwa den weiter unten angegebenen Preis von 10 Siclen Silber auf das Zwanzigfache des in Normalzeiten vorgeschriebenen Höchst- preises für ein Modius Getreide!) Als einzige Hoffnung für die bäuerliche Bevölkerung blieb oft nur noch die Fürsorgeder reichen Grundherren oder der Klöster, welche aus Christenpflicht die Armenspeisung zu leisten hatten. Ein Auszug aus klösterlichen Annalen des 9. Jahrhunderts vermittelt ein Bild von der Not, die im Gefolge von wiedrigen klimatischen Bedingungen auftraten:
In demselbigen Jahre drückte schwere Hungersnot die Völker Germaniens, vornehmlich die um den Rhein wohnenden; denn 1 Modius Getreide wurde in Mainz für 10 Siclen Silber verkauft. Es hielt sich aber zu der Zeit der Erzbischof Hraban auf einem Hof seiner Parochie auf, der den Namen Winkela hat, wo er die Armen, welche von verschiedenen Orten kamen, aufnahm und täglich mehr als 300 speiste, die abgerechnet, welche beständig bei ihm aßen. Es kam auch ein Weib zu ihm, vom Hunger fast getödtet, mit einem kleinen Knäblein, und verlangte mit den andern erfrischt zu werden. Doch ehe sie die Schwelle der Tür überschritt, stürzte sie vor allzu großer Schwäche zusammen und hauchte den Geist aus. Und der Knabe, wie er die Brust der todten Mutter, als wenn sie noch lebte, aus dem Busen zog und zu saugen versuchte, brachte viele, die es ansahen, dahin zu seufzen und zu weinen.

Auch zog in diesen Tagen Einer von Grabfeldon mit seinem Weibe und seinem kleinen Sohn aus nach Thüringen, um das Elend seiner Noth zu lindern, und auf dem Weg in einem Wald machte er Halt und redete sein Weib also an: "Ist es nicht besser, daß wir den Knaben hier tödten und sein Fleisch essen, als daß wir alle vor Hunger umkommen?" Als sie jedoch widersprach, daß er solch ein Verbrechen nicht begehen sollte, riß er endlich, weil der Hunger drängte, gewaltsam den Sohn aus den mütterlichen Armen, und er hätte seinen Willen durch die Tat erfüllt, wäre ihm nicht Gott in seiner Erbarmnis zuvorgekommen. Denn, wie derselbe Mann nachher in Thüringen sehr vielen erzählte, als er den Degen aus der Scheide gezogen hatte um den Sohn zu schlachten, und schwankend den Mord aufschob, sah er von ferne zwei Wölfe bei einer Hirschkuh stehen und ihr Fleisch zerreißen; und sogleich lief er, den Sohn verschonend, zu dem Aas der Hirschkuh, trieb die Wölfe fort von da, nahm von dem angefressenen Fleisch und kehrte mit dem unversehrten Sohne zu der Frau zurück. Vorher nämlich, als er den Sohn aus den Händen der Mutter genommen hatte, war er etwas seitwärts gegangen, damit sie den Knaben nicht sterben sähe oder hörte. Die aber, wie sie den Mann kommen sah mit dem frischen blutbeströmten Fleische, glaubte, daß ihr Sohn getötet sei, und fiel rücklings fast leblos nieder. Er aber kam hinzu, tröstete sie, richtete sie auf und zeigte ihr den lebenden Knaben. Da nun athmete sie auf und dankte Gott, daß sie für werthgeachtet sei, ihren Sohn wieder zu bekommen; nicht weniger auch jener, daß ihn Gott rein vom Mord des Kindes zu erhalten gewürdigt habe. Beide jedoch, durch Notwendigkeit gezwungen, erholten sich an dem durch das Gesetz verbotenen Fleische.
Ausschnitt aus den Annales Fuldenses für das Jahr 850 (Bei den Annales Fuldenses, aufgezeichnet von Einhard und fortgeführt von Rudolf aus dem Kloster Fulda handelt es sich um die bedeutendste historiographische Quelle, die über das ostfränkische Reich im 9. Jh. berichtet. Sie enthalten zahlreiche Nachrichten über das karolingische "Ostland", die in keiner anderen Quelle zu finden sind.)
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Schachzabel
Handwerk und Spiel

Schachzabel, Spiel der Oberschicht - Teil II: Von Indien ins Kalifat
Zum Artikel Schachzabel, Spiel der Oberschicht - Teil I: Die Ursprünge ...
Die meisten Forscher, die sich mit der Geschichte des Schachspiels beschäftigen, vermuten dessen Entstehung - zumindest in Vorformen - in Indien. Von dort scheint sich das Spiel in zwei Richtungen ausgebreitet zu haben: einerseits in östliche Richtung nach China (wo ab dem 8. Jahrhundert eine gänzlich andere Variante des Spieles sich entwickelte) und in Folge auch nach Japan (in der Mitte des 11 Jahrhunderts tauchen dort die ersten Shogi-Schachsteine auf), andererseits westlich, ins persische Reich der Sassaniden.

Über die erstmalige Ankunft des Spiels am königlichen Hof zu Ktesiphon, weiß der große persische Nationaldichter Firdausi in seinem berühmten Buch der Könige (?ahnameh), das um das Jahr Tausend herum in fünfunddreißigjähriger Arbeit entstanden ist, folgende Anekdote zu berichten:
Im 6. Jahrhundert ließ der indische Radscha von Kanjau eine Gesandtsachft an den großen König (Schah) Chosrau I. Anuschirvan (532-578) eine Gesandtschaft ergehen. Diese führte eine Karawane aus 1200 Kamelen und 90 Elefanten mit sich. Auf den Rücken der Kamele befanden sich als prunkvolle Geschenke an den Großkönig all die sagenhaften Schätze Indiens: Gold und Geschmeide, Moschus, Weihrauch, Seidenstoffe und wertvolle Waffen. Und noch etwas führten die indischen Gesandten mit sich - ein in Persien unbekanntes Spiel. Dieses bestand aus 32 Figuren, aus rotem Rubin und grünem Smaragd gefertigt, sowie einem wertvollen Spielebrett, das aus 64 Feldern bestand.
Als König Chosrau nun erstaunt das prunkvolle Spiel betrachtete und nach einer Anleitung fragte, sprach der indische Gesandte: 'Wenn ihr die Weisheit besitzt, die Regeln dieses Spieles zu enträtseln, dann will euch mein Herr künftig untertan sein und Tribut zollen. Gelingt euch dies aber innerhalb einer Frist von sieben Tagen nicht, dann sollt ihr fortan meinem Herrn untertan sein!' Nach einigem Zögern nahm der König die Bedingungen an, um sich nicht den Vorwurf mangelnder Weisheit auszusetzen.
Sieben Tage später betrat der indische Gesandte, mit der freudigen Gewissheit auf den bevorstehenden Triumph, wiederum den Empfangssaal. Doch wie wurde er überrascht, als ihm der Berater Chosraus die Spielregeln zu nennen mochte. Dieser hatte erkannt, dass die Anordnung der Figuren die Aufstellung von Armeen mit Streitwagen, Elefanten, Reitern und Fußvolk nachbildete und so die Zugmöglichkeiten und Regeln ergründen können.
Was an dieser Anekdote Firdausis, der sich auf einen älteren Text aus dem 9. Jahrhundert stützt, der Wahrheit entspricht, lässt sich nicht mehr mit Bestimmtheit sagen. Jedenfalls war das Spiel im Reich der Sassaniden angelangt und hier sollte es auch seinen endgültigen Namen erhalten, der sich auf das persische Wort für König (Schah) zurückführen lässt. Schachmatt (altpersischen Schah mat) bedeutet somit nichts anderes als 'der König ist tot'.

Ein Jahrhundert später war es vorbei mit der Herrlichkeit der Sassaniden. Erschöpft von unzähligen Grenzkriegen und der langen Auseinandersetzung mit Ostrom, erlag das Reich dem plötzlichen Ansturm des Islam. In den Schlachten von Kadesia (637) und Nihawand (642) wurde der persische Widerstand von den angreifenden Arabern gebrochen und nach der Ermordung des letzten Sassanidenherrschers Yazdegerds III. 651 hatte das persiche Reich aufgehört zu bestehen. In den folgenden Jahrzehnten arrangierten sich die einheimischen Großen mit den Eroberern und die Bevölkerung konvertierte bald zum neuen Glauben. Andereseits übernahmen die Araber viel von der einheimischen Kultur - unter anderem auch die Kenntnis des königlichen Spiels, dass sich im Gefolge ihres unvergleichlichen Siegeslaufes rasch über weite Teile der damals bekannten Welt ausdehnte.
In Persien selbst wurden alte Traditionen und Geschichtsbewusstsein auch unter der neuen Herrschaft nicht vergessen. Firdausis Königsbuch ist ein Beweis dafür, ebenso wie die Legende von der Entstehung des Schachspiels, die vom Perser Ibn Khallikan im 13. Jahrhundert erzählt wird:
Unter der zügellosen Herrschaft des Radscha Shihram geriet sein indisches Reich in Not und Elend. Um die Aufmerksamkeit des Königs auf seine Fehler zu lenken, ohne dabei dessen Zorn zu erwecken, schuf der weise Brahmane Sissa ibn Dahir ein Spiel, in dem der König ohne die Hilfe anderer Figuren und Bauern nichts bewirken kann. Nur wenn alle Spielsteine ein gemeinsames Ziel verfolgen, kann das Spiel gewonnen werden. Der Herrscher verstand den versteckten Hinweis und er besserte sein Verhalten fortan. Das Reich erholte sich und der Wohlstand nahm zu. Dem Weisen jedoch versprach er jede Belohnung, die dieser verlangen würde. Dem weisen Sissa bot sich so eine weitere gute Gelegenheit, dem hochmütigen Herrscher noch einmal eine Lehre zu erteilen, diesmal eine Lehre der Bescheidenheit. Er wünschte sich folgende Menge Weizen: für das erste Feld des Schachbretts ein Korn, für das zweite zwei Körner, für das dritte die doppelte Menge, 4 Körner, für das vierte wieder die doppelte Menge, also 8 Körner, und für jedes weitere Feld immer die doppelte Menge des Vorgängerfeldes. Der König war zunächst verwundert und erbost über die vermeintliche Bescheidenheit, stimmte jedoch endlich zu. Bald jedoch verkündigte der Vorsteher der Kornkammer, dass es so viel Weizen im ganzen Reich nicht gäbe, und der Herrscher musste zerknirrscht die neuerliche Lektion zur Kenntnis nehmen ...
Der weitere Weg des Spiels wird in den nächsten Folgen dieser Reihe beschrieben werden. Da mögt ihr auch etwas über den Stellenwert erfahren, den es bei den Arabern besaß und wie diese seine Regeln und sein Aussehen veränderten ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Gestik
Gesellschaft und Kunst

Gesten, Gebärden und Rituale - Kommunikation im Mittelalter, Teil II
Zum Artikel Gesten, Gebärden und Rituale - Kommunikation im Mittelalter, Teil I ...
Nur ein verschwindend geringer Teil der mittelalterlichen Bevölkerung war des Schreibens und Lesens mächtig. 5% bis maximal 10% schätzt man für die städtische Bevölkerung im 14. Jahrhundert und am Lande wird der Prozentsatz noch geringer gewesen sein. Wer immer an die Menschen eine Botschaft vermitteln wollte, musste dies mit Worten tun oder aber in Form von Bildern, sei es nun durch figürliche Plastik oder Malerei.
Die Kirche war interessiert, Glaubensinhalte auch dem einfachen Volk zu vermitteln - dies geschah einerseits durch Predigt und durch das religiöse Lied, vor allem aber auch durch die vielen Darstellungen in den Kirchen und Kathedralen. Das wichtigste Mittel zur Wissensvermittlung blieb über Jahrhunderte hinweg die bildliche Darstellung (und, denken wir an unsere Jugendjahre zurück, haben wir nicht auch den einen oder anderen intellektuellen Anstoß beim Lesen von Comics erhalten?). Nicht umsonst steckt ja im Begriff Bildung das Wort Bild.
Den Menschen war diese Bildersprache geläufig - für uns muss vieles davon verschlossen bleiben, da das notwendige Wissen dazu nicht mehr vorhanden ist. So können wir bei vielen Darstellungen, seien diese nun religiöser oder profaner Natur, allenfalls aus dem Zusammenhang heraus gewisse Vermutungen anstellen. Als Beispiel soll hier die Darstellung des Herrn Dietmar der Sezzer, eines im Codex Manesse angeführten Dichters, dienen:

Die Darstellung scheint sich uns in ihrer blutigen Eindeutigkeit auf den ersten Blick zu erschließen: Zwei Kämpfer in voller Rüstung liefern sich einen ritterlichen Schwertkampf. Die Entscheidung ist soeben gefallen, wie sich unschwer aus gespaltenem Helm und weithin spritzendem Blut erkennen lässt. Drei Damen, die von den Zinnen einer Burg oder einer Stadtmauer das Geschehen beobachten, scheinen auf den ersten Blick ob des Gesche- henen hellauf begeistert zu sein (ja ja, die Frauen, das angeblich zartfühlende Geschlecht ...)
Doch beim zweiten Hinsehen kommt leichter Zweifel an dieser Deutung auf. Offensichtlich haben nicht alle Zuseherinnen den selben Kämpfer im Blick. Während die linke Dame im Purpur den Sieger bewundert, Blick und Gestik sprechen eine eindeutige Sprache, sind wir uns über die Haltung der beiden anderen nicht im Klaren. Liegt nicht Bedauern oder gar Schmerz über das beklagenswerte Schicksal des Unterlegenen in ihren Gesichtern?
Und tatsächlich zeigt uns der vergleichende Blick auf andere zeitgenössische aber auch spätere Darstellungen, dass die Handgesten der Dame in Rot - verschränkte Hände und die in Brusthöhe angewinkelten Arme - tatsächlich als Zeichen von Betroffenheit oder gar Verzweiflung gedeutet werden können. Ebensolches gilt für die blaue Dame, deren Gestik - angewinkelte Arme mit nach vorne weisenden Handflächen - sich als Abwehrhaltung deuten lässt, die Ablehnung oder Abscheu über das Geschehene ausdrückt. Also scheint es uns nun, als würden zwei der Zuseherinnen den Tod oder zumindest die schwere Verwundung des Besiegten bedauern, während die dritte den Sieger uneingeschränkt bewundert. Vielleicht hatte ja der Illustrator wirklich dies im Sinne ...
Andererseits - handelt es sich tatsächlich um drei zusehende Damen? Um Individuen? Denn häufig bediente man sich bei der Darstellung einer Gruppe von Personen der Zahl Drei. Drei Menschen steigern nämlich das "ich" und "du" (zwei Personen) ins "wir" - die Gruppe. Drei Menschen können demnach sinnbildlich für eine Gruppe stehen. Dann würde unsere Auslegung so aussehen, dass eine Gruppe von vornehmlich weiblichen Zusehern dem Kampf zweier Ritter folgt, wobei die Sympathien, Freude und Bedauern, unter den Schaulustigen geteilt sind ...
Wie man sieht, tun sich eine Menge von Deutungen auf. Welche davon die 'Richtige' ist, wird sich aber in vielen Fällen nicht mehr mit Gewissheit sagen lassen ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Dichtung
im Mittelalter

Altfranzösische Dichtung - Die Lais der Marie de France
Dichtung im Mittelalter war vorrangig Männersache: Ob höfischer Roman, Heldenepos oder Minnelied - stets sind die Autoren männlich. Die Werke einer Hildegard von Bingen oder eine Mechthild von Magdeburg hingegen sind Aufzeichnungen mystischer Erlebnisse, die auf Zuspruch Vertrauter hin niedergeschrieben wurden, und können als solche nicht mit der weltlichen Literatur jener Zeit verglichen werden.
Dennoch gab es auch Frauen, die höfische Literatur produzierten, wie etwa jene Christine de Pizan aus dem 14./15. Jahrhundert, die vermutlich als erste Frau den Lebensunterhalt durch ihre Schreibkunst bestreiten konnte. Oder, rund 200 Jahre zuvor, Marie de France, die bereits zu Lebenszeit berühmt und von ihren Zeitgenossen hoch geschätzt wurde.
Von Maries Leben ist, wie dies für fast alle mittelalterlichen Dichter gilt, kaum etwas Gesichertes bekannt. Dennoch lässt sich aus den spärlichen Hinweisen in ihren Werken und aus zeitgenössischen Quellen einiges herauslesen - bezeichnet sie sich selbst doch am Ende ihrer Fabelsammlung Esope als 'Marie ai nun, si suis de France' (Maria heiße ich und bin aus Frankreich). Sie dürfte um 1130 bis 1200 gelebt haben und ist somit die erste namentlich bekannte französische Dichterin. Dass sie von hohem Stande war, kann aufgrund ihres Umganges mit hochrangigen Persönlichkeiten sowie ihrer umfassenden Bildung als gesichert gelten. Von manchen Seiten wird sogar eine verwandtschaftliche Beziehung mit dem normannisch-englischen Königshaus der Plantagenêts angenommen. Jedenfalls dürfte sie, aus Frankreich stammend, in England für den englischen Hof Heinrichs II. gedichtet haben. Ihre Werke sind in anglonormannischem Dialekt verfasst, also in jener mit angelsächsischem Wortschatz versetzten französischen Sprache der normannischen Eroberer Englands.
Maries bekannteste Werke sind die 12 sogenannten Lais. Dies sind kürzere Verserzählungen, die zwischen 100 und 1000 Versen in paarweise gereimten Achsilbern umfassen und in denen man schon die erste Vorboten der späteren Novellistik zu erkennen glaubt. Meist haben diese Erzählungen die sogenannte Matière de Bretagne zum Inhalt, also Sagenstoff, der bretonischen und britannischen, also keltischen, Quellen entstammt.

Mit einer wahrscheinlichen Entstehungszeit um 1170 sind die Lais etwa zeitgleich den höfischen Verserzählungen eines Chrétien de Troyes, die ebenfalls den Artuszyklus zum Inhalt haben. In den Lais vermischen sich die Motive der bretonischen Märchenwelt, wie Feen, Avalon, verzauberte Nachen oder die Jagd auf die weiße Hirschkuh, mit allgemeinen Märchenmotiven wie dem der Wiedererkennung der Liebenden, dem Werwolf, dem Vogel als Liebesboten. Ebenso finden sich literarische Motive - und dies alles vor dem sehr real geschilderten Hintergrund der feudalen Welt des 12. Jahrhunderts. Zentrales Thema ist immer die Liebe in verschiedenen Konstallationen:
....
Und eine Jungfrau liegt darin,
vor deren Schönheit schwindet hin
der Lilie Glanz, der Rosen Glühen,
die jung in Sommertagen blühen.
Der Stoff des Bettes ist so reich,
an Wert wohl einem Schlosse gleich.
Darauf die holde Jungfrau liegt
allein vom leichten Hemd umschmiegt,
so ruht ihr Leib nur halb bedeckt
in ihres Mantels Pracht versteckt.
....
Da trat in's Zelt der edle Mann,
die schöne Jungfrau rief ihn an;
Zu ihr an's Bett setzt er sich,
....
(Das Lied von Lanval, Übersetzung von Wilhelm Hertz - unter Weglassung jugendgefährdender Abschnitte ;-)
Neben den Lais werden Marie noch die auf antike Vorbilder zurückgehende Fabelsammlung Esope, sowie (nicht gesichert) das Le Purgatoire de Saint Patrice, zugeschrieben. Letzteres beschreibt unter anderem den Läuterungsweg des Ritters Owein durch das Fegefeuer - in der Schilderung der Qualen gewissermaßen die Vorwegnahme der Divina Comedia Dantes.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Schachzabel
Handwerk und Spiel

Schachzabel, Spiel der Oberschicht - Teil I: Die Ursprünge
Das Schachspiel galt dem Mittelalter als königliches Spiel, als Spiel der adeligen Oberschicht und es zählte zu jenen sieben Künsten, in denen ein Ritter unterrichtet wurde. Die Bedeutung, die dem Spiel zukam, erschließt sich aus der zunehmenden Erwähnung in der zeitgenössischen Literatur. So lässt der Pfaffe Konrad in seiner Bearbeitung des altfranzösischen Rolandsliedes die Boten des heidnischen Königs Marsilie den christlichen Kaiser Karl am Schachbrett sitzend antreffen (Rolandslied des Pfaffen Konrad, um 1170, Vers 682):
....
ie mêre und mêre
vielen sie zuo der erde.
sie funden den keiser zwâre
ob dem schâchzable.
sin antlizze was wunnesam.
....

Hierbei handelt es sich um die erste bekannte literarische Erwähnung des schâchzabel in Mittelhochdeutsch. Sie zeigt, wie sehr das Spiel auch in unserem Raum bereits zu einem Synonym für höfische Lebensart geworden war. Schach wird zu dieser Zeit in Cordoba ebenso gespielt wie im christlichen Spanien, in Kairo wie in Bagdad und Byzanz oder auf den Fürstenhöfen Frankreichs und im süditalienischen Königreich der Normannen. Schachbücher, in allen europäischen Sprachen, von denen das älteste das berühmte Spielebuch (Libro de los Juegos) König Alfons X. ist, beschreiben die Regeln des Spieles und belegen dessen zunehmende Ausbreitung. Doch bis zu diesem Zeitpunkt hatte das Spiel bereits eine lange Entwicklung und einen weiten Weg hinter sich.
Der Ursprung des Schachspiels wird zumeist in Indien vermutet, auch wenn es Meinungen gibt, die dessen Entstehung nach Persien oder auch China verlegen.
In Indien selbst sind schon früh verschiedenste Brettspiele verbürgt. Als Vorform des Schachs gilt ein Spiel für vier Parteien, die in den vier Ecken des Spielbrettes mit jeweils acht Figuren aufgestellt sind. Die diagonal gegen- überliegenden Parteien sind dabei verbündet und arbeiten dabei zusammen, ihr Spielziel zu erreichen. Anders als beim späteren Schach handelt es sich noch nicht um ein reines Strategiespiel, da für die Züge gewürfelt werden muss.
Bis ins 6. nachchristliche Jahrhundert hatte sich daraus durch Verschmelzen der verbündeten Parteien das cáturanga ('das mit den vier Gliedern'), ein militärisches Strategiespiel für zwei Spieler herausgebildet. In den verwendeten Figuren spiegelt sich die Organisation damaliger indischer Heere mit seinen Elefanten, Reitern, Streitwagen und Fußsoldaten wieder. Dazu trat neben den König ein Berater, der sich aus dem ursprünglich verbündeten Heerkönig entwickelt hatte. Damit war die Anzahl der Spielsteine von ursprünglich acht einer Partei auf sechzehn angewachsen.
Die Zugregeln ähnelten schon sehr unseren heutigen, wenn man vom Berater (aus dem sich die Dame entwickelt hat) und dem Elefanten (unserem spätern Läufer) absieht. Ebenso scheint es bereits damals notwendig gewesen zu sein, den Gegner auf die Bedrohung seines Königs hinzuweisen.
Der weitere Weg des Spiels, der über die Araber in den Westen führt, und sein Bedeutungswandel dabei wird ebenso Thema der nächsten Folgen dieser Reihe sein, wie die Fortschritte beim Bau eines schâchzabel-Brettes samt Figuren nach mittelalterlichen Vorbildern. Habet also weiterhin gut acht ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

Gestik
Gesellschaft und Kunst

Gesten, Gebärden und Rituale - Kommunikation im Mittelalter, Teil I
Bei Betrachtung all der prächtig illuminierten Handschriften des Mittelalters verwundert den modernen Menschen häufig die Fremdartigkeit der ausschmückeden Darstellungen und Miniaturen. Was ist es, fragen wir uns, das uns diese Bilder auch dann sofort als 'mittelalterlich' erkennen lässt, wenn wir sie ohne jegliche weitere Informationen vor uns sehen?
Vordergründig wären da Farbgestaltung und modische Details, wie Gewandung und Haartracht, die dargestellten Gebrauchsgegenstände und ähnliches zu nennen. Ein zweiter, genauerer Blick auf die dargestellten Personen lässt uns jedoch meist einige zusätzliche Eigenheiten erkennen, die vielen dieser Abbildungen gemeinsam ist und die ihre Fremdartigkeit auszumachen scheinen. Was gibt es da nicht alles zu sehen an seltsamen Haltungen von Armen und Händen, an Fingergesten und Fußstellungen - kurzum, der gesamte Körper scheint zu sprechen.
Vergleicht man dann mehrere derartige Darstellungen, erkennt man sehr rasch, dass sich die abgebildeten Gesten stets wiederholen. Und dies gilt nicht nur für die Illuminationen der Handschriften, sondern auch für all die die anderen Kunsterzeugnisse jener Zeit, seien es nun sakrale oder profane Fresken oder die Erzeugnisse der Bildhauerei und Schnitzkunst. Überall scheint sich diese seltsame Bildersprache wiederzufinden, deren Verständnis sich uns modernen Menschen im Regelfall entzieht. Dem mittelalterlichen Zeitgenossen aber war sie geläufig und selbsterklärend, auch deshalb, weil allgegenwärtig. Überdies verfügten die Menschen damals über das nötige Wissen, um die zahlreichen 'Zitate', beispielsweise auf Geschehnisse aus dem Alten oder Neuen Testament, erkennen zu können.

Wenden wir uns den literarischen Inhalten jener Zeit selbst zu, erschließen sich uns auch dort Handlungen, in denen jedes Detail, jede Geste, ja die ganze Inszenierung ihre Bedeutung hat. Es scheint fast so, als hätten wir es mit einer Kommunikation durch Gesten, Gebärden und Ritualen zu tun, die häufig der Sprache gar nicht mehr bedarf. Denn wenn Siegfried bei König Gunthers Werbung in Îsenstein dessen Pferd am Zaume hält (officium strepae), dann zeigt er so Brünhilde, dass er (vorgeblich) ein Mann Gunthers, also dessen Vasalle ist. Das aus dieser Täuschung heraus, aus der bewusst herbeigeführten Fehlinterpretation der Standesverhältnisse durch die Umworbene, der Untergang der Burgunder fast zwangsläufig erwächst, sei an dieser Stelle nur erwähnt ...
Gesten und Rituale begegnen uns in den schriftlichen Werken der klassischen Zeit ohne Zahl: Die arthurischen Ritter auf ihren Aventürenfahrten werden standesgemäß begrüßt und bewirtet, erhalten durch die Damen des Hauses den Begrüßungskuss, werden durch den Herrn, der seine besondere Wertschätzung darin zeigt, dass er dem Gast einige Schritte entgegenkommt, beim Mahl an der Hand zum eigenen Tische geführt ...
Und wenn der Held schließlich unvermeidlicherweise auf einen Gegner trifft, dann kann dessen Bösartigkeit dem Leser oder wohl häufiger Hörer schon dadurch zum Ausdruck gebracht werden, dass er all die Verhaltenregeln und -rituale der Höflichkeit einfach beiseite lässt. Dass dies nicht nur Ruchlose und Ungeheuer so handhaben, sondern bisweilen auch misslaunige, schlechterzogene Damen, muss etwa der Artusritter Gawein in Wolframs höfischem Roman Parzifal am eigenen Leib verspüren.
Zum wirklichen Verständnis mittelalterlicher Kunst- und Literaturerzeugnisse müssten wir somit jene Bildersprache verstehen, die dem zeitgenossischen Adressaten geläufig war. Dies wird im vollen Umfang nicht mehr möglich sein, jedoch können immerhin noch gewisse Grundaussagen gemacht werden, die vielleicht zu einer besseren Zugänglichkeit der alten Bilderwelten verhelfen mögen. Genau dies ist das Ziel dieser Themenreihe, die in nächster Zeit ihre Fortsetzung finden wird ...
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

11. Jahrhundert
Normannen/Süditalien

Die normannische Herrschaft in Süditalien - Teil I: Die Anfänge
911 wurde der Wikingerführer Rollo vom westfränkischen König Karl dem Einfältigen mit dem Gebiet der späteren Normandie belehnt. Damit begann die Phase der Sesshaftwerdung und Herrschaftsgründung durch die vormals plündernden Nordmänner. Aus dem Zusammenleben der nordischen Eroberer mit den eingesessenen Romanen entwickelte sich das Volk der Normannen.
Kaum 100 Jahre später bestand in der Normandie großer Landbedarf; die dichte Besiedlung bot ehrgeizigen jüngeren adeligen Söhnen, die von der Erbfolge ausgeschlossen waren, wenig Entfaltungsmöglichkeiten. In ihrem Drang nach Ruhm und dem Erwerb eigener Güter hielten diese Abenteurer stets Ausschau nach günstigen Gelegenheiten , um sich fremden Herren als Söldner zu verdingen und derart Besitz und eigene Herrschaften zu erwerben.
Zur selben Zeit herrschten im südlichen Italien wirre und ständig wechselnde Verhältnisse: Nominell beherrschte Byzanz große Teile des Halbstiefels - jedoch befanden sich nur die Provinzen Apulien und Kalabrien unter der direkten Herrschaft des griechischen Kaiserreiches. In diesen Gebieten war auch die Bevölkerung vorwiegend griechisch.
Bei den an der Westküste gelegenen drei Handelsstadt-Staaten Neapel, Amalfi und Gaeta handelte es sich offiziell um Vasallenstädte
Byzanz. Jedoch verfolgten besonders Neapel und Gaeta häufig eine Politik, welche die eigenen Interessen in den Vordergrund stellte.
Im Landesinneren lagen die langobardischen Grafschaften Benevent und Salerno, deren Herren abwechselnd die Oberhoheit des westlichen und östlichen Kaisers anerkannten, ganz so, wie es ihnen in der jeweils aktuellen politischen Lage am vorteilhaftesten erschien.
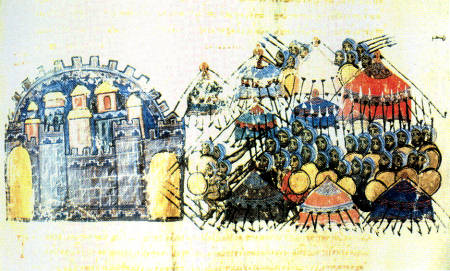
Die ehemalige Provinz Sizilien befand sich trotz aller Rückeroberungsversuche immer noch in der Hand der Sarazenen. 964 war der letzte byzantinische Stützpunkt auf der Insel gefallen, in der Folge hatten die berber-arabischen Streitkräfte auch von verschiedenen Gebieten auf dem Festland Besitz ergreifen können beziehungsweise dort befestigte Stützpunkte errichten können. Nicht zuletzt deshalb konnte dies geschehen, weil sie des öfteren von den einheimischen Fürsten wie auch den Byzantinern zur Unterstützung in deren Auseinandersetzungen zu Hilfe gerufen wurden. So geschehen etwa 982 in der Schlacht von Cotrone, in welcher der deutsche Kaiser Otto II. eine Niederlage gegen Byzantiner und den Emir von Sizilien hinnehmen musste. Als weitreichende Folge dieser Auseinandersetzung kam es zu einem weitgehenden Rückzug des deutschen Kaisertums aus dem Süden Italiens für zwei Jahrhunderte, auch deshalb, weil zur selben Zeit starke Streitkräfte an der deutschen Ostgrenze benötigt wurden.
Zwar waren die Sarazenen nach und nach wieder vom italienischen Festland vertrieben worden, doch hielten ihre Plünderungszüge, die von Sizilien und von Afrika ihren Ausgang nahmen, weiter an und erhöhten das Durcheinander im Lande noch zusätzlich.
In diese Zeit fällt die Einwanderung vieler normannischer Abenteurer. Manche einer von ihnen hatte bei der Pilgerfahrt ins Heilige Land Zwischenstation in einem süditalienischen Hafen eingelegt und verblieb dann bei der Rückreise dauerhaft, um sich den langobardischen Fürsten als Söldner zu verdingen.
Zurück zum Seitenanfang oder zur Hauptseite

21. Oktober 2007
Einige erläuternde Worte ...
Bei unserer Beschäftigung mit dem Thema Mittelalter hat sich im Laufe der Zeit eine ansehnliche Bibliothek zum Thema angesammelt - und eine Einschränkung des ungehemmten Wachstums des Bücherbestandes wird wohl allenfalls eines fernen Tages durch Platzmangel erfolgen. Natürlich ergab sich irgendwann der Wunsch, manche dieser Inhalte, von denen wir denken, dass sie auf ein gewisses Interesse stoßen könnten, auf unserer Seite zugänglich zu machen.
Die logische Vorgangsweise, Artikel über verschiedene Themen von einer Arbeitsgruppe Geschichte und altes Wissen verfassen zu lassen und Online zu stellen, würde jedoch für eine umfassende Behandlung des jeweiligen Themas einen großen Zeitaufwand erfordern. Außerdem soll es ja nicht jedermanns Sache sein, einen langen trockenen Text in einem Zug zu lesen... Daher die Aufteilung der Themen in kurze, leicht lesbare Teile, die hier nach und nach veröffentlicht werden. Die Aneinanderreihung aller zu einem bestimmten Gebiet gehörigen Teilartikel sollte dann einen Themenbereich mehr oder weniger umfassend abdecken.
Dabei werden hier nicht nur Artikel zu geschichtlich relevanten Ereignissen, sondern auch solche zu Kultur, Technik, Alltagsleben und mittelalterlichen Realien, usw., also zu allen Bereichen mittelalterlichen Lebens, in zwangloser Folge abgefasst - ganz so, wie es der jeweiligen Gemütslage des/der Autor(en) entspricht. Das heißt aber auch, dass nicht zwangsläufig eine Artikelserie abgeschlossen werden muss, bevor ein anderes Thema angeschnitten wird. Vielmehr soll das geplante bunte Durcheinander für Abwechslung sorgen - beim Lesen wie auch beim Verfassen.
Sobald eine Themenreihe abgeschossen ist, wird sie aus dieser Unterseite herausgenommen und in ihrer Gesamtheit in die entsprechnde Arbeitsgruppe verschoben. Vervollständigt wird das Ganze dann noch durch entsprechende Quellhinweise werden. Damit sollten nach einer gewissen Zeit in allen Abschnitten (hoffentlich) interessante Themengebiete zu Nachlesen existieren ...
Geplant ist eine wöchentliche Veröffentlichung der Teilartikel, dies jedoch nicht auf einen bestimmten Tag festgelegt: Je nach verfügbarer Zeit wird es mal länger, mal kürzer dauern, bis aktualisiert werden kann ...
Niemand ist vor Irrtum und Fehlern gefeit. Daher sind wir stets über konstruktive Kritik froh und dankbar, zeigt eine solche doch, dass die Artikel gelesen und hinterfragt werden. Wir sind hier für die entsprechenden Rückmeldungen erreichbar. Ebenso kann diese Mailadresse zur Kontaktaufnahme verwendet werden, wenn das Interesse nach eine Mitarbeit bestehen sollte ...
Zu guter Letzt: Hier wie auch sonst überall auf unserer Seite verbergen sich eine ganze Reihe von Rechtschreibfehlern. Diese wurden absichtlich versteckt, um auch Germanisten eine Freude beim Lesen und Suchen zu bereiten. Wer denn alle 863 Fehler entdeckt, möge sich bei uns melden, um sich seinen Preis abzuholen ;-)
Zurück zum Seitenanfang, zurück zum Anschlagbrett oder zur Hauptseite

© 2007 - 2015, Gestaltung und Inhalt: H. Swaton - alle Rechte vorbehalten